"Wer die Wahrheit nicht weiß, der ist bloß ein Dummkopf.
Aber wer sie weiß und sie eine Lüge nennt, der ist ein Verbrecher."
- Bertold Brecht, Deutscher Dramatiker, 1890-1977 -
 |
Klare Aussage, Risiko für DMK.
Fundstück, Netzwerk X |
„In leuchtenden Farben und mit einem besonderen Augenmerk auf Vielfalt und Gemeinschaft“:
Zitat Design-Magazin "Page"
EXKLUSIV: Bis zu 75% Ausländeranteil pro Packung!
Was für ein Käse: "Milram" und "Deutsches Milchkontor" verkaufen jetzt links-grün-ideologischen Käse mit ideologischer Verpackung und bis zu 75 % Ausländeranteil pro Packung! Damit erhoffen sich die Milch-Marketer neue Kunden - ohne Deutsch-Kenntnisse, ohne Euros auf der Tasche, womöglich aber mit Klappmesser in der Tasche. Deutschland hat 15 % Ausländeranteil - und zur Manipulation der "Milram"-Milchbarone eine klare Meinung:
"Warum nicht ein paar Messer oder Vergewaltigungsszenen drauf? Das kommt häufiger vor - meines Wissen - als die glückliche bunte Mischfamilie!!"
Rechtsanwalt Mathias Markert, 24.500 Follower, Netzwerk X
Links. Limitiert. Liegen lassen.
Die woke "Design-Edition" des Milchkontors:
 |
Ausländerquote: 50, 66 und bis zu 75 %:
Politische Propaganda fernab jeglicher Realität.
Grafik: Deutsches Milchkontor - DMK Group |
"Wie lange wird es wohl dauern, bis #Milram einsieht, dass diese Scheiße nicht zieht?"
@ganCheangal, 8.500 Follower, Netzwerk X
Hui, das geht im Netz ja ab wie Schmitz Katze! Unter den Hashtags #MilramBoykott sowie #MilramBoykottJetzt bekommt eine der größten Molkereien im Land - das Deutsche Milchkontor, Konzernsprech: "DMK-Group" - gerade richtig sein Fett weg. Grund: 10 links-grün-ideologische Verpackungen des überteuerten Industrie-Schnittkäses der hauseigenen Premiummarke "Milram" - mit schwarzen, braunen und sonstigen"bunten" "Darsteller*Innen" in divers-woker Kuscheloptik. Fast so friedlich, wie im Freibad ... Chefredakteur und echter Waren-Müritzer Thomas Keup nimmt sich die unappetitliche Entgleisung vor.
-
Hamburger Senat lässt zum ÖPNV-Gipfel mit 600.000,- € Kosten die Sau raus.
 |
6 Mio. € kostete die Stadt Hamburg das UITP-Spektakel mit 2 Partys.
Foto: UITP, Netzwerk X |
Hamburg, 25.07.2025: Für den internationalen ÖPNV-Kongress "UITP" in den Jahren 2025 und 2027 hat die Hansestadt Hamburg allein aus Berlin rd. 8 Mio. € Steuermittel kassiert - zugunsten des Senats, der stadteigenen Messe- und Congress-Gesellschaft und der umstrittenen "VW"-Tochter "Moia". Nach der diesjährigen Premiere der "UITP" und der Jahrestagung des Verbandes Deutscher Verkehrsunternehmen lies es der Senat richtig krachen.
602.000,- € aus Steuergeldern haben die Hamburger Partner für zwei VIP-Parties in der Altonaer Fischauktionshalle und dem Landhaus Walter im Stadtpark zum Fenster rausgeschmissen. Das musste die Verkehrsbehörde auf eine Kleine Anfrage der CDU-Fraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft jetzt kleinlaut zugeben. Zuvor hatte der Senat lediglich 491.000,- € zugegeben. Damit steht der Verdacht der Falschaussage gegenüber dem Parlament im Raum.
Am Abend des 17. Juni '25 wurde für stolze 187.000,- € im Landhaus Walter mit den Deutschen Verkehrsunternehmen gefeiert - mit 840 Gästen. Als Goodie-Bag lies sich der Senat nicht lumpen - und verteilte Taschen für 22,- € das Stück - mit Kaffee, Gewürz- und Backmischungen ... weil wir Hamburg sind. Beim Netzwerkabend von ÖPNV-Kongress und deutschem Verkehrsunternehmer-Treffen in der Altonaer Fischauktionshalle wurde richtig geprasst: 415.000,- € für 2.000 geladene und sich durchfutternde Gäste.
Die grün-regierte Verkehrsbehörde von Senator Anjes Tjarks stotterte sich aus der Sache damit heraus, dass die Teilnehmer ja Tickets für 780,- € bis 3.500,- € gekauft und damit auch die Partys mitfinanziert hätten. „Der Party-Skandal von Verkehrssenator Anjes Tjarks weitet sich aus“, sagte CDU-Verkehrspolitiker Philipp Heißner.
„Statt endlich vollumfänglich für Transparenz zu sorgen, muss der rot-grüne Senat aufgrund meiner Nachfrage einräumen, dass er deutlich mehr Steuergeld verfeiern ließ, als bisher bekannt war. Wir reden nun über deutlich mehr als eine halbe Million Euro, allein bei einer Party über mehr als 100.000 Euro für Verpflegung und fast 20.000 Euro für Goodie-Bags – alles Steuergeld“.
Christoph Kreienbaum, PRler der Hochbahn, redete die widersprüchlichen Zahlen undurchsichtig klein: „Die Gesamtkosten, die die Hochbahn getragen hat, liegen bei 500.000 Euro. Daran hat sich nichts geändert. Richtig ist, dass der Hochbahn-Anteil an dem UITP-Abend in der ersten Kleinen Anfrage nicht mit einbezogen worden ist, weil nicht explizit danach gefragt wurde.“
Kreienbaum lies es sich auch nicht nehmen, die Gesamtkosten für den UITP-Kongress 2025 und die beiden Partys i. H. v. zusammen 6 Mio. € in bester hamburgischer Manier zu kommentieren: "Immerhin konkurrieren wir mit internationalen Metropolen von Weltrang.“ Das ändert allerdings nichts an der Tatsache, dass es sich in jedem Fall um Steuergelder handelte, die Hochbahn und Senat u. a. in "Wein, Weib und Gesang" investierten.
-
Hamburger Möchtegern-Öko-Bank feuert jeden 2. Mitarbeiter - Rest von 50 Mitarbeitern soll Überleben sichern.
 |
Immer wieder schmeißen Sie Mitarbeiter raus, weil sie es nicht packen.
Foto: Tomorrow Bank |
Hamburg, 22.07.2025 Die wegen unlauterer Werbeaussagen zur Nachhaltigkeit ihrer Angebote in der Kritik stehende vermeintliche Öko-Bank "Tomorrow" ist ins erneut schwer Schlingern geraten. Das Startup-Magazin "Gründerszene" berichtet, dass das kaum bekannte Fintech jetzt die Hälfte seiner Mitarbeiter rausgeschmissen hat. Das betrifft rd. 50 Mitarbeiter des erst im Oktober '24 mit 5 Mio. € frischem Kapital am Leben erhaltene Startup.
Die Hiobsbotschaft wurde vor einer Woche in einer internen Mitteilung bekanntgegeben.Die fadenscheinige Begründung des Mitbegründers Jakob Berndt: "organisatorische Restrukturierung" wegen "herausfordernder Rahmenbedingungen". Diplomatischer konnte die Führungsetage ihr Versagen bei Kundengewinnung und Profitabilität offenbar nicht tarnen.
Interessant: Noch im Juni d. J. wurden neue Mitarbeiter eingestellt und mit der gesamten Belegschaft gefeiert. Das Management macht heute dicht und verweigert Auskünfte darüber, welche Bereiche konkret betroffen sind. Damit versuchen die bereits umstrittenen Jungunternehmer offensichtlich, ihr Missmanagement nicht öffentlich werden zu lassen.
Jetzt behauptet die Chefetage mit dem Rausschmiss jedes zweiten Kollegen wieder profitabel werden zu wollen. Ob dies klappen kann, darf angezweifelt werden. Es ist nicht das erste Mal, dass die Hamburger trotz aller Nachhaltigkeits-Reklame Personal rausschmeissen, um zu überleben.
Das vermeintliche Vorzeige-Fintech feuerte kurz vor Weihnachten 2022 1/4 aller Mitarbeiter. Die Smartphone-Bank mit grünem Anstrich beschäftigte laut Website vor der damaligen Kündigungswelle rd. 120 Mitarbeiter. Zu den Gründen zählten damals ein "schwaches Geschäft" und die "Sparsamkeit der Kunden" - wer's glaubt.
-
Niedersachsens SPD-Justizministerin will die E-Akte auf Biegen und Brechen einführen.
 |
In Niedersachsen dauert die Digitalisierung länger - trotz SPD-Ministerin.
(Foto: André Otto Hamburg) |
Hannover, 22.07.2025: An Niederachsens Amtsgerichten, Landgerichten, Oberlandesgerichten und Staatsanwaltschaften soll Anfang kommenden Jahres die E-Akte verpflichtend flächendeckend eingeführt werden. Gegen die Hau-Ruck-Aktion der SPD-Justizministerin Kathrin Wahlmann gehen Teile der Justiz auf die Barrikaden. Grund: Die Justiz im größten norddeutschen Bundesland fühlt sich bereits heute massiv überfordert. Die Einführung der E-Akte ohne Rücksicht auf Verluste würde dies weiter verschärfen. Die SPD-Funktionärin läuft ins offene Messer der Opposition. Die Parlamentarische Geschäftsführerin der CDU-Landtagsfraktion Carina Hermann:
„Die Bundesjustizministerin hat mit ihrem Vorschlag, die Einführung der E-Akte in den Gerichten und Staatsanwaltschaften auf Anfang 2027 verschieben zu können, auf die berechtigte Kritik aus Justizkreisen reagiert. Dass Ministerin Wahlmann eine Verschiebung allerdings – trotz der eindringlichen Forderung des Hauptpersonalrats im niedersächsischen Justizministerium sowie des Hauptrichterrates – nicht für nötig hält, zeigt, dass sie die erheblichen Herausforderungen in der Justizverwaltung und die berechtigten Sorgen der Beschäftigten nicht ernst genug nimmt."
Ministerin Wahlmann regiert an ihrem Geschäftsbereich vorbei, so die Union. "Wir müssen den Gerichten und Staatsanwaltschaften zutrauen, dass sie ihre eigenen Belastungsgrenzen realistisch einschätzen können. Wer Digitalisierung mit Augenmaß will, muss auf diejenigen hören, die täglich unter den aktuellen Bedingungen arbeiten. Es ist nun die Aufgabe der Ministerin Wahlmann, Verantwortung zu übernehmen und Lösungen für die bestehenden Probleme zu finden, statt mit dem Finger auf andere zu zeigen. Wir fordern die Ministerin auf, die Warnungen aus der Justiz ernst zu nehmen.“
Ein Referentenentwurf der Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (ebenfalls SPD) ermöglicht, dass die Bundesländer die für Anfang 2026 vorgeschriebene vollständige Digitalisierung der Justiz um ein Jahr verschieben können – auf Anfang 2027. Das war auch die Forderung des Hauptpersonalrats im niedersächsischen Justizministerium und auch die des Hauptrichterrates gewesen. Doch in einem internen Schreiben mit Datum vom 10. Juli, das dem "Politikjournal Rundblick" vorliegt, trifft das von Wahlmann geführte Ministerium eine vor diesem Hintergrund überraschende Feststellung: Die vom Bund angebotene Vertagung sei „nicht erforderlich“.Einen ausführlichen Beitrag mit weiteren Details zum Thema gibt es im Onlinemagazin "Rundblick Niedersachsen". -
Rot-Grün will auch Sozialhilfempfänger an Alster und Elbe per Geldkarte kontrollieren.
 |
Der Hamburger Senat will offenbar totale Kontrolle per Geldkarte.
(Foto: Marco Verche, Lizenz: CC BY 2.0) |
Hamburg, 21.07.2025: Der rot-grüne Senat der Freien und Hansestadt plant, die Bezahlkarte für Asylbewerber auch für Sozialhilfempfänger auszugeben und so eine weitgehende Kontrolle über die gezahlte Unterstützung ausüben. Das geht aus einer kleinen Anfrage der Linken-Fraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft hervor.
Damit will Rot-Grün offensichtlich totale Kontrolle über mit verbundenen Repressionen ausüben. Die Linke schreibt dazu in einer aktuellen Meldung: Ein entsprechendes „Vorprojekt“ ist in Vorbereitung, zunächst als Ersatz für Barauszahlungen. Dabei ist es noch nicht einmal gelungen, alle Funktionen der länderübergreifenden Bezahlkarte umzusetzen.
Finanzsenator Andreas Dressel erklärte gegenüber dem Radiosender NDR 90,3: "Als Stadt haben wir natürlich ein Interesse daran, dass wir solche Prozesse weiter modernisieren, dass wir wegkommen von Bargeldauszahlungen." Der schon in der Vergangenheit unsozial aufgefallene SPD-Politker redete sich damit heraus, dass nicht jeder Sozialhilfeempfänger ein Konto hätte.
Carola Ensslen, fluchtpolitische Sprecherin der Links-Fraktion: „Es war absehbar, dass die repressive Bezahlkarte auch auf andere Leistungsempfänger ausgedehnt würde. Und es wird nicht bei der Ausdehnung auf die Altersgrundsicherung und Sozialhilfe bleiben. Was harmlos mit der Abschaffung von Bargeldauszahlungen beginnt, schafft die Möglichkeit für Einschränkungen der Geldnutzung wie bei Geflüchteten.
Dabei ist die Bezahlkarte kompliziert und fehleranfällig. Dass man es in fünf Monaten nicht schafft, die Funktion für den Onlinehandel einzurichten, liegt in erster Linie an den Beschränkungen auf bestimmte Waren. Mit Verwaltungsvereinfachung hat das nichts zu tun. Diese Schikanemaßnahme „Bezahlkarte“ muss abgeschafft statt auf andere Personengruppen ausgedehnt werden.“
Die jetzige, umstrittene Bezahlkarte kann von Asylbewerbern wie eine Debitkarte eingesetzt werden. Dabei können 50,- € bar abgehoben werden. Die Karten können im Supermarkt oder beim Friseur verwendet werden - jedoch nicht im Ausland, im Online-Handel, für Geldtransfers oder Glücksspiele, fasst der NDR zusammen.
-
SafeNow-App am Hamburger Hauptbahnhof: Rohrkrepierer oder Erfolgsmodell?
 |
Hat die "SafeNow"-App nun geholfen oder nicht? Der Streit eskaliert.
Foto: HANSENVALLEY |
Hamburg, 15.07.2025: Wie die Deutsche Bahn Ende Juni d. J. mitteilte, hat sie das "Pilotprojekt zu Hilferuf-App am Hamburger Hauptbahnhof abgeschlossen" - und damit die "SafeNow"-Zone mit gleichnamiger App am Hamburger Hauptbahnhof am 30. Juni abgeschaltet. Der Anbieter bedauert diese Entscheidung:
"SafeNow hat sich am Hamburger Hauptbahnhof über einen Zeitraum von mehr als 20 Monaten als niedrigschwellige Möglichkeit bewährt, um in unsicheren Situationen frühzeitig Hilfe zu holen. Laut dem uns von der DB vorliegenden Abschlussbericht stärkt die App nachweislich das subjektive Sicherheitsgefühl, erhöht die objektive Sicherheit und ließ sich erfolgreich in den Regelbetrieb integrieren", so Gründer und CEO Tilman Rumland.
Entgegen der öffentlichen Aussage, die App sei wenig genutzt worden, wurde "SafeNow" über den Zeitraum von mehr als 20 Monaten über 58.000 mal geöffnet - im Durchschnitt alle 15 Minuten, Tag und Nacht. Allein die Möglichkeit, jederzeit handeln zu können, hat das subjektive Sicherheitsgefühl vieler Menschen spürbar gestärkt, so "SafeNow".
Insgesamt wurden laut Anbieter mehr als 600 Alarme ausgelöst. In mehreren dokumentierten Situationen konnten u.a. Messerattacken, Suizidversuche und Überdosis-Vorfälle frühzeitig erkannt und verhindert werden. Die Bahn erklärte gegenüber Medien, dass es pro Tag gerade einmal einen Alarm gab - zumeist ausgelöst von Mitarbeitern oder Einzelhändlern im Bahnhof.
Dabei verschwiegt die Bahn, dass mit 34 % mehr als ein Drittel aller Notrufe von Reisenden ausgelöst wurden, wie der Bahn-eigene Abschlussbericht bestätigt. Mit mehr als 49 % wurden rund die Hälfte aller Alarmierungen von Händlern aktiviert. Nach dem Abschlussbericht kamen nur 16 % von Bahn-Mitarbeitern.
Entgegen der Aussage der DB AG, der Nachteil der App wäre, dass sie nur den Standort funkt, aber keine Einzelheiten, wurde von "SafeNow" auf ausdrücklichen Wunsch der Bahn eine extra Funktion entwickelt. Damit konnten Alarme unkompliziert qualifiziert werden, etwa durch Hinweise wie "fühle mich unwohl" oder "medizinischer Notfall".
Die Notruf-App wurde im Oktober 2023 mit großem Aufgebot von Hamburgs Innensenator Andy Grote, Bundespolizei und Landespolizei präsentiert. Grote philosophierte sogar von einer Ausweitung der App auf das kriminell-belastete Umfeld des Hauptbahnhofs. Der umstrittene SPD-Poltiker schwadronierte von der "SafeNow"-App als "Baustein in unserem Sicherheitspaket für den Hamburger Hauptbahnhof".
Eine ausführliche Meldung zum Thema ist auf "Presseportal" zu finden. Ein aktueller Bericht zur Einstellung der App gibt es beim NDR. -
DB InfraGo unterschlägt Metronom-Abfahrten in seinen Anzeigen.
 |
Die Deutsche Bahn macht dem Wettbewerber Metronom gerade Stress.
(Foto: Metronom, Jan Sieg) |
Uelzen, 08.07.2025: Seit Dienstag vergangener Woche zeigen auf zahlreichen Bahnhöfen die Bahnsteiganzeiger falsche oder unvollständige Informationen zu "Metronom"-Zügen an. Teilweise wurden gar keine Informationen angezeigt. Die Störungen hielten auch am Mittwoch weiter an. Wie lange die Störung noch dauert, ist unbekannt.
Laut "Metronom" sind Bahnhöfe in ganz Deutschland betroffen. Laut Betroffenen fehlen neben Informationen auf Bahnsteig-Anzeigen auch in Apps die Angaben zu den "Metronom"-Zügen. Laut "Metronom" betrifft dies alle Linien des Anbieters und bundesweit Anzeigen.
Als Fehler haben die Uelzener das zentrale Auskunftssystem der "DB InfraGo" ausgemacht. Die "Deutsche Bahn" dementiert die fehlerhaften Anzeigen jedoch.
-
Heimatliebe ist kein Verbrechen: Attacke des linken Rektors gegen eine 16-jährige Schülerin war illegal.
 |
Heimatliebe ist kein Verbrechen.
(Grafik "X"/Twitter, @PolitikNote6) |
Greifswald, 07.07.2025: Der massive Polizeieinsatz mit Abführen der Schülerin Loretta B. aus dem Unterricht mit anschließender Gefährderansprache auf Druck des SPD-nahen Schulleiters war illegal. Das entschied jetzt das Verwaltungsgericht Greifswald. Die Eltern der 16-jährigen Schülerin aus Ribnitz-Damgarten hatten eine Feststellungsklage gegen das Land Mecklenburg-Vorpommern und das für die übergriffige Polizei verantwortliche Innenministerium eingereicht. Mit dem Urteil ist klar: Das Anrücken von drei Beamten war völlig überzogen.
Die Richter betonten in ihrem Urteil: „Die Art und Weise der Durchführung der Maßnahme ist nicht verhältnismäßig gewesen. Das Gespräch der Polizisten mit Loretta hätte auch zu Hause oder auf der Polizeiwache stattfinden können. Es ist nicht notwendig gewesen, sie vor aller Augen aus dem Unterricht zu holen und damit eine Stigmatisierungswirkung hervorzurufen.“
Die Mutter des Polizei-Opfers erklärte gegenüber der "Jungen Freiheit": „Meine Tochter soll rehabilitiert werden. Es ist wichtig, dass meiner Tochter hier Gerechtigkeit widerfährt, denn sie hat nichts Strafbares getan, und sowohl das Innen- als auch das Bildungsministerium haben das Verhalten der Polizei und des Schulleiters immer verteidigt.“
Der Vertreter des Landes Mecklenburg-Vorpommern verweigerte vor Ort eine Stellungnahme zu der juristischen Klatsche nach dem übergriffigen Verhalten des linken Schulleiters und seiner Alarmierung von Polizeibeamten aus Stralsund. Ebenso ist keine Entschuldigung der seinerseits übergriffigen Medien, wie "NDR MV", "Ostsee-Zeitung und "T-Online" erfolgt. Bereits vor gut einem Jahr Ende Mai 2024 war klar:
Der übereifrige linke Rektor des Richard-Wossidlo-Gymnasiums in Ribnitz-Damgarten - Jan-Dirk Zimmermann - hatte mit dem von ihm initiierten Polizeiverhör einer vermeintlich AfD-nahen Gymnasiastin gesetzeswidrig über das Ziel hinaus geschossen. Der SPD-nahe Schulleiter aus Aachen hatte die 16-jährige Loretta B. - eskortiert von drei uniformierten Beamten aus Stralsund - rechtswidrig zu einer Gefährderansprache gezwungen und die erziehungsberechtigte Mutter vorher nicht informiert.
Das hatte eine Anfrage des AfD-Abgeordneten im Schweriner Landtag - Enrico Schult - beim zuständigen Bildungsministerium ergeben. Schult wollte wissen, welche vermuteten oder drohenden Straftaten in dem - zunächst gegenüber den Abgeordneten des Landtages geheim gehaltenen - Rundschreiben des Ministeriums vom 22.02.2024 zur Rechtfertigung eines umgehenden Polizeieinsatzes ohne Einbeziehung der Erziehungsberechtigten genannt werden.
Der Fall hatte nach Bekanntwerden Anfang 2024 bundesweit u. a. bei "FAZ, NZZ und Welt" Aufsehen erregt, vor allem, weil der Rektor - wie laut Rundschreiben bei Bombendrohungen, Amokandrohungen, Waffen- und Drogenvorkommnissen vorgesehen - erst mit drei uniformierten Beamten vor der Klasse der verängstigten Schülerin antrat, statt die Mutter zu informieren. Nachträglich bekräftigte der offensichtlich übereifrige "AfD-Jäger" auch gegenüber der Mutter der Betroffenen, dass er laut Dienstanweisung zunächst die Polizei rufen musste.
Die Polizei stellte bereits vor dem Eintreffen der Streife vor Ort fest: Weder das Posten des AfD-Clips mit blauer "Statista"-Deutschlandkarte zu AfD-Wahlergebnissen aus Mai 2022 noch die persönliche Äußerung der Schülerin auf "TikTok" waren strafrechtlich relevant. Dennoch unterzogen die Beamten die Schülerin auf Bitten des Schulleiters einer "Gefährderansprache" - Personen vorbehalten, die die öffentliche Sicherheit gefährden könnten.
Laut feingeschliffener Polizeimeldung ging es später nur darum, "sie vor möglichen Anfeindungen zu schützen, die sich aus ihren Aktivitäten in sozialen Netzwerken ergeben könnten". „Ganz offenbar war der Polizeieinsatz am Ribnitz-Damgartener Wossidlo-Gymnasium Ende Februar unangemessen und stand sogar den internen Regelungen des Bildungsministeriums entgegen“, sagte Enrico Schult gegenüber der "Jungen Freiheit". Der Fall hatte hohe Wellen geschlagen, nachdem Unbekannte ein Transparent mit der Aufschrift "Heimatliebe ist kein Verbrechen" vom Dach der Schule ausrollten.
Der Fall sorgte weitergehend für Schlagzeilen, weil "X"-Chef und Tech-Tycoon Elon Musk auf seinem Nachrichten-Netzwerk nach Bekanntwerden der Veröffentlichung von "Schlumpf-Videos" öffentlich nachfragte: "Ist das alles?" Nach Kritik an dem überzogenen und als rechtswidrig bestätigten Vorfall seitens des parteilosen Landrats von Vorpommern-Rügen wurde dieser von den Grünen im Kreistag in die Nazi-Ecke gestellt, da er sich nicht gegen die vermeintlich rechtsextremistische Haltung der Schülerin gestellt hätte.
-
Linksextremistin des Trans-Bundesverbandes fordert online zu Mord und Folter von reichen Menschen auf.
 |
Umstrittene CDU-Politikerin Prien: Jetzt hat sie ein weiteres Problem.
Grafik: Netzwerk X/Junge Freiheit |
Berlin, 30.06.2025: Eine Fachreferentin für Gewaltschutz beim Bundesverband Trans hat auf der Plattform "Bluesky" zur Ermordung von "unverantwortlich reichen Menschen“ aufgerufen. Solche Morde seien "nicht nur ethisch vertretbar, sondern nachgerade geboten“; auch vorherige Folterungen seien "vollkommen in Ordnung“. Der Bundesverband Trans wird vom umstrittenen Programm "Demokratie leben!“ des Familienministeriums finanziert. Die Bildungspolitikerin und AfD-Bundestagsabgeordnete, Birgit Bessin, fordert:
„Es ist ein Skandal, dass ein mit Steuergeldern finanzierter Verband mit linksextremen Mordaufrufen und unerträglichen Gewaltfantasien auffällt. Doch der Vorgang ist nicht nur ein Fall für die Justiz, sondern auch für die Politik: Familienministerin Prien muss unverzüglich Konsequenzen ziehen, die Finanzierung linksextremer Strukturen beenden und darauf drängen, dass die betreffende Mitarbeiterin nicht länger für eine regierungsseitig unterstützte Organisation tätig sein kann."
In Bezug auf "Hass und Hetze" müsse die systematische Blindheit auf dem linken Auge sofort aufhören. Während die Verfasser harmloser ‚Schwachkopf‘-Satiren wie Schwerverbrecher behandelt würden, genießten beinharte Mordunterstützer den Geldregen eines CDU-Bundesministeriums, so die AfD-Vertretin.
Die AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag fordert widerholt seit vielen Jahren die Beendigung des links-grünen Propaganda-Programms „Demokratie leben!“. Grund: Die Entgleisung der sogenannten Fachreferentin für Gewaltschutz sei kein Einzelfall.
-
VW-Tochter Cariad reißt mit Software-Mängeln jetzt Audi-Premieren in China ein.
 |
2023 war bei Cariad die Welt noch in Ordnung - zumindest nach außen.
Foto: Cariad SE |
Wolfsburg/Ingolstadt, 25.06.2025: Die "VW"-Skandal-Firma "Cariad" sorgt erneut für monate- und jahrelange Verzögerungen bei neuen Modellen im Luxussegment. Diesesmal trifft es vor allem den Ingolstädter Sportwagen-Hersteller "Audi". Aufgrund von Problemen mit der durch "Cariad" maßgeblich entwickelten E-Mobilitäts-Plattform "E3 1.2" verzögern sich jetzt die Starts für die beiden Modelle "Q6L" und "A6L".
Die Software-Plattform hatte schon bei der Konzernschwester "Porsche" für drei Jahre Verzögerung beim Start des elektrischen "Porsche Macan" gesorgt. Um die Probleme in den Griff zu bekommen, sollen sich jetzt mehrere hundert Mitarbeiter auf den Weg ins neue chinesische Werk des Gemeinschaftsunternehmens "Audi FAW NEV Company" machen.
Als Hauptmängel berichtetet das Hamburger "Manager Magazin" aus gut unterrichteten Firmenkreisen über Steuerungsprobleme für die Batterien. Offensichtlich will man zunächst mit einer abgespeckten Version der Software in den Verkauf gehen. Doch auch dieser Kunstgriff scheint nicht zu reichen.
Um die ohnehin verzögerte Produktion für den chinesischen Markt von geschätzt lediglich 20.000 produzierbaren Fahrzeugen im laufenden Jahr nicht noch größer werden zu lassen, werden die fertig montierten Neuwagen zunächst auf Halde gestellt und erst später mit der dann hoffentlich fehlerfreien Software in abgespeckter Version aktiviert.
Weil der Druck im chinesischen Markt durch heimische Hersteller, wie "BYD", Nio" & Co. erheblich sei, haben die Ingolstädter für den Markteintritt mit den neuen Luxusmodellen bei SUV und Limousine bereits kräftig an der Preisschraube gedreht. So geht der "Audi Q6" in China für rd. 40.000,- € an den Start, in Deutschland fängt er erst bei 63.500,- € an.
Für die Marke mit den vier Ringen sind die aktuellen Probleme durch die Konzern-Tochter "Cariad" ein schwerer Schlag ins ohnehin bröckelnde China-Geschäft. In In guten Zeiten wie 2023 verkauften die Ingolstädter rd. 730.000 Edelfahrzeuge ins Reich der Mitte. Schon im vergangenen Jahr lief der Absatz schleppend und brach um satte 11 % ein. Und dieses Jahr wird es womöglich nicht besser werden.
Hintergrund: Seit 1. Juni 2024 hat "Bentley"-Manager Peter Bosch auf Wunsch von "VW"-Konzern-Chef Oliver Blume den Chefposten bei dem 6.000-Mann-Betrieb inne. Die massiven Probleme bei der weltweit präsenten Software-Gesellschaft hatten im Juli '23 auf Drängen der "VW"-Eigentümer-Familien Piech und Porsche den vormaligen Vorstandschef Herbert Diess den Chefposten gekostet.
In die aus mehr als 15 IT-Konzern-Gesellschaften zusammengewürfelte Tech-Firma "Cariad" sind in den vergangenen Jahren vor allem unter dem früheren "VW"-Konzern-Boss Herbert Diess mehr als 14 Mrd. € geflossen, ohne die gesteckten Ziel zu erreichen.
Nach geschäftskritischen Verzögerungen bei der Auslieferung der Luxus-Modelle "Audi Q6 e-tron" und "Porsche Macan electric" um zwei volle Jahre auf das Jahr 2024 durch nicht gelieferte Software von "Cariad" setzt Konzern-Chef Oliver Blume auf die dezentrale Zusammenarbeit mit verschiedenen IT-Unternehmen, wie Bosch aus Deutschland, Xpeng und Horizon Robotics in China sowie Rivian in den USA.
-
Linke US-Boykott-Aufrufe: Groß Klappe - nichts dahinter. Deutsche und Europäer kaufen trotzdem unverändert US-Produkte.
 |
Fakten zählen härter als linke Wunschvorstellungen.
Grafik: Galaxus |
Hamburg, 24.06.2025: Rd. 60 % der Verbraucher in den DACH-Ländern Deutschland, Österreich und Schweiz sowie den weiteren EU-Top-5-Ländern Frankreich und Italien wollen auf Grund der politischen Umstände in den Vereinigten Staaten US-Produkte und -Hersteller boykottieren. Das erklärten 5.263 vom Markt- und Meinungsforschungsinstitut "YouGov" vom 2. April bis 6. Mai des Jahres repräsentativ befragten Konsumenten aus den west- und südeuropäischen Ländern im Auftrag der europäischen Online-Händler und Marktplätze von "Galaxus" und "Digitec".
Allein in Deutschland wollen danach 26 % auf jeden Fall auf Handys von "Apple", Sneakers von "Nike", Autos von "Tesla", Streaming mit "Netflix", Cloudspeicher von "Microsoft", Getränke von "Coca-Cola" oder Essen von "McDonald’s" verzichten. 27 % halten dies für durchaus wahrscheinlich. Am "Gratis-Mutigsten sind die Österreicher mit zusammen 57 % Boykott-Ankündigungen - oder zumindest Überlegungen.
Der Haken: Dem Gratismut mit vollmundigen Boykott-Drohungen folgt - nichts, und das europaweit! Das haben detaillerte Auswertungen der beiden Online-Marken aus den Abverkäufen über ihre Online-Portale zwischen Mai 2024 und Mai 2025 ergeben. Wurden im Mai des Vorjahres 18,3 % US.-Produkte bei den "Migros"-Händlern gekauft, waren es ein Jahr später fast genauso hohe 17,5 %. "Ein Boykott sieht anders aus", sagt Hendrik Blijdenstein, Chief Commercial Officer von "Digitec Galaxus".
Junge Kunden unter 35 Jahren interessiert ein Boykott so gut wie gar nicht: Hier standen 18,7 % US-Produkte in 2024 mit 18,0 % fast ebenso viele Einkäufe von US.Marken in diesem Jahr gegenüber. Auch Männern unter den Online-Kunden lassen sich nicht politisieren: Hier lag der US-Anteil 2024 bei 18,5 %, in diesem Jahr bei 17,5 %. Lediglich bei älteren Semestern verfing der Gratismut ein wenig - und zahlen sanken von 17,8 auf 17,0 %.
Den Hauptgrund hinter der zögerlichen Reaktion auf die Entwicklungen in den USA sieht der COO in unser aller Einkaufsgewohnheiten, gekoppelt mit dem Unwissen über die Herkunft der Marken. "Den meisten dürfte klar sein, dass Tesla, Barbie oder Microsoft amerikanische Marken sind. Danach ist aber schnell Schluss." Tatsächlich klingen viele US-Marken so gar nicht nach Yeehaw:
Die Seifenmarke "Le Petit Marseillais" gehört beispielsweise zum US-Konzern "Johnson & Johnson", Verkaufsgewinne der "Milka"-Schokolade fliessen zu "Mondelez" nach Chicago, und "Meister Proper" putzt für "Procter & Gamble" in Cincinnati. "Wer wirklich US-Produkte meiden will, müsste Herkunft und Konzernstruktur recherchieren, was im Alltag kaum jemand macht", fasst Hendrik Blijdenstein mit einem Augenzwinkern zusammen.
 |
Trotz linkem Geschrei: Deutsche und Eurpäer lieben US-Produkte.
Grafik: Galaxus |
Ein weiterer Grund für die ausbleibende Konsumverweigerung ist die emotionale Bindung: Marken wie "Apple", "Nike" oder "Weber"-Grills sind für viele Teil des persönlichen Lifestyles – und damit stärker als politische Haltungen. "Apple-Fans werden nicht plötzlich auf ein niederländisches Fairphone umsteigen, nur weil Trump Zölle verhängt", sagt der Unternehmensvertreter.
Interessant dabei: Mit 170 Marken folgen die USA vor allem im starken Elektroniksektor gleich hinter Deutschland unter den 1.000 am meisten gekauften Lieblingsmarken auf "Galaxus" und "Digitec". Fazit der Schweizer Firmengruppe: Zollpolitik allein bringt Europas Konsumgewohnheiten nicht ins Wanken.
Grundlage der umfassenden Auswertung war der Hauptsitz des Markeninhabers – unabhängig vom weltweiten Produktionsort. Die beiden Schweizer "Migros"-Töchter "Galaxus" und "Digitec" verkauften im vergangenen Jahr Produkte von knapp 45.000 Marken. In die Analyse sind die 1.000 meistverkauften Brands und damit relevantesten Verbraucherprodukte des vergangenen Jahres eingeflossen.
Nach der erneuten Übernahme der US-Regierung durch den amerikanischen Unternehmer Donald J. Trump und eine konservative Regierung unter der republikanischen Partei am 20. Januar 2025 haben vor allem linke Parteien und linksradikale "Aktivisten" im Rahmen ihrer amerikafeindlichen Grundhaltung zu Boykotts gegen US-Produkte und -Unternehmen aufgerufen.
Mit der Bekanntgabe umfangreicher Zölle gegen viele Länder - u. a. auch gegen Deutschland - durch den US-Präsidenten am 2 April d. J. wurden die politisch links-radikalen Forderungen nach einem Boykott von US-Produkten noch einmal lauter. Damit versuchten linke Vertreter von SPD, Grünen, Linkspartei ihren Antiamerikanismus weiter zu verbreiten hoffähig zu machen.
Die Details aus der europaweiten Umfrage des Online-Marktplatz-Anbieters "Galaxus" und der Schwester "Digitec" können hier nachgelesen werden. -
Denkfabrik Bürgerbahn kritisiert Trassensanierung zwischen Hamburg und Berlin als unnötig und überteuert.
 |
Die Streckensanierung Hamburg-Berlin gerät in die Kritik.
(Foto: Deutsche Bahn-Volker Emersleben) |
Hamburg, 23.06.2025: Die Denkfabrik "Bürgerbahn" aus Kasseedorf in Schleswig-Holstein kritisiert die geplante Sanierung der 278 km langen Bahnverbindung zwischen Berlin und Hamburg als unausgegoren, unvollständig und zum Teil unsinnig. Das Berliner Fachmagazin "Lok-Report" schreibt, dass die Totalsperrung der Strecke zwischen 1. August 2025 und 30. April 2026 überflüssig sei und die damit verbundenen Behinderungen vor allem für den Regionalverkehr unnötig seien. Nach Ansicht der kritisierenden Denkfabrik könnten notwendige Modernisierungsarbeiter bei laufendem Betrieb unter "rollendem Rad" erledigt werden.
Die Bahn-Experten kritisieren im Digitalbereich, dass die Deutsche Bahn-Infrastruktur-Gesellschaft "DB InfraGo" den Einbau des neuen europaweit einheitlichen, digitalen Signalsystems (ETCS) aus Geldmangel und wegen mangelnder Zuverlässigkeit und begrenztem Nutzen einfach gestrichen hat (HANSEVALLEY berichtete). Die konventionellen Zugsicherungssysteme PZB (punktförmige Zugbeeinflussung) und LZB (linienförmige Zugbeeinflussung) bleiben weiter in Betrieb.
Eine Ausrüstung mit "ETCS" soll laut DB AG in den frühen 2030er-Jahren erfolgen. Zu diesem Zeitpunkt soll die Umstellung der auf der Strecke verkehrenden Flotten vollständig auf die dann ausschließlich ETCS-fähigen Fahrzeuge erfolgen.Da dies vorläufig nicht entlang der Strecke eingebaut werden wird, entfällt ein entscheidender Grund, die Strecke vollständig zu sperren, so die "Bürgerbahn".
Auch die Ausstattung der Strecke mit neuen Sendemasten für das "Future Railway Mobile Communication System (FRMCS)“ erfordert laut Bahn-Kenner ebenfalls keine Streckensperrungen. Die Masten werden außerhalb der Gleisbereiche gesetzt. Dies gilt auch für die Ausstattung der selben Masten für die 5G-Ausleuchtung der vier Mobilfunk-Netzbetreiber im Rahmen des vom Bund geförderten Zukunftsprojekts auf der "Silicon-Line".
Von Hamburg Hbf. nach Berlin Hbf. verkehren an einem normalen Werktag laut Bahn-Experten gerade einmal 33 Fernverkehrszüge pro Richtung, also 66 Züge am Tag. Das sind lediglich 60% der von der DB angegebenen Zahl. Genauso weit hergeholt ist für die Bahn-Insider die angegebene Belastung mit Regionalzügen, die ja teilweise nicht die gesamte Strecke, sondern nur Teilstrecken befahren, schreibt der "Lok Report". Nimmt man an, dass die angegebene Zahl der Güterzüge stimmt (sie schwankt saisonal stark), ergeben sich mit rund 250 Zügen/Tag, also 125 Zügen pro Richtung und Tag.
Am 1. August d. J, beginnen die umfassenden Sanierungsarbeiten auf einer der meist befahrenen ICE-, Güter- und Regional-Strecken Deutschlands - allerdings nur auf rd. 180 km Länge mit rd. 200 Weichen. Die Arbeiten sollen am 30. April 2026 abgeschlossen sein. Die Kosten werden aktuell auf 2,2 Mrd. € geschätzt, "die Bürgerbahn" befürchtet bereits eine Kostenexplosion auf 2,5 Mrd. €. Fernzüge fahren während der Bauarbeiten vom 1. August 2025 bis 30. April 2026 wie bei vorherigen Baumaßnahmen über Uelzen und Stendal.
Die Fahrtzeit zwischen Hamburg und Berlin verlängert sich um 45 Minuten. Zwischen Hamburg und Rostock/Stralsund werden einzelne Fernverkehrszüge über Lübeck umgeleitet.
Zudem werden die Kapazitäten der Regionalzüge zwischen Hamburg, Lübeck und Bad Kleinen deutlich erhöht. Die ausführliche Meldung mit weiteren Details ist bei den
Kollegen des "Lok-Report" nachzulesen. Eine ausführliche Meldung zum Wegfall des digitalen Signalbetriebes gibt es auf der
Presseseite der Deutschen Bahn. Informationen zur Streckensanierung sind auf einer
speziellen Projektseite zu finden.
-
"Absolut arroganter" Otto-Versand wird weiter zusammengestrichen.
 |
Bei "Otto" wird mit McKinsey kräftig durchgefegt und auf Gewinn getrimmt.
Foto: HANSENVALLEY |
Hamburg, 20.06.2025: Die schmerzhaften Einschnitte durch Kosteneinsparungen werden beim Hamburger "Otto-Versand" noch größer als bisher geplant. Aus einem internen Schreiben an die noch 5.300 Mitarbeiter zitiert das "Hamburger Abendblatt": Danach werden in den kommenden drei Jahren bis Ende des Geschäftsjahres 2027/2028 nicht mehr nur 80 Mio. € gestrichen, sondern sogar 110 Mio. € jährlicher Kosten.
Aufgrund der durchwachsenen und teilweise kritischen Zahlen soll der Konzern im Rahmen seiner Strategie bis 2030 noch mehr auf Gewinn getrimmt werden. Dazu hat die Unternehmensberatung "McKinsey" den Sparkurs mit dem hochtrabenden Titel "Elevate" entwickelt. So soll auch das Personal auf "Performance" getrimmt werden. Den Vorgeschmack konnten die gut 5.000 Mitarbeiter auf dem Campus in Hamburg-Bramfeld bereits im November '24 kosten:
Mit einer reduzierten Home-Office-Zeit vom max. 50 % pro Woche kassierte "Otto.de" einen stadtweit diskutierten Shitstorm im firmeneigenen Intranet. Unter Performance fällt offensichtlich auch die Androhung, bis zu 500 Mitarbeiter bzw. 10 % der Belegschaft in der Hamburger Zentrale auf die Straße zu setzen - auch wenn die neue Konzern-Chefin in der Bilanzpressekonferenz mit eisernem Lächeln versuchte, von einer gemeinsamen Leistungssteigerung im Einvernehmen mit den Mitarbeitern zu erzählen.
Die politisch-feingeschliffene Argumentation des aktuellen Vorstands zum neuen 110 Mio. €-Sparkurs laut: Kostensteigerungen, die durch Einsparungen ausgeglichen werden müssen. Dazu gehören offenbar vergessene Gehaltserhöhungen, Sachkosten und eingekaufte Dienstleistungen von Drittanbietern. Ob die jetzt erwarteten Steigerungen zuvor schlicht vergessen wurden oder nur als Vorwand dienen, ist nicht bekannt.
Der "Otto"-Konzern konnte nach den vergangenen zwei Jahren mit Millionen-Verlusten den weiteren Absturz abbremsen und seinen Umsatz im Geschäftsjahr 2024/2025 mit Stichtag 28.02.25 in den drei Bereichen Handel ("Otto.de" & Co.), Logistik ("Hermes") und Finanzdienstleistungen (v. a. "EOS"-Inkasso) bei 14,9 Mrd. € (-0,1 Mrd. €) weitgehend stabil halten. Zudem konnte die Verschuldung von 2,6 Mrd. € auf 2,0 Mrd. € reduziert werden.
Ein Hauptgrund für den weiteren Druck auf den "Otto-Versand" und seine Töchter, wie z. B. "Bonprix", sind u. a. die dramatisch steigenden Umsätze der chinesischen Marktplätze, wie "Aliexpress", "Shein" und "Temu". Sie drücken durch Fast Fashion mit Low Cost-Preisen vor allem auf die Bekleidungsumsätze, aber auch auf die Bereiche Wohnaccessoires und Computerzubehör.
-
Vertrauliches Justizpostfach für Datendiebe offen wie ein Scheunentor.
 |
Gut gemeint und doch schlecht gemacht. Das Justizportal.
Screenshot: HANSEVALLEY |
Stuttgart, 17.06.2025: Das vom Justizministerium von Baden-Württemberg entwickelte und seit Herbst 2023 veröffentlichte Online-Angebot "Mein Justizportal" hat massive Probleme. Das melden die Hannoveraner Kollegen des IT-Portals "Heise Online". Grund: Mit dem Datenschutz des öffentlichen Portals für Bürger ist es offenbar nicht weit her.
So können u. a. Namen und Adressen von Stalking-Opfern, Zeugen oder Journalisten von unberechtigen Personen, wie gegenerische Anwälte. Sie können als Nutzer eines elektronischen Gerichtspostfaches auch auf das Justizportal zugreifen. Dies betrifft zudem rd. 1 Mio. Mitarbeiter in der Justiz von Bund, Ländern und Kommunen.
Bereits betroffene Nutzer von aus dem "SAFE"-Justizverzeichnis abgesaugten Personenstandsdaten wurden erst im Nachhinein über "BundID" über ein Datenleck informiert, über das die Namen und Adressen abgerufen werden konnten. Dabei war eine falsche Software-Einstellung Grund dafür, dass die Daten ohne Schwierigkeiten abgezogen werden konnten.
Der Knackpunkt: Im Gegensatz zu den Meldeämtern gibt es für das Justizpostfach keine generelle Meldesperre, also die Möglichkeit, die Weitergabe seiner Daten prinzipiell zu untersagen. Das Justizministerium in Stuttgart bekräftigte die Art und Weise des Umgangs mit personenbezogenen Daten und verwies auf die Verschwiegenheitspflicht von Justizmitarbeitern und Anwälten.
Künftig soll das Justizpostfach für alle auch eine Möglichkeit erhalten, ohne Adressdaten auszukommen. Zudem will das Justizministerium prüfen, ob auf bestimmte Angaben bei der Anmeldung generell im Interesse eines höheren Datenschutzes verzichtet werden kann.
Aber auch bei der Verschlüsselung hapert es weiter: Hat jemand Unberechtigtes Zugang zum Postfach, kann er sich alle Briefe und angehängten Dokument ohne Probleme ansehen. Eine Verschlüsselung gibt es nur für den eigentlichen Versand von Anträgen und anderen Schreiben an Gerichte.
Mit "Mein Justizpostfach" kann jedermann zivilrechtliche Verfahren einleiten, z. B. im Bereich der Fluggastrechte. Künftig sollen Bürger über das Portal kleinere Forderungen gegen Dritte über das Portal direkt online einklagen, ohne einen Anwalt beauftragen zu müssen oder eine Klage in der zuständigen Gerichtspressestelle aufgeben zu müssen.
-
Fahrkarten-Automaten in Hamburger Bussen gehen nicht: 1.300 Störungen bei 4.000 Automaten.
 |
Fahrer der HVV-Busse können keine Tickets mehr verkaufen.
Foto: Hochbahn |
Hamburg, 16.05.2025: Der Hamburger Verkehrsverbund - HVV - bekommt die bargeldlose Bezahlung von Fahrkarten in den Bussen von "Hochbahn" und "VHH" nicht in den Griff: Nachdem es Riesen-Krach um die Umstellung von Bargeld auf Prepaid-Zahlkarten für die Busse gab, zeigt sich jetzt das ganze Ausmaß eines offensichtlich unprofessionellen Wechsels auf Karten.
Laut "Hamburger Abendblatt" gibt es an den insgesamt rd. 2.500 Bushaltestelle im Hamburger Stadtgebiet gerade einmal 52 Fahrkarten-Automaten. Fahrgäste an anderen Haltestellen sind auf das bargeldlose Bezahlen im Bus angewiesen - und das zickt kräftig rum. So werden selbst die hauseigenen Prepaid-Karten nicht problemlos akzeptiert.
Im vergangenen Jahr gab es an den insgesamt rd. 4.000 Zahlungsterminals insgesamt fast 1.300 Störungen, fragte der CDU-Abgeordnete und verkehrspolitische Sprecher seiner Partei in der Hamburgischen Bürgerschaft - Philipp Heißner - beim Senat ab:
„Fast 1300 Störungen im letzten Jahr bei gerade mal 4000 Geräten zeugen von massiven Problemen mit der Prepaid-Karte im Bus-Alltag“. Für Heißner keine Entschuldigung, da sich besonders ältere Leute und Touristen mit dem unausgegorenen System herumschlagen müssen.
Der Verkehrsbehörde des Grünen Anje Tjarks spielt die Vorfälle herunter. Es gebe in jedem Bus bis zu drei Terminals, die genutzt werden können. Und HVV-Chefin verweist unglaubwürdig auf das weit verbreitete Deutschlandticket und die HVV-Apps, die laut Medienberichten ohnehin auf der Streichliste stehen.
Eines der Hauptprobleme beim vermurcksten Hamburger System: Kunden können in Hamburger Bussen nur mit der Prepaid-Karte zahlen und nicht einfach mit einer Kredit- und Debitkarte. Das hatte der HVV zwar versprochen, doch bis heute nicht eingelöst. Dazu müssen sich die Kunden zunächst eine Aufladekarte besorgen, die es in nur in Supermärkten, Drogeriemärkten und an Tankstellen gibt. Diese war in den ersten Wochen der Umstellung hoffnungslos ausverkauft.
Die Berliner Verkehrs-Betriebe akzeptieren seit ihrer Umstellung auf bargeldloses Zahlen in den Bussen ganz selbstverständlich Kredit- und Debitkarten einschl. Apple- und Google-Pay. Zudem hat die BVG vor Kurzem ihren Zahlungsdienstleister gewechselt und von der VW-Tochter "Logpay Financial Services" auf die "Paypal"-Tochter "Riverty" umgestellt.
-
Dieselbusse der Hochbahn fahren ab kommendem Jahr mit Frittenfett - als Sicherheit vor einem Stromausfall, wenn der Russe einmarschiert.
 |
Die E-Busse der Hochbahn - gegen den Russen keine Chance.
Foto: HOCHBAHN |
Hamburg, 16.05.2025: Der größte Hamburger Bus-Betreiber - die "Hamburger Hochbahn" - hat ein massives Problem mit ihren E-Bussen. Genauer gesagt mit dem Ausbau der geplanten E-Bus-Flotte. Aktuell fahren rund um Alster und Elbe 377 der insgesamt 1.100 Busse im Batteriebetrieb. Laut Senatsbeschluss sollten bis Ende 2029 alle Busse emissionsfrei auf Hamburgs Straßen unterwegs sein.
Das Problem: Zum Jahresende läuft die Bundesförderung von 150.000,- € Zuschuss je gekauftem E-Bus aus. Bis heute gibt es keine Anschlussförderung. Damit droht die "Hochbahn", an dem politisch vorgegebenes Ziel eines emissionsfreien Bussbetriebs zu scheitern, da sie sich den 2,5- bis 3,0-fachen Preis je E-Bus nicht leisten kann oder will. Nun hat sich die städtische Gesellschaft einen "Plan B" ausgedacht.
Danach sollen nach Lieferung weiterer 48 neuer E-Busse die verbleibenden 675 Stadtbusse ab kommendem Jahr mit Frittenfett fahren und darauf umgerüstet werden. Die "Hochbahn" versucht jetzt, soviel hydriertes Pflanzenöl aus der Industrie aufzukaufen, wie möglich. So sollen die Diesel-Busse einschl. der 93 Großraum-Fahrzeuge mit 21 Meter Länge über 2-3 Jahre über die Deadline 2029 hinaus auf Hamburgs Straßen umweltfreundlicher rollen.
Um das Versagen bei der Anschaffung neuer E-Busse zu übertüchnen, fabulierte "Hochbahn"-Finanzvorständin Merle Schmidt-Brunn bei der Bilanzpressekonferenz vergangenen Donnerstag (12.05.2025) etwas von Einsatzfähigkeit der Busse auch im Verteidigungsfall. Der schräge Versuch einer Entschuldigung wurde durch die Vorständin damit bekräftigt, dass in einem kriegerischen Konflikt ja schnell kein Strom mehr für Elektro-Busse bereitstehen würde:
"Wir müssen uns überlegen, ob wir als Staat aufgrund der Kriegsereignisse in Europa eine strategische Busreserve brauchen, die nicht auf Elektro läuft." Schmidt-Brunn weiter: "Wenn Sie sich vorstellen, dass wir in Hamburg einen Stromausfall von 24 bis 48 Stunden haben, dann sind unsere E-Busse nicht mehr einsatzfähig."
Zugleich lobte sich die "Hochbahn" für ihren bisherigen subventionierten Bus-Einkauf selbst. Im Vergleich liegten die Hamburger mit 377 bzw. 30 % der Flotte bundesweit vorn, in Berlin gebe es nur 227 E-Busse, in Köln 130 batteriebetriebene Fahrzeuge und in München 90 E-Busse. Erst Ende vergangenen Jahres hatte die "Hochbahn" mit dem Busbauer "Mercedes" einen Auftrag über 350 E-Busse geschlossen. Da hatte die "Hochbahn" selbst nur 280 subventionierte Batterie-Busse in den Depots.
Bisher ist nicht überliefert, ob andere deutsche Verkehrsbetriebe, wie die Berliner BVG, die Kölner KVB oder die Münchener MVG ebenfalls auf Frittenfett umstellen wollen, damit ihre Flotten bei einem Einmarsch der Russen auch weiterhin fahren können. Einen ausführlichen Beitrag zum Thema gibt es u. a. bei den Kollegen von "NDR Hamburg". -
Niedersächsische Abgeordnete entlarvt kinderschädliche Indoktrination eines Trans-Selbsttests.
 |
Die Helmstedter Familienpolitikerin findet klare Worte.
(Grafik: Vanessa Behrendt, AfD Niedersachsen) |
Hannover, 13.06.2025: Das Berliner Jugend- und Familienministerium finanziert aus dem links-woken Förderprogramm "Demokratie leben" einen sogenannten Selbsttest zu möglicher Transsexualität unter Kindern und Jugendlichen. Interessenten können auf 13 Seiten ihre sexuellen Präferenzen erkunden und bekommen auf jeder Seite sofort Rückmeldung zu ihren Antworten.
Das Portal "Report24" schreibt dazu: "Die Fragen behandeln alles von der persönlichen Klamottenauswahl, Interesse an Namensänderungen, Erfahrungen mit dem Ausdruck eines anderen Geschlechts (zum Beispiel vor dem Spiegel oder in “Drag-Workshops”) oder dem eigenen Umfeld, wobei letzteres auch genutzt wird, um eigene Beratungs- und Communityangebote zu platzieren. Wie die wirken, zeigen die Berichte von Betroffenen – dazu später mehr." Die bürglich-konservative Familien- und Jugendpolitikerin sieht in den Aktivitäten eine weitere schädliche und indoktrinierende Aktivität aus dem links-queeren Aktivistenumfeld.Die Helmstedter Landtagsabgeordnete stellt fest: "Der teilweise steuerfinanzierte Bundesverband "Trans* e.V." will Kinder und Jugendliche mit einem kruden Selbsttest zum Nachzudenken über ihr Geschlecht anregen."
Die AfD-Politikerin erklärte auf dem Netzwerk X weiter: "Die Transideologie wird dabei als aufregend und erstrebenswert verkauft." Von arglosen Kindern will man u. a. wissen:
- „Hast du dich schon mal als ein 'anderes' Geschlecht verkleidet?“
- „Denkst du für dich über körperliche Veränderungen wie Hormonbehandlungen oder OPs nach?“
Das zeigt aus Sicht der niedersächsischen AfD-Abgeordneten, wohin die Reise geht! Die Gegnerin einer links-woken Transpolitik in Niedersachsen und darüber hinaus.
"Wer sich den „Trans-o-mat“ anschaut, wird feststellen: Primitivere Indoktrination war selten! Durch tendenziöse Fragen sollen Kinder für pseudowissenschaftliche Dogmen der „Trans*geschlechtlichkeit“ aufgewärmt werden. Das darf nicht unwidersprochen bleiben! Es ist inakzeptabel, dass so etwas mit Steuergeld finanziert wird."
-
Ex-Bahnchef Grube hält Idee eines Hyperloops zwischen Hamburg und Kiel für totalen Quatsch.
 |
Träume sind Schäume. auch wenn der Hamburger Senat mal wieder ein Luftschloss aufpustet.
(Grafik: ChatGPT/Image Editor, Railfreak.de) |
Hamburg, 12.05.2025: Das vom rot-grünen Senat der Hansestadt anlässlich der aktuellen Olympiabewerbung unterstützte Projekt für eine "Hyperloop"-Hochgeschwindigkeitstrasse über die A24 von Hamburg nach Kiel sorgt für offene Kritik. Der Aufsichtsratsvorsitzende des teilstaatlichen Hamburger Containerterminal-Betreibers "HHLA" - Rüdiger Grube - hält die Idee eines "Hyperloops" nach Kiel für unsinnig.
Der gelernte Fahrzeugbauer und Flugzeugtechniker sagte pointiert im Hamburger Podcast "Wie ist die Lage?" des PR-Beraters Lars Meier: "Das halte ich für totalen Quatsch!". Damit wisch der frühere Vorstandsvorsitzends der Deutschen Bahn den Plan vom Tisch, zu möglichen Olympischen Sommerspielen die dann wichtigsten Austragungsorte Hamburg und Kiel mit einer Stahlröhre für Züge in Schallgeschwindigkeit zu verbinden.
Mit einem Letter of Intent (LOI) wurde der Firma "DRO" bereits im Februar 2025 vom Hamburger Senat zugesagt, sie bei der Analyse und Simulation der Einbindung eines Hyperloops in die städtische Verkehrsinfrastruktur, bei den erforderlichen Genehmigungs- und Zulassungsverfahren sowie der anschließenden Projektrealisierung bestmöglich zu unterstützen.
Um nicht in die Schusslinie zu geraten, wurden keine Angaben zur finanziellen Beteiligung Hamburgs veröffentlicht. Der rot-grüne Senat hatte zuvor in nur drei Monaten ohne tiefergehende Prüfung beschlossen, eine "Hyperloop"-Teststrecke zwischen dem östlichen Hamburger Stadtteil Jenfeld und dem Horner Kreisel entlang der Autobahn A24 politisch und organisatorisch zu unterstützen.
-
Neuer Ministerpräsident verrennt sich bei Leih-Tablets für Niedersachsens Schüler.
 |
Kaum ist er Ministerpräsident, schon stolpert SPD-Mann Olaf Lies.
(Foto: Chris31181, Lizenz: CA SA 4.0 int.) |
Hannover, 10.06.2025: In Niedersachsen haben bis heute weite Teile der Schüler kein Tablet für digitalen Unterricht. Die SPD-Staatskanzlei kündigte kürzlich und voreilig an, die gesamte Schülerschaft ab dem Schuljahr 2026/2027 mit Leih-Tablets auszustatten. Dies ist ein Wahlversprechen aus dem Jahr 2022. Doch das Grüne Kultusministerium sammelte das Versprechen gleich wieder ein.
Der schulpolitische Sprecher der CDU-Fraktion, im niedersächsischen Landtag Christian Fühner, erklärte zu dem rot-grünen Chaos: „Nach zwei Tagen Debatte über Schultablets steht der neue Ministerpräsident vor den Trümmern seiner Ankündigungspolitik. Das Kultusministerium sammelt sein erklärtes Startdatum wieder ein und spricht von einem hoch ambitionierten Zeitplan sowie vielen Fragen, die zu klären sein, darunter die Finanzierung der Tablets. Man müsse einen Schritt nach dem anderen machen.
Und die Sprecherin der Staatskanzlei räumt ein, dass man häufig sportlicher als die Ministerien unterwegs sei. Deutlicher kann es nicht werden. Die Landesregierung handelt unabgestimmt und die Ziele des Ministerpräsidenten sind mit seiner Fachministerin nicht abgesprochen, die Landesregierung offenbart, dass sie keinen Plan für die dringend notwendige Digitalisierung unserer Schulen hat. Ministerpräsident Lies muss jetzt zügig für Klarheit sorgen:
Wann sollen die Schülerinnen und Schüler mit Leihtablets ausgestattet werden, wie viele Tablets werden benötigt, was werden es für Tablets sein und wie werden die Tablets administriert? Auf keinen Fall dürfen Informatiklehrer der Schulen zusätzlich belastet werden.“
-
Nur ein landeseigener Mobilfunkmast - CDU fordert Beschleunigung des Mobilfunkausbaus.
 |
In Mecklenburg-Vorpommern immer noch Seltenheit: Mobilfunkmasten
Foto: Vodafone |
Schwerin, 05.06.2025: Telefonate brechen ab, mobiles Internet ist oft Glückssache - das ist die Realität in strukturschwachen und z. T. entvölkerten Landstrichen Deutschlands, z. B. in Mecklenburg-Vorpommern. 2020 einigte sich die damalige rot-schwarze Koalition auf die Gründung einer Infrastruktur-Gesellschaft zum schnelleren Ausbau von Mobilfunkmasten mit staatlicher Unterstützung.
Die erschreckende Bilanz: Fünf Jahre nach dem Beschluss steht erst ein öffentlich-unterstützter Funkmast. Dieser steht in Glambeck bei Rostock. Das zweite Projekt in Cantnitz sollte bereit im April 2025 ans Netz gehen. Das Projekt steckt laut CDU MV aber weiterhin in der Bauphase fest. Die übrigen Projekte befinden sich bestenfalls in der Bauphase, viele nicht einmal in der Genehmigung.
Die CDU in MV fordert die Einführung einer landesrechtlichen Genehmigungsfiktion für Mobilfunkmasten. Heißt: Wenn eine Bauaufsicht nicht innerhalb von drei Monaten entscheidet, gilt der Antrag als genehmigt – so wie es beispielsweise Bayern erfolgreich vormacht. In Mecklenburg-Vorpommern greift eine solche Regelung bislang nur für Masten unter 30 Metern. Das ist laut Nord-Ost-Union zu wenig.
Außerdem fordert die Oppositionspartei eine Vollständigkeitsfiktion. Das heißt: Wenn eine Behörde drei Wochen nach Antragstellung nicht reagiert, gilt der Antrag als vollständig. So beendet man monatelange Verzögerungen durch formale Nachforderungen. Außerdem fordert die CDU eine ehrliche Evaluierung der Mobilfunk-Infrastruktur-Gesellschaft. Entweder die Gesellschaft macht ihre Arbeit, oder sie sollte abgewickelt werden, so die Union.
Anlässlich der am Mittwoch vergangener Woche (28.05.2025) ins Bundeskabinett eingebrachten Gesetzesinitiative zur Einstufung von Mobilfunkmasten als "überragend öffentliches Interesse" erklärte der Vorsitzende der CDU-Fraktion im Schweriner Landtag, Daniel Peters: "Ich begrüße ausdrücklich, dass die neue CDU-geführte Bundesregierung den Mobilfunknetzausbau endlich beschleunigt und ihn rechtlich absichert als das, was er ist: eine zentrale Infrastrukturaufgabe für Lebensqualität, wirtschaftliche Entwicklung und gleichwertige Lebensverhältnisse - gerade in einem Flächenland wie Mecklenburg-Vorpommern."
Die Bereitstellung landeseigener Masten ist günstiger als der Bau eines eigenen Funkmasts. Ein einzelner Funkmast kostet je nach Standort und notwendiger Anbindung knapp 200.000,- €. Ein landeseigener Mast wird nur errichtet, wenn mindestens ein Mobilfunknetzbetreiber verbindlich seine Bereitschaft erklärt, diesen für Mobilfunkdienste zu nutzen.
Die Landesgesellschaft "FMI" darf in unversorgten Gebieten nur einen Funkmast errichten, wenn dort in den kommenden drei Jahren kein eigener Ausbau durch die Mobilfunknetzbetreiber geplant ist. Alle Mobilfunkanbieter erhalten dieselbe Möglichkeit, mit der Infrastrukturgesellschaft einen Kooperations- und Pachtvertrag über die Nutzung eines Standorts abzuschließen.
Insgesamt sollen mit den landeseigenen Masten mehr als 230 weiße Flecken im Nord-Osten geschlossen werden. Die Netzbetreiber haben für 22 Ausbaugebiete mit jeweils mehreren weißen Flecken ihr Interesse bekundet, die Masten aus dem Landesprogramm nutzen zu wollen. Für 24 weitere Ausbaugebiete mit zahlreichen weißen Flecken wollen die Mobilfunker eigene Masten aufstellen.
-
Studie beweist: Mehr als 1 Million Muslime in Deutschland intolerant, aggressiv oder radikal und gewalttätig.
 |
Islamische Menschenverachtung in einer internationalen Grafik.
Auch veröffentlicht als "Die Reichtümer des Islam"
Urheber unbekannt, Netzwerk X
|
Münster/Osnabrück, 04.06.2025: Jeder fünfte in Deutschland lebende Muslim mit Migrationshintergrund weist eine emotionale Verfassung auf, die Intoleranz, Aggressivität und Radikalisierung begünstigt. Das ist das Ergebnis einer bisher unveröffentlichten Studie der Forschungsstelle Islam und Politik der Universität Münster. Die "Neue Osnabrücker Zeitung" (NOZ) stellt fest: Bei 5,3 bis 5,6 Millionen Muslimen in Deutschland wären das mehr als eine Million Menschen, die religös bedingt auffällig sind - und zu einer Gefahr werden.
Betroffen sind Muslime, die sich besonders in ihrer persönlichen, islamisch geprägten Weltanschauung gekränkt sehen, starke antiwestliche oder antisemitische Feindbilder pflegen und zugleich eine geringe Kritikfähigkeit zeigen. Die Münsteraner Forscher fassen die Kombination von Einstellungen unter "Ressentiments" zusammen. Bei einer Umfrage im Zeitraum Juli 2023 bis April 2024 unter Muslimen mit Migrationshintergrund ließen sich 19,9 % der 1.887 repräsentativ Befragten dieser Gemütslage zuordnen.
Eine Mehrheit dieser "Ressentiment"-Gruppe bejaht Fragen wie die, ob der Islam "die einzige und letztgültige politische Autorität" sein sollte oder ob die islamischen Gesetze der Scharia "viel besser als die deutschen Gesetze" sind. Gewalt auf vermeintlich erlittenes Unrecht befürwortet jeder Dritte der religiös aggressiven Migranten, das entspricht mehr als 300.000 Männer und Frauen. Jeder Zehnte der auffäligen Ausländer würde auch selbst Gewalt einsetzen, um sich "für die Interessen von Muslimen" einzusetzen. Das sind rd. 100.000 potenzielle Gewalttäter.
"Mit der Affektlage des Ressentiments konnten wir einen neuen und sogar starken Radikalisierungsfaktor aufdecken", sagte die Münsteraner Religionspsychologin Sarah Demmrich im Gespräch mit der "NOZ". HANSEVALLEY hat nach dem Autoanschlag von Magdeburg zahlreiche Zahlen, Daten und Fakten zu Migranten, Gewalt, Kosten und Folgen sowie politische und polizeiliche Statements aufbereitet: "Magdeburg ist überall" mit laufenden Aktualisierungen können Sie hier nachlesen. -
Senat beerdigt die 10.000 Zubringer-Busse - für 26 Mio. € Steuergelder vom Bund nur ein paar hundert autonome Shuttle.
 |
Mit Viel Tam-Tam kündigten Politik und Profiteure das Projekt Alike an.
Foto: Hochbahn |
Hamburg, 03.06.2025: Ein weiteres vermeintliches Leuchtturmprojekt des rot-grünen Hamburger Senats entwickelt sich zum Rohrkrepierer: Die von SPD-Bürgermeister Peter Tschentscher und vom Grünen Verkehrssenator Anjes Tjarks großspurig angekündigten bis zu 10.000 autonomen Shuttles bis 2030 entpuppen sich als politische Fata Morgana.
Der Hamburger Wochenzeitung "Zeit" sagte der Grüne Senator: „Ich würde mich ein bisschen von der Zahl 10.000 lösen“, so Tjarks gegenüber der Hamburg-Ausgabe der Wochenzeitung. „Aber ich bin fest davon überzeugt, dass es 2030 mehrere Hundert sein werden.“ Die kommen von "VW" aus Hannover und vom Automobil-Ausrüster "Holon".
Für das Projekt "Alike" zur Entwicklung eines autonomen Shuttle-Verkehrs mit bis zu 10.000 Fahrzeugen von "Holon" und "Moia" unter dem Dach der "Hochbahn" bis zum Jahr 2030 bekommen die Partner in der Testphase gut 26 Mio. € allein aus Steuermitteln des Bundesverkehrsministeriums in Berlin (HANSEVALLEY berichtete).
Ab Mitte dieses Jahres sollen in der Hamburger Innenstadt vom Stadtpark bis zur Elbe und vom Schlump bis nach Wandsbek die ersten autonomen Testfahrten mit Kunden und Sicherheitsfahrer stattfinden. Dabei sollen Interessenten die Fahrten über die "HVV Switch"- und die "Moia"-App buchen. Wie bei fast allen Mobilitätsprojekten schließt auch "Moia" erneut den Hamburger Süden aus.
Hamburgs rot-grüner Senat will den Anteil des umweltfreundlichen Verkehrs (ÖPNV, Rad- und Fußverkehr, Sharing-Dienste wie Miles und On-Demand-Dienste wie Moia) von aktuell 68 Prozent auf 80 Prozent steigern, zitiert die "Zeit". Solche Prozesse bräuchten jedoch Zeit, so Tjarks zur Wochenzeitung, „ich denke an einen Zehn-Jahres-Zeitraum“.
-
Hamburger Staatsanwaltschaft ohne digitale Strafakte bei 48.000 unbearbeiteten Fällen.
 |
In der Hamburger Staatsanwaltschaft stapeln sich tausende unbearbeitete Akten.
(Foto: André Otto) |
Hamburg, 03.2025: Die Zahl der unerledigten Ermittlungsverfahren bei der Hamburger Staatsanwaltschaft hat sich innerhalb von zwei Jahren mehr als verdoppelt – von rund 23.000 auf knapp 48.000 Fälle. Trotz wiederholter Stellenoffensiven bleiben viele Planstellen unbesetzt. Das geht aus der Senatsantwort auf eine Große Anfrage der AfD-Fraktion hervor (
Drs. 23/214).
Derzeit sind über 45 Stellen bei der Staatsanwaltschaft vakant – darunter 17 für Staatsanwälte und fast ein Dutzend in den Geschäftsstellen. Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Ermittlungsverfahren hat sich deutlich erhöht – von 1,5 Monaten im Jahr 2023 auf 2,9 Monate im ersten Quartal 2025.
Besonders alarmierend: In Deliktsbereichen wie Kinderpornografie, Ausländerkriminalität und Eigentumsdelikten sind die Fallzahlen unerledigter Verfahren teilweise um über 200 Prozent gestiegen. Zwar lobt der Senat eigene Digitalisierungsprojekte, etwa zur Einführung der elektronischen Strafakte – doch deren vollständige Umsetzung ist erst für Januar 2026 geplant. Damit ist Hamburg deutlich später dran als andere Bundesländer.
Die AfD-Fraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft fordert u. a. die Einrichtung einer „Zentralen Vorprüfstelle für Strafsachen (ZVS) zur Entlastung der Staatsanwaltschaft“; außerdem mehr Tempo bei der Einführung der elektronischen Strafakte und eine Task Force zur Beseitigung der Personalvakanzen. Dazu sollen auch Amtsanwälte und Rechtsreferendare stärker eingebunden werden.
Der AfD-Fraktionschef und justizpolitische Sprecher Dirk Nockemann: „Diese Entwicklung ist dramatisch. Sie gefährdet das Vertrauen in einen funktionierenden Rechtsstaat – und das mitten in einer Zeit wachsender Kriminalität. Der Senat verwaltet das Problem, statt es zu lösen. Es braucht strukturelle Reformen, eine echte Entlastung durch konsequente Digitalisierung und neue Formen der Arbeitsteilung innerhalb der Justizbehörden. Der Rechtsstaat ist am Limit ..."
-
Niederträchtig agierende Göttinger Staatsanwälte verfolgen erneut Helmstedter Landtagsabgeordnete.
 |
Die niederträchtig agierenden Staatsanwälte haben wieder zugeschlagen.
(Grafik: AfD Niedersachen) |
Hannover, 02.06.2025: Die Helmstedter Landtagsabgeordnete Vanessa Behrendt wird erneut von der politischen Staatsanwaltschaft aus Göttingen vor Gericht gezerrt. Die in der US-Reportage "60 Minutes" hämisch auftretenden Möchtegern-Richter werfen der wiederholt angeklagten AfD-Familienpolitikerin diesesmal "Volksverhetzung" vor.
Vanessa Behrendt erklärte auf dem unabhängigen Netzwerk X: "Die neueste Anzeige dreht sich um das Pädo-Portal „Wir sind auch Menschen“. Man wirft mir Volksverhetzung vor – weil ich Pädophile in Tweets als „Kinderschänder“ bezeichnet und die von Pädophilen ins Gespräch gebrachte Legalisierung von „Kinder-Sexpuppen“ kritisiert habe!"
Das ist aus Sicht der Medizinischen Fachangestellten und Ernähungsberatin umso brisanter, als eine Anzeige gegen die Pädo-Plattform abgewiesen wurde. Offensichtlich messen die von der rot-grünen Landesregierung in Hannover installierten und gestützten politischen Verfolgungsbehörde mit zweierlei Maß bei der Auswahl der von ihnen behandelten Fälle.
Die kritische Abgeordnete deckt immer wieder die Verstrickungen von Kinderschändern, Online-Netzwerken und poltischen Verstrickungen mit linken Parteien auf. Außerdem kämpft sich gegen die ideologische "Queer"-Politik mit Verbindungen in die Kinderschänder-Szene.
Die "Internet-Petz-Behörde" ZHIN, die in Niedersachsen für die Verfolgung von echter und vermeintlicher Hasskriminalität im Netz ernannt wurde, verzeichnete seit dem Beginn ihrer Arbeit am 1. Juli 2020 u. a. aufgrund Ihres Online-Petz-Portals einen stetigen Anstieg der Verfahren.
Die von US-Vizepräsident J. D. Vance als "Orwell" und "Irrsinn" öffentlich scharf kritisierte Situation in Deutschland mit den politisch agierenden Staatsanwälten aus Göttingen kann in der 13 Minuten langen Reportage online
auf den Seiten von "CBS News" ohne Bezahlschranke abgerufen werden.
-
GEW wünscht sich Radikalenerlass gegen konservative Lehrer.
 |
Symbolbild: Lehrer beim Unterricht
(Foto: Fauxels, Pexels) |
Hannover, 28.05.2025: Die linke Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft will gegen sogenannte „demokratiefeindliche Lehrkräfte“ an den Schulen vorgehen. Vorgesehen sind laut GEW-Forderung systematische Beschwerdeverfahren, Meldeportale, Interventionskonzepte zur Verfolgung unliebsamer Lehrkräfte und unabhängige Beschwerdestellen. Was unter „demokratiefeindlich“ zu verstehen ist, bleibt unklar.
Kritiker vermuten, dass damit vor allem Lehrkräfte mit konservativer oder regierungskritischer Haltung ins Visier genommen werden sollen, um eine links-ideologische Politik im Bildungswesen konkurrenzlos betreiben zu können. Harm Rykena, bildungspolitischer Sprecher der AfD-Fraktion im Niedersächsischen Landtag, spießt die linken Ideen der GEW auf:
„Die GEW ist längst keine Interessenvertretung der Lehrer mehr, sondern eine Vorfeldorganisation der rot-grünen Regierung. Statt sich um die wirklichen Probleme an unseren Schulen zu kümmern – wie Niveauverfall, Gewalt oder überlastete Lehrkräfte – ruft sie nun zur Hexenjagd auf politisch unliebsame Lehrer auf. Noch vor zwei Jahren wurde unser Portal Neutrale Lehrer, das lediglich zur parteipolitischen Neutralität aufrief, von der GEW als Einschüchterungsversuch diffamiert.
Jetzt fordert dieselbe Organisation Meldestellen und Maßnahmen gegen sogenannte ‘demokratiefeindliche’ Lehrer – ohne auch nur ansatzweise zu definieren, was damit gemeint ist. Der Verdacht liegt nahe, dass allein die Mitgliedschaft in der AfD ausreichen soll, um in den Fokus zu geraten. Besonders perfide ist, dass die GEW durch systematische Beschwerde- und Meldeverfahren, Präventions- und Interventionskonzepte mit definierten Handlungsketten, unabhängige Beratungs- und Beschwerdestellen sowie einen stärkeren Diskriminierungsschutz letztlich nichts anderes betreibt als – Diskriminierung."
Was hier als Schutzmaßnahme verkauft würde, sei in Wahrheit ein Instrument zur politischen Ausgrenzung, so der AfD-Experte. Das Ergebnis solcher Denunziationsstrukturen sei klar: Lehrer flüchteten sich in die innere Emigration, um nicht politisch anzuecken. Eine Atmosphäre des Misstrauens ersetzw den offenen Diskurs. Das schade nicht nur dem Zusammenhalt an unseren Schulen, sondern auch der Demokratie selbst. Tatsächliche Probleme blieben unter dem Deckmantel politischer Korrektheit unangesprochen.
-
China-Plattformen fordern erste Opfer: Otto-Modediscounter Bonprix stürzt weiter ab.
 |
Der Hamburger Otto-Konzern ist weiter in Schieflage.
(Foto: HANSEVALLEY) |
Hamburg, 22.05.2025: Der zum Hamburger Distanzhändler "Otto" gehörende Mode-Discounter "Bonprix" ist im abgelaufenen Geschäftsjahr 2024/2025 (Stichtag: 28.02.25) um weitere 280 Mio. € bzw. 18,5 % Umsatz abgestürzt. Über die vergangenen zwei Jahre hat der in Deutschland, Europa, Russland, den USA und Brasilien tätige in Hamburg beheimatete Versender von Alltagsmode sogar 520 Mio. € bzw. rd. 30 % seines Geschäfts verloren.
Der Vorstand des verantwortlichen "Otto"-Konzerns begründet den weiteren Einbruch bei "Bonprix" mit "verhaltener Konsumstimmung" in schwachen Märkten Europas, vor allem Deutschland, aber auch im "zunehmenden Wettbewerb". Dahinter steht der Frontalangriff der chinesischen Marktplatz-Riesen "Aliexpress", "Shein" und "Temu".
Ein Vergleich der Kundenzahlen aus dem vergangenen Jahr zeigt den massiven Druck auf den deutschen Bekleidungsversender und seine Märkte: Hatte "Bonprix" europaweit rd. 10 Mio. und in Deutschland rd. 5 Mio. Kunden, ist der größte chinesische Bekleidungskonkurrent "Shein" in Europa mit rd. 126 Mio. aktiven Kunden/Monat und in Deutschland mit 7,7 Mio. Kunden bereits deutlich größer.
Dazu kommen die Allround-Marktplätze "Aliexpress" mit 104 Mio. monatlicher Kunden in Europa und sogar 18,6 Mio. deutscher Kunden sowie "Temu" mit gut 97 Mio. aktiver Kunden pro Monat in Europa und 16,3 Mio. Kunden in Deutschland - jeden Monat. Die drei der vier "kleinen Drachen" kommen somit allein in Europa auf 327,3 Mio. aktive Kunden pro Monat und 52,7 Mio. Kunden in Deutschland. Sie haben im vergangenen EU rd. 4,8 Mrd. Artikel aus China erhalten.
Dabei gilt laut Informationen des Fachportals "Exciting Commerce" Deutschland als "Home Turf" für den gern von Verbraucherschützern an die Wand gestellten, manipulativ und pauschal kritisierten Versender "Temu". Beim zweiten EU-Schwergewicht Frankreich dominiert der chinesische Fast-Fashion-Versender "Shein" und spanische Kunden lieben vor allem den "Alibaba"-Allround-Marktplatz "Aliexpress".
Auch wenn der neue Vorstand des Konzerns nach "About You", "Evri" ("Hermes" UK), "MyToys" und "Sportcheck" aktuell keine Verkäufe oder Firmenschließungen plant, ist die Zukunft von "Bonprix" aufgrund des "Downpricings" der Einkäufe deutscher und europäischer Kunden zugunsten der chinesischen Shopping-Plattformen stark gefährdet. Noch gar nicht berücksichtigt sind die künftigen Einflüsse des erst Ende Februar d. J. gestarteten "Tiktok Shop"-Onlinehandels.
Interessant: Der "Otto"-Konzern profitiert über seine nach wie vor defizitäre Logistik-Sparte "Hermes Germany" vom Boom mit den hellgrauen Plastiktüten von "Aliexpress", "Shein" und Temu". Grund: "Hermes" übernimmt neben "DHL Paket" die Auslieferung der meisten "China-Tüten" innerhalb Deutschlands - ebenso wie Retouren.
Laut Branchenangaben lieferten die chinesischen Marktplatzriesen über ihre Logistik-Töchter und Partner - wie "Caniao" ("Aliexpress") und "YC Logistics" ("Temu") im vergangenen Jahr täglich allein rd. 400.000 Sendungen nach Deutschland. Das sind aufs Jahr hochgerechnet allein rd. 4,8 Mio. Tüten und Pakete, die von "Hermes" und "DHL Paket" zugestellt wurden. Der Konzern bestätigt zurückhaltend "größere Paketmengen" und eine "leicht zunehmende Nachfrage im E-Commerce".
Zwar kritisiert die neue Vorstandsvorsitzende Petra Scharner-Wolf vollmundig die schleppende Regulierung von China-Importen auf EU-Ebene und bekräftigt die Unterstützung der Restriktionen mit härteren Zollbestimmungen für die EU, dem bisherigen Erfolg in der Paketzustellung schadet dies aber noch nicht.
Der "Otto"-Konzern konnte nach den vergangenen zwei Jahren mit Millionen-Verlusten den weiteren Absturz abbremsen und seinen Umsatz in den drei Bereichen Handel ("Otto.de" & Co.), Logistik ("Hermes") und Finanzdienstleistungen (v. a. "EOS"-Inkasso) bei 14,9 Mrd. € (-0,1 Mrd. €) weitgehend stabil halten. Zudem konnte die Verschuldung von 2,6 Mrd. € auf 2,0 Mrd. € reduziert werden.
Unterm Strich wies die Holding für das Jahr 2024/2025 einen Gewinn von 165 Mio. € aus - nach 412 Mio. € Verlust im Vorjahr. In den vergangenen zwei Jahren fuhr "Otto" insgesamt fast 850 Mio. € Miese ein. Die "Cash Cow" ist weiterhin "Otto.de" als Marktplatz mit weitgehend stagnierenden 4,4 Mrd. € eigenem Handelsumsatz einschl. Provisionen der Marktplatz-Händler (23/24: 4,2 Mrd. €). Die Drittanbieter erzielten ihrerseits 2,6 Mrd. € Umsatz (+ 500 Mio. €), von denen "Otto" Provisionen kassiert.
Größter Gewinnbringer ist der unter dem Radar gehaltene Inkasso-Konzern "EOS" mit 1,1 Mrd. € Umsatz durch Gebühren der Schuldner von "Barclays", "Otto", "Telekom" & Co. (+5,8 %). Mit 2.200 rausgeworfenen Mitarbeitern - davon 1.100 in Deutschland - hat der Konzern vor allem über Personalabbau seine Kosten zusammengestrichen. Hier sticht vor allem die Schließung von 8 der 13 Call Center mit rd. 480 Mitarbeitern und Kostenreduzierungen von insgesamt mehr als 100 Mio. € zu Buche.
Aufgrund der durchwachsenen und teilweise kritischen Zahlen soll der Konzern im Rahmen seiner Strategie bis 2030 noch mehr auf Gewinn getrimmt werden. Dazu hat die Unternehmensberatung "McKinsey" einen 80 Mio. €-Sparkurs entwickelt. So soll auch das Personal auf "Performance" getrimmt werden. Den Vorgeschmack konnten die 5.000 Mitarbeiter auf dem Campus in Hamburg-Bramfeld bereits im November '24 kosten:
Mit einer reduzierten Home-Office-Zeit vom max. 50 % pro Woche kassierte "Otto.de" einen stadtweit diskutierten Shitstorm im firmeneigenen Intranet. Unter Performance fällt offensichtlich auch die Androhung, bis zu 500 Mitarbeiter bzw. 10 % der Belegschaft in der Hamburger Zentrale auf die Straße zu setzen - auch wenn die neue Konzern-Chefin in der Bilanzpressekonferenz mit eisernem Lächeln versuchte, von einer gemeinsamen Leistungssteigerung im Einvernehmen mit den Mitarbeitern zu erzählen.
-
Verwaltungsgericht Hannover verdonnert Neue Osnabrücker Zeitung zu korrekter Werbe-Einwilligung.
 |
Die NOZ hat für Ihre Online-Werbepraxis ein Stop-Schild kassiert (Grafik: Alexandros Giannakakis, Unsplash)
|
Hannover, 21.05.2025: Der Landesbeauftragte für den Datenschutz in Niedersachsen setzt sich gegen manipulative Einwilligungsbanner auf Webseiten und für wirksame – insbesondere informierte und freiwillige – Einwilligungen ein. Das Verwaltungsgericht Hannover hat am 19. März 2025 die Position der Datenschutzaufsichtsbehörde Niedersachsen bestätigt und die Rechte von Internetnutzern in Sachen Datenschutz gestärkt:
Webseitenbetreiber müssen bei Cookie-Abfragen eine gut sichtbare „Alles ablehnen“-Schaltfläche auf der ersten Ebene im Einwilligungsbanner anbieten, wenn es eine „Alle akzeptieren“-Option gibt. Einwilligungsbanner dürften nicht gezielt zur Abgabe der Einwilligung hinlenken und von der Ablehnung der Cookies abhalten, so das Verwaltungsgericht Hannover in seiner aktuellen Urteilsbegründung.
ndernfalls seien die derart eingeholten Einwilligungen unwirksam, was einen Verstoß gegen das Telekommunikation-Digitale-Dienste-Datenschutz-Gesetz sowie die Datenschutz-Grundverordnung darstellt.
Hintergrund des Verfahrens war eine Anordnung des Landesbeauftragten für den Datenschutz Niedersachsen gegenüber dem Verlagshaus der Neuen Osnabrücker Zeitung. Dieses hatte Cookie-Einwilligungen mittels eines Banners eingeholt – ohne Nutzerinnen und Nutzern eine echte Wahlmöglichkeit zu bieten, wie dies bei Online-Medien oft manipulativ betrieben wird.
Der Landesbeauftragte für den Datenschutz in Niedersachsen, Denis Lehmkemper: „Die allermeisten Menschen sind vermutlich von Cookie-Bannern genervt. Diese erfüllen jedoch eine wichtige Funktion für die Aufrechterhaltung der Privatsphäre im Internet. Genau deshalb setzen sich die Datenschutz-Aufsichtsbehörden für eine echte Wahlmöglichkeit bei der Gestaltung der Banner ein. Diese Wahlmöglichkeit wird von vielen Webseitenbetreibern bisher jedoch nicht umgesetzt.“
Auf nahezu jeder Webseite werden Nutzer beim Öffnen mit einem Einwilligungsbanner konfrontiert. Viele weisen eine Schaltfläche mit der Bezeichnung „Alle akzeptieren“ auf, die Nutzer häufig anklicken, damit der Banner verschwindet und der Inhalt der Webseite gelesen werden kann.
Mit diesem Klick wird allerdings die Erlaubnis erteilt, dass unter Umständen sehr viele Cookies und andere Trackingtechnologien eingesetzt werden, um detaillierte Nutzerprofile zu generieren und in Echtzeit personalisierte Werbung auf der Webseite auszuspielen.
-
In Bremen werden Schüler-Handys verboten - in Hamburg entscheiden die Schulen selbst.
 |
Schüler-Handys entwickeln sich zum großen Streitthema in der Bildungspolitik.
(Foto: Robin Worrall, Unsplash) |
Bremen, 20.05.2025: Ab 1. Juni d. J. sind Smartphones an Schulen in Bremen verboten. Das betrifft sowohl Grund- als auch weitergehende Schulen in der Freien Hansestadt. Das hat der rot-rote Senat der Wesermetropole beschlossen. Erst in der Oberstufe sollen die Schulen künftig selbst entscheiden. Dem Verbot sind intensive Diskussionen des Bremischen Schulressorts mit Schulleitungen, Kinderärzten und Bildungsexperten vorausgegangen.
Die Schüler müssen ihre Handys während des Unterrichts abschalten. Die Lehrer sollen das kontrollieren. „Privathandys sind im Schulalltag nicht notwendig, im Gegenteil, sie lenken vom Lernen ab und halten Schülerinnen und Schüler davon ab, in den Pausen zu interagieren und vor allem sich zu bewegen“, erklärte Bremens SPD-Bildungssenatorin Sascha Karolin Aulepp.
Die FDP an der Weser kritisiert das Handy-Verbot und lobt die Verhinderung in der zu Bremen gehörenden Seestadt Bremerhaven. Der Fraktionssprecher für Kinder & Bildung in der Bürgerschaft, Fynn Voigt, erklärte: "Mit dem Erlass eines Handyverbots, verschließt Senatorin Aulepp ihre Augen vor der Realität. Schon jetzt dürfen die Schulen eigene Regelungen zur Handy-Nutzung in der Schule festlegen. Statt Digitalkompetenz zu fördern, wird nun zu einem Verbot gegriffen. Wir sind dem FDP-Schuldezernenten Hauke Hilz dankbar, diese unnütze Verordnung in Bremerhaven verhindert zu haben."
In Hamburg werden an einer Reihe von Schulen Handys eingesammelt und bis zum täglichen Unterrichtsende unter Verschluss gehalten. Zu den konsequenten Schulen gehört u. a. das bekannte Christianeum in Othmarschen. Erst ab der 8. Klasse dürfen Schüler nach Absprache mit Lehrern Smartphones als Arbeitsmittel im Unterricht benutzen.
„Wir beobachten eine intensivere direkte Kommunikation in den Pausen, mehr Bewegung und eine höhere Nachfrage nach Spielgeräten“, erzählt Schulleiter Stefan Prigge dem "Hamburger Abendblatt". Hintergrund: Mitte März d. J. veröffentlichte das Hamburger UKE eine Studie zur Handysucht bei Schülern. Jedes viertes Kind zwischen 10 und 17 Jahren benutzt sein Handy danach problematisch oder sogar krankhaft (HANSEVALLEY berichtete).
-
Links-getriebene Deindustrialisierung kostet 2025 bis zu 100.000 Jobs - Digitalisierung die einzige Chance für Deutschland.
 |
Industriefeindliche Links-Politik hat Deutschland abstürzen lassen.
(Foto: Unsplash-Alexander Zvir)
|
Bonn, 16.05.2025: Deutsche Unternehmen haben für das laufende Jahr einen Stellenabbau von 100.000 Arbeitsplätzen angekündigt. Allein bei Volkswagen sind ab Juli d. J. durch das Ende der Jobgarantie bis zu 35.000 Stellen gefährdet. 2024 wurden bereits knapp 70.000 Industriearbeitsplätze in Deutschland ersatzlos gestrichen.
Der Leiter der BWA-Akademie Bonn - Harald Müller - macht die Deindustralisierung anhand der angekündigten Stellenstreichungen greifbar (in Reihenfolge der angekündigten Stellenstreichungen):
- Deutsche Bahn: 30.000 Stellen
- ZF Friedrichshafen: bis zu 14.000 Stellen)
- Thyssenkrupp: 11.000 Stellen, davon 5.000 direkt
- SAP: 10.000, davon 3.500 Stellen in DE
- Deutsche Post-DHL: 8.000 Stellen
- Audi: 7.500 Stellen
- Continental: 7.000+ Stellen, gut 1/3 in DE
- Siemens: 6.000 Stellen weltweit, davon 2.850 in DE
- Bosch: 5.000 Stellen, davon 3.800 in DE
- Schaeffler: 4.700 Stellen, davon 2.800 in DE
- Porsche: 3.900 Stellen
- Commerzbank: 3.300 Stellen
- Ford-Werke: 2.900 (v. a. Werk Köln)
- Deutsche Bank: 2.000 Stellen
- Vodafone: 2.000 Stellen
- Coca-Cola: 500+ Stellen
"Angesichts der offensichtlichen Deindustrialisierung des Landes kann man nur hoffen, dass Deutschland die Transformation zur Dienstleistungsgesellschaft gelingt", blickt Akademie-Chef Harald Müller in die Zukunft. Für diesen Strukturwandel sei allerdings in erster Linie die Digitalkompetenz eines Landes entscheidend und damit stünde es in Deutschland nicht zum Besten, meint der Ökonom.
"Egal, ob es um Mobilfunk oder Glasfaser geht, der Ausbau hinkt hinterher. Es gibt Ecken in deutschen Großstädten, in denen man mit dem Smartphone noch nicht einmal telefonieren kann", weiß Harald Müller aus eigener Erfahrung, "von der Unterversorgung im ländlichen Raum ganz zu schweigen."
Bei der Digitalisierung der Öffentlichen Verwaltung seien ähnlich gravierende Defizite auszumachen. "Um seinen Personalausweis mit einer Online-PIN digital nutzbar zu machen, muss man im Bürgeramt persönlich vorsprechen", gibt er ein Beispiel für die "mangelhafte Digitalkompetenz im Öffentlichen Sektor".
Noch gravierender als die digitalen Defizite beim Bürgerservice sei die "Digitalferne in Amtsstuben, auf die die Wirtschaft angewiesen ist". "Der Breitbandausbau in Deutschland stockt auch, weil viele Bauämter mit den Genehmigungsprozessen nicht nachkommen", sagt Harald Müller.
Der Chef der Bonner Wirtschafts-Akademie appelliert an die neue Bundesregierung: "Die Umgestaltung unseres Landes von einer Industrie- zu einer Dienstleistungsgesellschaft wird ein langwieriger und schmerzhafter Prozess sein. Auf keinen Fall darf die industrielle Produktion hintenangestellt werden, solange nicht klar ist, ob und wie schnell diese Transformation gelingt".
Vor allem aber müsse der Weg für mehr Digitalisierung freigemacht werden, damit diese Entwicklung voranschreiten kann. Das "Primat des Datenschutzes bei jedem digitalen Fortschritt", die "bizarr-bürokratische Regulatorik" bei der Nutzung Künstlicher Intelligenz und die hohen Energiekosten, die den Bau und Betrieb von Rechenzentren in Deutschland zunehmend unattraktiver machten, stünden der Entwicklung hin zu einer digitalen Dienstleistungsgesellschaft "diametral entgegen", meint Harald Müller.
An die Politik gerichtet sagt er: "Es steht viel auf dem Spiel, nämlich unser Wohlstand, unser sozialer Frieden und letztlich unsere Demokratie. Denn eine misslungene Transformation mit schweren wirtschaftlichen Verwerfungen wird sicherlich schwerwiegende politische Folgen nach sich ziehen."
-
Hamburger Mediendialog schweigt Böhmermann-Hetze und Verfolgung unerwünschter Medien tot.
 |
"Tatort" linker Narrative für Mainstream-Medien.
(Foto: Thorsten Groth/Linkedin). |
Hamburg, 14.05.2025: Der diesjährige staatliche "Mediendialog" des links-grünen Hamburger Senats hat am Mittwoch-Abend (13.05.2025) mit dem Senatsempfang im Rathaus begonnen. Erwartbares Thema des politischen "Kuschelevents" für die Presse ist die Entwicklung der Medienbranche unter dem Vorzeichen einer einseitigen "demokratischen Öffentlichkeit".
Eine Leitfrage des großen Podiums vor rund 300 Vertretern aus Medien, staatlich-geführtem Rundfunk und Politik ist laut Senatskanzlei: "Wie kommen wir in der Öffentlichkeit wieder stärker zu positiven Erzählungen und welche unterschiedlichen Positionen gibt es bei der Regulierung von Medien-Plattformen zwischen Deutschland und der EU gegenüber den USA"?
Dabei hat das Event unter Federführung des linken Mediensenators Carsten Brosda Themen wie den strafbaren Angriff des ZDF-"Politikclowns" Böhmermann mit Unterstützung der linken Wochenzeitung "Zeit" auf einen YouTuber durch "Doxxing" (§ 126a StGB: "Gefährdendes Verbreiten personenbezogener Daten") absichtlich nicht auf der Agenda.
Ebenso fehlen Diskussionen zum versuchten Verbot und der wiederholten juristischen Verfolgung von leitenden Redakteuren konservativer und rechter Medien, wie "Compact"; "DeutschlandKurier" und "Nius", durch politische Sonder-Staatsanwaltschaften - u. a. im Auftrag von Brosda-Parteifreundin und Ex-Innenministerin Nancy Faeser.
Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher lies die Katze aus dem Sack, wie linke Politik die einflussreichen US-Social-Media-Netzwerke zwingen will, nur noch regierungskonforme Meinungen zuzulassen: „Die europäische Regulierung von Medien-Plattformen ist ein Schritt der Zivilisierung des digitalen Raums, der Nutzerinnen und Nutzer vor Betrug, Hasskommentaren und Fake News schützen soll."
Dabei nutzt Tschentscher bekannte einseitig linke Narrative, wie "Hasskommentare" und "Fakenews" (Stichwort: "Kampf gegen Hass und Hetze", Einflussnahme wahlweise aus Moskau, Peking oder Washington) als Begründung für gewollte und forcierte Verbote und Einschränkungen mittels "Digital Service Act" der EU.
Der linke SPD-Parteifunktionär Brosda machte in seinem Statement zum "Mediendialog" klar, wie einseitige Unterdrückung verargumentiert wird: Kultur- und Mediensenator Carsten Brosda sagte: „Ich bin froh, dass wir gemeinsam mit führenden Persönlichkeiten der deutschen Medien- und Digitalbranche nach Antworten dafür suchen, wie unsere Vorstellungen von einer demokratischen Öffentlichkeit verteidigt werden können.“
Die "demokratische Öffentlichkeit" umfasst linke und links-radiale sowie auf Bundes- und Landesebene von SPD- und Grün-dominierten Regierungen bezahlte NGO's, die beim nächsten Terroranschlag auf die Straße gehen, um mit Demonstrationen "gegen Rechts" die Meinungshoheit über die Berichterstattung islamistisch-geprägter Attentate wie in Magdeburg, Augsburg, München oder Berlin rhetorisch manipulativ für sich zu besetzen.
Neben NGO's - wie die gerichtlich als Lügner entlarvte politische Aktivisten-Organisation "Correctiv" (Stichworte: "Wannseekonferenz 2.0", "Deportationen geplant") - haben sich in den vergangenen Jahren auch bekannte Hamburger Medien, wie "ARD-aktuell"/"Tagesschau", die Nachrichtenagentur "DPA", die Zeitschrift "Der Spiegel" und die Wochenzeitung "Die Zeit" durch "Demokratieprojekte" und "Faktenchecker"-Programme zu politischen Unterstützern rot-grüner Ideologien entwickelt.
Weitere Informationen zum poltischen Mediendialog gibt es auf den Seiten des Hamburger Senats. -
Founders Impossible - Hochfliegende Millionen-Pläne mit üblichen Provinz-Partnern aus Forschung, Versandhandel, Subventions-Vereinen.
 |
Typisch Hamburg: Geldgier, viele Logos, wenig dahinter.
(Grafik: Founders Impossible)
|
Hamburg, 13.05.2025: Die Initiative "Founders Impossible" zur Förderung des Forschungs-, Technologie- und Gründerstandorts im Rahmen einer anvisierten 10 Mio. €-Förderung als "Startup Factory" durch den Bund entpuppt sich als neuer Hamburger Inzuchtbetrieb üblicher Subventionsritter, lokaler "Pfeffersäcke" und größenwahnsinniger Ideen für wissenschaftliche Kooperation.
Der Subventions-Reigen wird vom Millionen-Profiteur "DESY" angeführt, dessen Geschäftsführer Arik Willner die potenzielle Cash-Cow als CEO fest im Griff hat. Dazu hat er neben seiner Forschungseinrichtung "DESY" auch die in Bahrenfeld gebauten Immobilien "DESY Innovation Factory" und "Startupn Labs Hamburg" mit aktuell lediglich 35 Startup-Mietern als künftige Partner eingebunden. Dazu kommt ein Logodropping von "Helmholtz" bis "Fraunhofer". Institute aus der Regionen wie Lübeck und Rostock sind offensichtlich außen vor - selbst aus der sogenannten "Metropolregion Hamburg".
Der unbekannte Marketing-Forscher Christoph Lühtje von der TU in Harburg soll sich um die "Akademische Exzellenz" kümmern: Neben der vom rot-grünen Senat vernachlässigten TUHH wollen hier vermeintlich die LMU aus München, die Philips-Universität Marburg, die Unversität Bern und Wirtschafts-Universität Wien sowie das mit der HafenCity Universität verbundelte MIT mitspielen. Regionale Spitzenleistungen im Bereich Entrepreneurship, wie von der "Leuphana" im benachbarten Lüneburg oder der Universität zu Lübeck sind den Hamburgern offenbar zu provinziell.
Im Bereich Firmenkooperationen leitet der "Stadthalter" des Otto-Erben Benjamin die geplante Vernetzung mit der Wirtschaft, oder genauer gesagt mit der gesamten Versandhandels-Familie: "Chief Business Officer" Tom Korn bringt gleich fünf Otto-Organisationen mit, darunter die Konzern-Holding "Otto Group". die Digital-Tochter "Otto One", die Venture-Client-Abteilung "Otto Dock 6" sowie die Eigentümer-Steuerspar-Modelle "Michael Otto Stiftung" und "Holistic Foundation". Ob bei dieser Dominanz andere Unternehmen dabei sein wollen, bleibt offen.
Die Startup-Factory ist für die beteiligten Subventionsempfänger an Alster und Elbe ein lukratives Geschäft: Sollte Hamburg für eine "Startup Factory" ausgewählt werden, winken über 5 Jahre Laufzeit bis zu 10 Mio. € vom Bund. Gleichzeitig müssen die Gesellschafter ihrerseits 50 % des Projektvolumens einbringen. Dazu wurden die Stiftungen von Heinrich Herz und Michael Otto mit ins Boot geholt.
Das eigentliche Programm soll im 4. Quartal d. J. beginnen. Das unter der Regie des DESY-Instituts stehende Programm hat offiziell hochfliegende Ambitionen: So sollen bis zu 170 und mehr Startups aus dem Deeptech-Segment unterstützt werden, durch Co-Investitionen sollen über 10 Jahre bis zu 1,8 Mrd. € investiert werden können. Durch das Engagement der künftigen Factory sollen sage und schreibe 3.000 und mehr Jobs geschaffen und langfristig bis zu 400 Projekte promotet werden.
Offen bleibt die Frage, wieviele Millionen bei den beteiligten Kostgängern für Personal, Projektmanagement und Unterstützungsleistungen hängen bleiben. In diesem Zusammenhang ist es nicht verwunderlich, dass Schwerpunktthemen beteiligter Organisationen im Mittelpunkt stehen, wie z. B. das in Hamburg eigentlich nicht erfolgreiche skalierte Thema Künstliche Intelligenz und das vom links-grünen Senat gewollte Thema "Nachhaltigkeit" mit "grünen Technologien".
-
Achtung, Abzocke: Drücker-Kolonnen locken mit Glasfaser-Anschlüssen und verkaufen teure Übergangsverträge.
 |
Die Üblichen Verdächtigen: Werben mit Glasfaser und verkaufen teure DSL-Pakete.
(Foto/Grafik: Deutsche Telekom/Vodafone) |
Hamburg, 08.05.2025: Verbraucher berichten zunehmend von Verkaufsgesprächen, bei denen sie oft an der Haustür zu Glasfaserabschlüssen gedrängt werden, wie z. B. durch Drückerkolonnen im Auftrag von "Vodafone" oder "Telekom". Dabei stellen in vielen Fällen nicht die versprochenen Breitbandanschlüsse das Problem dar, sondern teure, untergeschobene Übergangsverträge, die bis zur Freischaltung der Glasfaserleitung laufen, warnt die Verbraucherzentrale Hamburg.
In den verkauften Paketen zur Zwischenlösung sind oft hohe Datenraten, Streamingdienste und TV-Funktionen enthalten, die Haushalte nicht oder nicht noch einmal benötigen. Die Verbraucherzentrale Hamburg rät zu besonderer Vorsicht beim Abschluss von Verträgen über Telefon- und Internetdienste. "Handeln Sie nicht voreilig, vergleichen Sie verschiedene Angebote in Ruhe und nehmen Sie sich ausreichend Zeit für Ihre Entscheidung", empfiehlt Julia Rehberg von der VZ Hamburg.
"Viele Menschen unterschreiben solche Verträge, weil ihnen im Verkaufsgespräch vor allem die Vorzüge von Glasfaser vermittelt werden", erklärt die Expertin. "Über die hohen Kosten und die meist unnötigen Zusatzleistungen des Übergangsvertrages werden sie oft nur am Rande informiert und sind dann von der hohen ersten Rechnung überrascht."
Besonders ältere Menschen seien gefährdet, da sie die technischen Details und die tatsächliche Notwendigkeit der angebotenen Leistungen nicht richtig einschätzen könnten. Zudem weigern sich Internet-Anbieter, die überteuerten, erschlichenen Verträge wieder aufzulösen.
Verbraucher, die einen Vertrag an der Haustür unterschrieben haben, sollten unbedingt kontrollieren, ob die im Gespräch genannten Konditionen auch wirklich in den Vertragsunterlagen oder der Auftragsbestätigung enthalten sind. Grundsätzlich gilt: An der Haustür geschlossene Verträge können innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen widerrufen werden. "Ein schriftlicher Widerruf per Einwurf-Einschreiben ist dafür der sicherste Weg", so Rehberg weiter.
HANSEVALLEY ist ein akuter Fall mit "1&1" angetragen worden, bei dem sich vier Support-Mitarbeiter in zwei Anrufen im First- und Second-Level-Support weigerten, den erschlichenen Zwischenvertrag aufzulösen. Stattdessen pöbelte ein Mitarbeiter, ein weiterer versuchte mit manipulativen Argumenten, den Kunden trotz mehrfach geäußertem Kündigungswunsch im Vertrag zu halten.
Die Redaktion von HANSEVALLEY warnt vor "1&1" von "United Internet" - wegen Übervorteilung von Kunden, v. a. auf Grund nicht bestätigter Kündigungen sowie pampigem und manipulativem Verhalten der Kundendienst-Mitarbeiter, um Verträge nicht auflösen zu müssen und sogar weiter verlängern zu können. Dieses Verhalten ist kundenfeindlich.
-
Hamburger Hochschulen und Subentionseinrichtungen schielen auf 10 Millionen Euro für eine Startup Factory.
 |
Das Führungsteam aus Wissenschaft und Firmenstiftungen.
(Foto: Impossible Founders/Linkedin) |
Hamburg, 30.04.2025: Am vergangenen Wochenende wurde in der Handelskammer der Freien und Hansestadt eine neue Initiative zur Förderung technischer Entwicklungen aus der Wissenschaft und deren Transfer in die Wirtschaft vorgestellt. Die Initative "Impossible Founders" vereint die Hamburger Institutionen Uni Hamburg. Technische Uni Hamburg, die Leuphana Lüneburg, das DESY und die Heinrich-Herz- sowie die Michael-Otto-Stiftung.
Ziel der Initiative ist das Einwerben von Fördermillionen für technische Entwicklungen aus den Hochschulen. Daher sind auch die üblichen Hamburger Kostgänger und Subventionsritter dabei, wie Handelskammer Hamburg, der KI-Förderverein "ARIC", die Harburger Startup-Initiative "Startup Port" von "Hamburg Innovation", aber auch der Digital Hub Logistics Hamburg, der Impact Hub Hamburg und die städtische Fördermittel-Firma "IFB Innovationsstarter".
Die Initiative will eine der vom Bund im Rahmen der "EXIST"-Studentenförderungen geplanten "Startup Factories" betreiben. Bis zum (heutigen) 30. April d. J. müssen die aktuell 15 im Rennen befindlichen Initiativen aus ganz Deutschland ihre Konzepte einreichen. Dafür gibt es vom Bund 150.000,- € Unterstützung. Anschließend werden 5-10 Projekte für die langfristige Unterstützung ausgesucht. Dazu sollen alle relevanten Initiativen zur Startup-Förderung in den jeweiligen Regionen mitmachen.
Die "Startup Factory" ist für die beteiligten Subventionsempfänger an Alster und Elbe ein lukratives Geschäft: Sollte Hamburg für eine Einrichtung ausgewählt werden, winken über 5 Jahre Laufzeit bis zu 10 Mio. € vom Bund. Gleichzeitig müssen die Gesellschafter ihrerseits 50 % des Projektvolumens einbringen. Dazu wurden die Stiftungen von Heinrich Herz und Michael Otto mit ins Boot geholt.
Das eigentliche Programm soll im 4. Quartal d. J. beginnen. Das unter der Regie des mit Millionenbeträgen subventionierten DESY-Instituts stehende Programm hat offiziell hochfliegende Ambitionen: So sollen bis zu 170 und mehr Startups aus dem Deeptech-Segment unterstützt werden, durch Ko-Investitionen sollen über 10 Jahre bis zu 1,8 Mrd. € investiert werden können. Durch das Engagement der künftigen Factory sollen sage und schreibe 3.000 und mehr Jobs geschaffen und langfristig bis zu 400 Projekte promotet werden.
Offen bleibt die Frage, wieviele Millionen bei den beteiligten Kostgängern für Personal, Projektmanagement und Unterstützungsleistungen hängen bleiben. In diesem Zusammenhang ist es nicht verwunderlich, dass Schwerpunktthemen beteiligter Organisationen im Mittelpunkt stehen, wie z. B. das in Hamburg eigentlich nicht erfolgreiche skalierte Thema Künstliche Intelligenz und das vom links-grünen Senat gewollte Thema "Nachhaltigkeit" mit "grünen Technologien".
Auf der Website von "Impossible Founders" gibt es weitere Details zur neuen Subventionseinrichtung aka "Leuchtturmprojekt" in Hamburg. -
Hamburger Senat träumt Leuchtturm-Phantasien eines Hyperloops entlang der A24.
 |
So sieht der neueste Traum des rot-grünen Hamburger Senats aus.
(Grafik: ChatGPT/Image Editor, Railfreak.de) |
Hamburg, 28.04.2025: Der Hamburger Senat hat ein neues "Leuchtturmprojekt" in Planung, dass droht, als "Teelicht" zu enden. Danach hat der rot-grüne Senat in nur drei Monaten ohne tiefgehende Prüfung beschlossen, eine "Hyperloop"-Teststrecke für Personen zwischen dem östlichen Hamburger Stadtteil Jenfeld und dem Horner Kreisel entlang der Autobahn A24 politisch und organisatorisch zu unterstützen.
Die Initiatoren beschreiben als Möglichkeit für eine Streckenführung zwei Röhren mit rund vier Metern Durchmesser, die aufgeständert auf dem Mittelstreifen der Autobahn gebaut werden können. Der Senat hat einen Letter of Intent mit dem Konsortium "Mode 5" zur Umsetzung des Projekts mit Beteiligung des Hamburger Senats unterzeichnet.
Die Links-Fraktion in der Bürgerschaft bringt dazu in einer kleinen Anfrage an den Senat auf den Punkt: "Am 9. Januar 2025 hat die Deutsche Rail Operation GmbH (DRO) ihre Projektidee „Mode 5“, eine Magnetschwebebahn in einer Vakuumröhre entlang von Bundesautobahnen, in einem gemeinsamen Gespräch dem Ersten Bürgermeister, dem Verkehrssenator, dem Innensenator sowie einem Geschäftsführer der New Mobility Solutions GmbH (NMS) vorgestellt."
Mit dem Letter of Intent (LOI) wurde der DRO bereit im Februar 2025 zugesagt, sie bei der Analyse und Simulation der Einbindung des Projektes in die städtische Verkehrsinfrastruktur, bei den erforderlichen Genehmigungs- und Zulassungsverfahren sowie der anschließenden Projektrealisierung bestmöglich zu unterstützen. Um nicht in die Schusslinie zu geraten, wurden keine Angaben zur finanziellen Beteiligung Hamburg veröffentlicht.
Heike Sudmann, verkehrspolitische Sprecherin der Linken in der Hamburgischen Bürgerschaft: „Die hohen Geschwindigkeiten berauschen anscheinend auch den Senat. Drei Monate für eine behördenübergreifende Entscheidung zur Unterstützung des Projektes ist eine Rekordzeit. Für wichtige Fragen, z.B. wie so eine mehrere Meter hohe Röhre dann in den Bahn- und Busverkehr integriert werden kann, blieb keine Zeit. Jedenfalls kann der Senat dazu keine Angaben machen. Die so viel gepriesene Technologieoffenheit darf nicht über die Stadtverträglichkeit gestellt werden. Hier erwarte ich klare Vorgaben des Senats."
Seit 2023 gibt es im bayerischen Ottobrunn bei München eine "Hyperloop"-Teststrecke unter Regie der TU München. Seit vergangenem Jahr gibt es auch im friesischen Emden eine kurze Teststrecke für den von Elon Musk mitentwickelten Röhrenzug. Dort kooperieren die Entwickler mit der Hochschule Emden/Leer. Offenbar hat die rot-grüne Stadtpolitik ein Minderwertigkeitskomplex, weshalb sie ein eigenes "Hyperloop"-Projekt als eigene Sensation verkaufen will.
Ein ausführlicher Beitrag zum Thema "Hyperloop" an Autobahnen ist bei Railfreak.de erschienen. -
Hamburger Senat soll Redefreiheit auf Social Media Plattformen unterdrücken.
 |
Der Senat der Medienmetropole Hamburg soll Social-Media-Netzwerke unter Druck setzen.
(Foto: Liggraphy2, Pixabay) |
Hamburg, 28.04.2025: Der neue links-lastige Senat der Freien und Hansestadt plant, internationale Social-Media-Netzwerke zu überwachen und nach Möglichkeit politisch einseitig einzuschränken. Das sieht ein Antrag der beiden Regierungsfraktionen SPD und Grüne an die neue-alte Koalition für die Sitzung der Bürgerschaft am 7. Mai d. J. vor. Darin fordern die Regierungsfraktionen für die Verhandlungen der Bundesländer zum Medienkonzentrationsrecht:
- 'Umfassende Berücksichtigung von Gefährdungen der Meinungsbildung, auch durch horizontale, vertikale und crossmediale Konzentrationsprozesse im reformierten Medienkonzentrationsrecht,
- Entwicklung und Implementierung vielfaltssichernder Maßnahmen im Rahmen der Reform des Medienkonzentrationsrechts,'
Unter dem Deckmantel vermeintlicher "Meinungsfreiheit" und "moderner Medienregeln" entlarven die beiden linken Parteien, wie unter Beteiligung Hamburgs die Bundesländer künftig die Netzwerke "X", "Tiktok" & Co. beschneiden sollen. Der selbsternannte SPD-Medienexperte Hansjörg Schmidt erklärt in einer aktuellen Meldung:
"Wenn wenige internationale Plattformkonzerne ohne Transparenz darüber bestimmen, welche Inhalte Menschen sehen können, ist unsere freie, demokratische Meinungsbildung massiv gefährdet. Greifen einige Eigentümer dieser Plattformen auch noch aktiv in die Wahlen einzelner Länder ein, zeigt es, wie dringend hier gehandelt werden muss."
Im ersten Schritt sollen politisch verhasste Netzwerke beobachtet und ihre Popularität als "Marktmacht" dingfest und damit über das Konzentrationsrecht angreifbar gemacht werden. Der Hamburger Lokalpolitiker Schmidt bestätigt dies indirekt: "Dabei geht es weniger um Regulierung, sondern um die faire Balance zwischen Meinungsfreiheit, Wettbewerb und publizistischer Vielfalt".
Auch dem Grünem politisch ideologischen Reigerungspartner sind unkontrollierte, nicht zu verbietende Diskussionen über NGO's, politische Staatsanwaltschaften und regierungshöhrige Richter z. B. in Göttingen und Bamberg ein Dorn im Auge. Der Grüne Abgeordnete René Gögge fabuliert in der gemeinsamen Meldung:
"Unser Ziel ist es, demokratische Vielfalt zu sichern und die Medienordnung zukunftsfest zu gestalten.“ Unter "demokratischer Vielfalt" verstehen die Grünen einseitig Positionen der von ihnen initiierten, mitkontrollierten und finanzierten NGO's, die sie der Öffentlichkeit als "Zivilgesellschaft" verkaufen.
In Ihrem Antrag an den Senat werden SPD und Grünen deutlich: 'So liegen z. B. die größten sozialen Medien in den Händen einiger weniger Unternehmen, die neben medialer und wirtschaftlicher auch politische Macht in sich vereinen und so einen größeren Anteil am Medienmarkt kontrollieren. Dadurch steigt die Gefahr, dass einzelne Medienkonzerne starken Einfluss auf die Meinungsbildung und -vielfalt haben, die wesentliche Bestandteile unserer Demokratie sind.'
Die linken Hamburger Parteien zeigen in dem Antrag ihr wahres Gesicht: *Deshalb ist eine Reform des Medienkonzentrationsrechts dringend erforderlich, um die Meinungsvielfalt im digitalen Zeitalter effektiv zu schützen, faire Wettbewerbsbedingungen für alle Marktteilnehmer zu gewährleisten, moderne Messverfahren für Meinungsmacht zu etablieren, die Regulierung an die veränderte Mediennutzung anzupassen und internationale Plattformanbieter angemessen in den Regulierungsrahmen einzubeziehen.'
Mit "einbeziehen" meinen Rot und Grün, Plattformbetreiber bei Strafzahlungen und Drohungen zur Abschaltung zu zwingen, Meinungen zu löschen und mit Hilfe von NGO-"Moderatoren" aka "Faktencheckern" nur regierungskonforme Positionen zuzulassen, wie es die linke Biden-Regierung in den USA u. a. mit "Facebook" betrieben hat.
Die Länder arbeiten derzeit an einem neuen Konzept für das Medienkonzentrationsrecht, dass droht in einer Meinungsdikatur auf Social Media Netzwerken zu münden.
-
Links-populistische Journalisten gehen manipulativ auf neues ARD-Reportage-Magazin des NDR los.
 |
Keine links-grüne Propaganda: Das ARD-Reportage-Magazin "Klar"
Foto: NDR |
Hamburg/München, 17.04.2025 - Update 18.05.2025: Das neue kritische TV-Reportage-Format "Klar" von Bayerischem und Norddeutschem Rundfunk hat in politisch linken Kreisen für einen Proteststurm und persönliche Angriffe auf die Fernsehmoderatin, BR-Redakteurin und "Focus"-Kolumnistin Julia Ruhs gesorgt. Die opportunistische "Berliner Morgenpost" und ihr linker "Funke Digital" -Reporter fragten, ob der NDR "jetzt nach rechts rücke".
Anlass für die politisch einseitigen Angriffe und Vorwürfe ist die erste Folge von "Klar" mit dem Titel "Migration: Was läuft falsch". Darin wird offen und ungeschönt über Missstände und Versäumnisse in der Migrationspolitik der Ampel und generell in Deutschland gesprochen. Der links-grün-populistische ZDF-TV-Moderator Böhmermann versuchte, das neue Fernsehmagazin als "rechtspopulistischem Quatsch" zu verunglimpfen.
Moderatorin Julia Ruhs machte gleich in ihrer Anmoderation klar: "Was jetzt kommt, wird vielleicht nicht jedem gefallen. Aber es ist eines der ganz großen Streitthemen unserer Zeit." Im Mittelpunkt der Reportage steht die illegale Migration. Die "Berliner Morgenpost" prangert in links-populistischer Manier an, dass die "Differenzierung an der einen oder anderen Stelle unter den Tisch falle."
Ruhs kontert in einem NDR-Statement: „In den vergangenen Jahren wurde viel von Diversität gesprochen, doch das ging auch einher mit dem Ausblenden unliebsamer Themen und Meinungen. Viele Menschen haben das so gesehen. Ihnen möchten wir mit unserem neuen Format ein Angebot machen." Damit ist klar, dass das Reportage-Format keine links-grün-einseitigen Argumente verbreiten will und wird.
Im Mittelpunkt der ersten Folge von "Klar" steht Michael Kyrath, Vater der im Regionalexpress in Brokstedt bei Neumünster zusammen ihrem Freund von einem kranken, staatenlosen "Palestinenser" erstochenen Tochter. Der 33-jährige Mörder und von den Behörden in Hamburg und Kiel nicht eingesperrte Asylant stach auf drei weitere, schwer verletzte Fahrgäste des Regionalexpresses ein.
HANSEVALLEY hat nach den Attentaten von Magdeburg, Aschaffenburg, München und Berlin einen kontinuierlich aktualisierten Leitartikel unter der Überschrift "Magdeburg ist überall" veröffentlicht. Darin werden u. a. entlarvende Statements roter und grüner Politiker mit aktuellen und kontinuierlich steigenden Zahlen bei Ausländerkriminalität, Messerangriffen, Vergewaltigungen sowie den milliardenschweren Kosten von Städten, Ländern, Bund und Sozialkassen gegenübergestellt.
-
Hamburgs SPD-Kultursenator Brosda hat "Jupiter"-Kulturkaufhaus ohne Bau- und Brandschutzgenehmigungen betrieben.
 |
Über Jahre lies die Betreiberin im Auftrag des Senats Besucher im Unklaren.
Foto: Hamburg Kreativ Gesellschaft |
Hamburg, 16.04.2025: Die staatliche Kulturförderung von SPD-Kultursenator Carsten Brosda - die "Hamburg Kreativ Gesellschaft" unter dem Kulturfunktionär Egbert Rühl - hat das ehemalige "Karstadt Sport"-Haus an der Mönckebergstraße Ecke Steintorwall nahe des Hauptbahnhofs offensichtlich die gesamte Zeit über ohne notwendige Baugenehmigung sowie ohne erforderliches Sicherheits- und Brandschutz-Konzept als Eventlocation, Ausstellungsfäche und Gastronomieobjekt betrieben.
Im Februar 2025 hatte das zuständige Fachamt Bauprüfung des Bezirks Hamburg-Mitte bei einer Begehung gravierende sicherheitstechnische Mängel fest. Erst ein Monat später wurde die verantwortliche Mieterin - die unter direkter Verantwortung der Brosda-Kulturbehörde stehende - "Hamburg Kreativ Gesellschaft" über die schwerwiegenden und gefährlichen Mängel informiert.
Das unerfahrene Team der "Hamburg Kreativ Gesellschaft" spielt die gefährliche Location auf Ihrer Website mit Wissen des verantwortlichen SPD-Kultursenators Carsten Brosda herunter: "Wegen einer behördlichen Anordnung können bis auf weiteres nur noch 200 Personen gleichzeitig auf bzw. in den Jupiter. Es kann zu Wartezeiten und kurzfristigen Änderungen im Programm kommen. Wir setzen alles daran, Wartezeiten zu vermeiden und arbeiten an einer schnellen, organisatorischen Lösung."
Dabei verschweigen die staatlichen Kulturförderer mit ihrem 4 Mio. €-Etat für die Bewirtschaftung des "Jupiter" allein in 2023 die Gefahren für die zeitweise tausenden Besucher - z. B. während des jährlichen Sommerfestes auf der nicht genehmigten Dachterasse. Ende April '25 wird das vom Senat im Rahmen des staatlichen Subventionsprogramms "Freifläche" seit der Corona-Pandemie finanzierte "Jupiter" geschlossen. Grund: Das Corona-Förderprogramm läuft aus, Rot-Grün hat offenbar kein Nachfolgeprojekt geplant.
Anke Frieling, stadtentwicklungspolitische Sprecherin der CDU-Fraktion: "Marode Brandschutztüren, versperrte oder nicht markierte, unklare Flucht- und Rettungswege gefährden Menschenleben. Die Besitzer kleinerer Geschäftseinheiten in der Innenstadt, die umgenutzt werden sollen, warten teilweise monatelang auf Genehmigungen. Der Senat macht mal eben ein Kaufhaus zum Multifunktionsgebäude, ohne an Sicherheit und Brandschutz zu denken und wohl auch ohne Genehmigungsantrag, denn dabei wären die Probleme doch wohl hoffentlich aufgefallen."
Die Eigentümerin der Immobilie - die "R+V Versicherung" - hat bis heute noch keinen neuen Mieter für die insgesamt 8.000 qm Fläche. Offenbar verhandelt die Versicherung auch mit der Stadt, um nach Möglichkeit einen erneuten Leerstand des früheren Handelsobjekts zu verhindern, berichtet das "Hamburger Abendblatt".
-
Lehrer aus Seevetal missbraucht Dienst-Mail für AfD-Anfeindungen - Grünes Kultusministerium in Hannover spielt ideologisch toter Käfer.
 |
Die UNESCO-Umweltschule beherrbergt Demokratiefeinde unter ihren Lehrern.
(Foto: Buttler Architekten) |
Hannover, 14.04.2025: Ein Lehrer der integrierten Gesamtschule Seevetal hat über seine dienstliche E-Mail-Adresse die gesamte Schulgemeinschaft inkl. rd. 150 Schülern und 55 Lehrern zur Teilnahme an einer Demonstration gegen eine AfD-Veranstaltung aufgerufen. Auf eine Anfrage der AfD-Fraktion räumt die Landesregierung ein, dass Vorgehen des Lehrers sei "nicht zu befürworten“. Sie verzichtet jedoch auf jegliche dienstrechtliche Konsequenzen.
Harm Rykena, bildungspolitischer Sprecher der AfD-Fraktion im Niedersächsischen Landtag, erklärt: „Ein Lehrer, der mit offizieller Schul-Mail zu einer politischen Demonstration gegen eine im Bundestag vertretene Partei aufruft, handelt nicht pädagogisch, sondern politisch motiviert. Die Landesregierung erkennt zwar an, dass dieses Verhalten nicht zu befürworten ist, spricht aber gleichzeitig von einem bloßen ‚appellativen Charakter‘ der E-Mail und sieht keinen Anlass für weitergehende Maßnahmen. Das ist völlig unzureichend."
Statt eine klare rote Linie zu ziehen, begnüge sich das Kultusministerium der umstrittenen Grünen Bildungsministerin Hamburg mit einem vagen Hinweis auf die dienstrechtliche Pflicht zur Neutralität. Noch befremdlicher sei die Aussage, dass es aus pädagogischer und politikdidaktischer Sicht grundsätzlich begrüßenswert sei, wenn Lehrkräfte sich mit tagespolitischen Themen auseinandersetzen – insbesondere bei regionalem Bezug.
Damit legitimiert die rot-grüne Landesregierung indirekt das parteipolitische Engagement von Lehrkräften im Schulkontext.
Harm Rykena weiter: "Unsere Kinder haben ein Recht auf ideologiefreien Unterricht. Wenn Lehrkräfte ihre dienstliche Rolle missbrauchen, um Stimmung gegen bestimmte Parteien zu machen, wird dieses Recht verletzt. Ich fordere daher eine klare Abgrenzung des Ministeriums gegenüber politischer Agitation an Schulen sowie disziplinarische Konsequenzen für den betroffenen Lehrer. Wer das Klassenzimmer zur Bühne für seine persönliche Gesinnung macht, gehört nicht in den Schuldienst.“
-
"Absolut arroganter" Otto-Versand verweigert Rückerstattung für 700,- € teure Kaffee-Schrott-Maschine.
 |
Otto: Sie übervorteilen Journalisten, Marktplatzhändler aber auch Kunden.
Foto: HANSEVALLEY |
Hamburg/Hannover, 09.04.2025: Die Verbraucherzentrale Niedersachsen nimmt sich die Machenschaften des von Insidern als "absolut arrogant" bezeichneten Hamburger Distanzhändlers "Otto" vor. Nach viemaligem Umtausch bzw. Reparaturen verweigert der finanziell in schwerem Fahrwasser steckende Hamburger Versender die Rückabwicklung des Kaufs eines 700,- € teuren Kaffeeautomaten.
Die Katastrophe rund um den Einkauf auf "otto.de": Das Netzkabel defekt, die Programmsteuerung setzt aus und Fehlermeldungen treten auf – der Kauf wird für die niedersächsische Kundin zur Geduldsprobe. Direkt nach der Bestellung muss das Gerät aufgrund eines Defekts beim Hersteller retourniert und neu bestellt werden.
Als auch das Ersatzgerät nach kurzer Zeit ausfällt, wendet sich die Verbraucherin erneut an den Hersteller. Insgesamt drei Mal schickt sie das Gerät seit Oktober 2023 erfolglos zur Reparatur. Im Juli 2024 erhält sie ohne Ankündigung eine neue Kaffeemaschine vom Hersteller, die jedoch ebenfalls nicht funktioniert.
Mit jetzt zwei defekten Geräten wendet sie sich an den Verkäufer "Otto". Der Anbieter fordert die Verbraucherin im bekannt "absolut arroganten" Sitl auf, „dem Wunsch des Herstellers nachzukommen“ und ein Video von dem Fehler zu übermitteln. Eine Rückabwicklung des Kaufs verweigert der milliardenschwere Familienkonzern.
Nach einem juristischen Schreiben der Verbraucherzentrale Niedersachsen erhält die Kundin zwar ein Retourenlabel, eine Erstattung des Kaufpreises wird jedoch weiterhin mit allen Mitteln verweigert. Damit entlarvt sich "Otto" im Gegensatz zu Wettbewerbern wie "Amazon" und "Temu" als kundenfeindlich, um den Kaufbetrag um jeden Preis einbehalten zu können.
„Unserer Ansicht nach ist die Rechtslage hier klar. Innerhalb der Gewährleistungsfrist tragen bei Mängeln die Händler das Risiko und die Kosten des Transports. Das können sie auch nicht umgehen, indem sie eine Videoaufnahme zur Bedingung für die Reparatur machen“, erklärt Tiana Schönbohm, Rechtsexpertin der Verbraucherzentrale Niedersachsen.
Die Juristin macht klar: Ein solches Vorgehen benachteiligt Kunden unangemessen und schränkt ihre Gewährleistungsrechte erheblich ein. „Irritierend ist zudem, dass Otto auf den Hersteller verweist. Als Vertragspartner ist eindeutig der Händler in der Pflicht, einen auftretenden Mangel zu beheben“. Offensichtlich rechtlich angreifbare Tricks des finanziell angeschlagenen Konzerns, der Pflicht zur Rückerstattung nicht nachkommen zu wollen.
Rechtlich ebenfalls eindeutig: Endlose Reparaturschleifen müssen Kunden nicht akzeptieren. „Spätestens nach zwei erfolglosen Nachbesserungsversuchen haben sie das Recht, vom Kaufvertrag zurückzutreten – und die sind im vorliegenden Fall längst erreicht. Otto sollte jetzt endlich einlenken und der Kundin den Kaufpreis erstatten“, fordert Schönbohm.
Die Rechtsexpertin empfiehlt Verbrauchern, sich im Gewährleistungsfall immer an den Händler zu wenden – auch, wenn dieser das Gegenteil behauptet. „Am besten ist es, die Mängelbeseitigung schriftlich per Einschreiben zu fordern und dabei eine klare Frist, etwa von 14 Tagen, zu setzen“, so Schönbohm.
HANSEVALLEY warnt aufgrund eigener einschlägiger Erfahrungen vor Einkäufen bei "otto.de" und verbundenen Shops. Eine Supporterin reagierte auf die berechtigte Kritik eines Redaktionsmitglieds nach mißlungenen Zustellversuchen in kundenfeindlicher Manier: "Sie hätten ja nicht bei uns kaufen müssen."
Die Redaktion von HANSEVALLEY vermeidet Käufe bei "About You", "Baur", "Bonprix", "Frankonia", "Heine", "Manufactum", "Otto", "Quelle", "Sheego" und anderen Shops sowie Beteiligungen der Hamburger Milliardärsfamilie.
-
Erfahrene Bertelsmann-Managerin vom Rundfunkrat abgebürstet - Vier-Länder-Sender NDR reformunfähig.
 |
Der NDR hat mit Ablehnung seiner künftiger Intendantin selbst geschadet.
(Foto: Kevin Hackert, Lizenz: CC BY-SA 2.0) |
Hamburg, 07.04.2025: Die langjährige "Bertelsmann"-Medienmanagerin Sandra Harzer-Kux hat am Freitag vergangener Woche im Rundfunkrat des NDR nicht die erforderliche Zweidrittelmehrheit für die Wahl zur Intendantin erhalten. In geheimer Abstimmung stimmten 30 Mitglieder für die Kandidatin, nötig gewesen wären 34 Stimmen. Der Verwaltungsrat des NDR hatte dem Gremium am 28. März '25 die erfolgreiche Managerin einstimmig zur Wahl vorgeschlagen.
Nico Fickinger, Vorsitzender des NDR-Rundfunkrates, erklärte nach der Wahlpanne: "Der Vorschlag, die Stelle mit einer führungserfahrenen Medienmanagerin von außen und erstmals auch mit einer Frau besetzen zu wollen, ist von vielen Rundfunkrats-Mitgliedern sehr positiv aufgenommen worden. Einigen Mitgliedern war es aber offenbar sehr wichtig, dass eine Person für dieses Amt zusätzlich auch eigene Erfahrung im öffentlich-rechtlichen Rundfunk mitbringt, um die Interessen des NDR innerhalb der ARD und gegenüber der Politik kraftvoll vertreten zu können."
Jens-Christoph Brockmann, medienpolitischer Sprecher der AfD-Fraktion im Niedersächsischen Landtag, stellt fest: „Mit Bedauern und Besorgnis nehme ich zur Kenntnis, dass der NDR-Rundfunkrat die Gelegenheit ungenutzt ließ, durch die Wahl von Sandra Harzer-Kux zur Intendantin dringend notwendige Reformen einzuleiten. Die Entscheidung, einer externen, erfahrenen Medienmanagerin die erforderliche Mehrheit zu verweigern, deutet darauf hin, dass der NDR entweder nicht willens oder nicht fähig ist, sich den Herausforderungen der modernen Medienlandschaft zu stellen.
Sandra Harzer-Kux, die über umfangreiche Erfahrung im Medienmanagement verfügt, hätte dem NDR eine frische Perspektive und innovative Ansätze bieten können, so der Medienpolitiker in Hannover. Die Ablehnung ihrer Kandidatur signalisiere eine bedauerliche Abkehr von der Chance, durch externe Expertise und neue Impulse den dringend benötigten Wandel voranzutreiben.
Der Verwaltungsrat hat laut NDR-Staatsvertrag die Möglichkeit, dem Rundfunkrat innerhalb eines Monats einen neuen Vorschlag zu unterbreiten. Geschieht dies nicht, entfällt das Vorschlagsrecht. Der amtierende NDR-Intendant Joachim Knuth hatte den Aufsichtsgremien im vergangenen Jahr angeboten, seine Amtszeit um wenige Monate zu verkürzen und Ende August 2025 in den Ruhestand zu wechseln, damit seine Nachfolge früher in wichtige strategische und finanzielle Entscheidungen im NDR und in der ARD eingebunden werden kann.
-
Niederträchtig agierende Göttinger Staatsanwälte wollen kritische Kolumnistin weiter mundtot machen.
 |
Die hämisch lachenden Staatsanwälte verfolgen auch Journalisten.
Foto: CBS/60 Minutes |
Göttingen, 31.03.2025: Schwere Schlappe für die niederträchtig agierenden Staatsanwälte der "Petz- und Denunziations-Behörde" ZHIN bei der örtlichen Staatsanwaltschaft in Göttingen: Nach 2,5 Jahren Verfolgung verlieren die - durch die US-Reportage "60 Minutes" weltweit berühmt-berüchtigt gewordenen Strafverfolger der links-grünen Landesregierung - ihren Prozess gegen die Goslaer Kolumnistin Annabel Schunke.
Das Landgericht Braunschweig sprach die uneingeschüchterte Journalistin vom Vorwurf der "Volksverhetzung" frei und kassierte damit das Urteil des Amtsgerichts über 5.400,- € Strafzahlung wegen vermeintlich abfälliger Äußerungen gegen Sinti und Roma. Zuvor hatten die hämisch agierenden Göttinger Staatsanwälte bereits versucht, die kritische Publizistin mit einer Geldstrafe über 3.600,- € mundtot zu machen.
Die kritische und nach Erfahrungen unserer Redaktion mindestens teilweise wahrheitsgemäße Aussage der Goslaer Bloggerin zu Sinti und Roma aus dem Jahr 2022 auf dem Netzwerk X lautet: „Ein großer Teil der Sinti und Roma in Deutschland und anderen Ländern schließt sich selbst aus der zivilisierten Gesellschaft aus, indem sie den Sozialstaat und damit den Steuerzahler betrügen, der Schulpflicht für ihre Kinder nicht nachkommen, nur unter sich bleiben, klauen, Müll einfach auf die Straße werfen und als Mietnomaden von Wohnung zu Wohnung ziehen.“
Interessant: Die politischen Gesinnungsverfolger aus Göttingen hatten bei Ihrer Anklage einen wichtigen Teil der Kritik ersichtlich absichtlich unter den Tisch fallen lassen. Mit den folgenden Worten hatte Anabel Schunke offen Kritik an der Verfolgung von Andersdenkenden durch das SPD-geführte Innenministerium der linken Nancy Faeser kritisiert: "Wer das benennt, wird von der eigenen Innenministerin des neu erfundenen ‚Antiziganismus‘ bezichtigt."
Der Vorsitzende Richter am Landgericht Braunschweig bezeichnete die Aussagen der Bloggerin als „möglicherweise beleidigend, aber nicht volksverhetzend“. Die politisch beauftragten Staatsanwälte in Göttingen reicht die Schlappe jedoch noch lange nicht - sie haben gegen den Freispruch ihrerseits Einspruch eingelegt.
-
Rot-rote Landesregierung in MV bekommt Digitalisierung der Verwaltung nicht hin.
 |
Die Digitalkonferenz "Noerd" ist das Zentrum der Entwicklung in MV.
Foto: HANSENVALLEY |
Schwerin, 24.03.2025: „Im Jahre 2025 sind alle Behörden von Mecklenburg-Vorpommern digital erreichbar“. So versprach es die rot-rote Landesregierung um Ministerpräsidentin Manuela Schwesig 2021 in der umfassenden Digitalisierungsstrategie des Landes. Für die Präsidentin des Landesrechnungshofes in Schwerin - Martina Johannsen - ist das Ziel kläglich gescheitert.
Die Aufsichtsbehörde legte am 11. März d. J. einen Sonderbericht zur Digitalisierung im Nord-Osten vor. Zentrales Ergebnis: Die linken Parteien in Schwerin haben nicht genug unternommen, um die Verwaltung des strukturschwachen Bundeslandes von Locher und Stempelkissen weiterzuentwickeln.
Hauptproblem: Politik und Ministerien haben nicht klar genug festgelegt, wo was mit digitalen Möglichkeiten modernisiert werden soll. Rechnungshof-Präsidentin Martina Johannsen konkret „Die Digitalisierung ist kein Selbstzweck. Sie muss einen Mehrwert für Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen, aber auch die Landesverwaltung selbst schaffen.“
Ein Hauptproblem: Das Ende 2022 im Digitalisierungsministerium eingerichtete "Zentrum für Digitalisierung" hat bis Ende 2024 seine Arbeit nicht wirklich aufgenommen. Dabei soll die Behörde als Schnittstelle und Projektmanagement-Plattform die Vorgaben der Politik zusammen mit dem landeseigenen IT-Dienstleister und weiteren Partnern angehen und umsetzen.
Martina Johannsen macht deutlich: „Die Landesverwaltung ist organisatorisch derzeit nicht so aufgestellt, dass sie die Herausforderungen der Digitalisierung bewältigen kann.“ Dazu gehört auch, dass die Zusammenarbeit des Innen- und Digitalisierungsministeriums von SPD-Vorreiter Christian Pegel mit den anderen Ministerien nicht in die Gänge kommt.
Die Aufsichtsbehörde geht noch weiter: Die Landespolitik hat bisher nicht einmal die notwendige rechtlichen Rahmenbedingungen geschaffen, um digitale Tools und dahinter stehende IT erfolgreich einsetzen zu können. Die Finanzaufseherin schreibt Christian Pegel ins Stammbuch: „Die vorhandenen Regelungen sind veraltet und genügen nicht mehr den aktuellen Rahmenbedingungen. Sie erschweren sogar häufig die Digitalisierung.“
Damit nicht genug: Das Land müssen sich überlegen, welche Programme sie einsetze. Hierzu müssten klar Vorgaben von der Politik kommen - auch in Richtung Souveränität von einzelnen Software-Konzernen. Wie beim Nachbarn Schleswig-Holstein kann aus Sicht des Rechnungshofes eine Alternative sein: „Um Abhängigkeiten von einzelnen Herstellern zu reduzieren, muss auch der Einsatz von Open Source geprüft werden.“
Für den Bund der Steuerzahler in MV ist der Sonderbericht ein vernichtendes Urteil der Digitalpolitik von Schwesig, Pegel und Co:: „Die Liste dessen, was erledigt werden muss, ist lang. Darüber hinaus gibt es kritische Schwachstellen in der Informationssicherheit des Landes.“ Die 78 Seiten Mängelliste müssen nach Angaben des Interessenvertreters personelle Konsequenzen haben.
Hintergrund: Im Rahmen eines "Digitalen Agenda" wurden 2018 von der damaligen rot-schwarzen Landesregierung erstmals Ziel und Schwerpunkte für die Digitalisierung der Verwaltung im Nord-Osten festgelegt. Im Jahr 2021 verabschiedete die Schweriner Koalition eine umfassende Digitalisierungsstrategie mit weitergehenden Zielen. Darin wurden Handlungsfelder definiert, die bis 2025 digitalisiert sein sollen.
-
AfD-Fraktionsspitze nimmt manipulatives DPA-Interview von SPD-Lokalfrau Veit auseinander.
 |
Die ewig lächelnde Carola Veit findet AfD-Kritik gar nicht lustig und keilt los.
(Foto: Wahlkampf-Video SPD Hamburg, instagram/carolaveit, Screenshot: HANSEVALLEY) |
Hamburg, 14.03.2025: Die AfD-Fraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft nimmt sich die politisch links abdriftende, bisherige SPD-Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit vor. Nach dem PR-Interview der Rothenburger Lokalpolitikerin gegenüber der ebenfalls links gefärbten Nachrichten-Agentur "DPA" rechnet die Fraktionsspitze mit den Attacken von Veit auf die konservative und bei den letzten Wahlen mit +2,2 % erfolgreiche Partei ab.
Der Fraktionsvorsitzende der "blauen" Fraktion, Dirk Nockemann, erklärte gegenüber den Medien: „In dem Bestreben, als Parlamentspräsidentin wiedergewählt zu werden, wirft Frau Veit jetzt weitere Grundsätze einer neutralen und unparteilichen Amtsführung über Bord. Mit AfD-Bashing will sie wohl ihre Chancen verbessern, erneut Parlamentspräsidentin zu werden."
In einer ausführlichen Gegendarstellung zerflückt die AfD-Fraktionsspitze die einzelnen Vorwürfe und Verdrehungen der gelernten Juristin und zerlegt die Zensurattacken der früheren Berufskollegin von Hamburger Richtern und Staatsanwälten, die über ihre dienstlichen E-Mail-Accounts gegen die AfD gehetzt haben.
Die Konservativen sprechen im Zusammenhang mit dem geschwärztem Antrag zu hetzenden Richtern und Staatsanwälten: "In diesemm konkreten Fall versucht die der Bürgerschaftskanzlei vorstehende Präsidentin durch Zensurmaßnahmen die parlamentarische Willensbildung zu beeinträchtigen und die öffentliche Willensbildung gänzlich zu unterbinden."
Die Namen der betroffenen Richter wurden in der entsprechende Drucksache geschwärzt, und auch der Mitschnitt einer Rede eines AfD-Abgeordneten, in denen er die in der Drucksache erwähnten Richter beim Namen nennt, wurden nachträglich manipuliert, sodass sich die Öffentlichkeit nicht frei und ungehindert über die Geschehnisse im Parlament unterrichten kann. Auch die an den Antrag angehängten Beweismittel wurden zensiert. Die konservativen Abgeordneten bringen auf den Punkt: "Frau Veit behauptet, dass es sich bei ihren Maßnahmen nicht um Zensur handele. Dies ist offensichtlich falsch. Zensur ist die „von zuständiger, besonders staatlicher Stelle vorgenommene Kontrolle, Überprüfung von Briefen, Druckwerken, Filmen o. ä., besonders auf politische, gesetzliche, sittliche oder religiöse Konformität“ (Duden). Um einen solchen Fall handelt es sich hier, wenn Texte geschwärzt und Bestandteile der Reden von Abgeordneten durch nachträgliche Manipulation von Videoaufzeichnungen unterdrückt werden.
In der Gegendarstellung der AfD heißt es zusammenfassend: "Frau Veit möchte erneut zur Bürgerschaftspräsidentin gewählt werden. Offenbar hält sie es für eine kluge Taktik, im Vorfeld der Wahl ihre Stellung als Parlamentspräsidentin gezielt einzusetzen. Dabei macht sie öffentlich Stimmung gegen eine Oppositionsfraktion und geriert sich als Kämpferin gegen die Alternative für Deutschland".
Die Hamburger Abgeordneten Nockemann, Walczak und Schulz pointieren: "Anders als die Machtkritik einer Oppositionsfraktion delegitimiert jedoch diese Instrumentalisierung ihres Amtes für den politischen Meinungskampf tatsächlich staatliche Institutionen und das Amt einer Parlamentspräsidentin."
-
Linke Bürgerschaftspräsidentin Veit verlässt jegliche Neutralität und droht AfD-Abgeordneten.
 |
Hamburgs linke Parlamentspräsidentin geht frontal auf die AfD los.
(Foto: Hamburger Bürgerschaft) |
Hamburg, 13.03.2025: Die scheidende SPD-Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit zieht nach der Schwärzung eines AfD-Antrags und des Ausblendens von Textstellen einer AfD-Rede in der Hamburgischen Bürgerschaft nun frontal und medial gegen die mit 7,5 % um 2,2 % stärkere AfD im Parlament zu Felde. Nachdem sie durch die Bürgerschaftskanzlei die Namen von Hamburger Richtern und Staatsanwälten mit fadenscheinigen Datenschutz-Argumenten schwärzen bzw. ausblenden lies, kritisierte die AfD-Fraktion die linke Politikerin öffentlich für den Schutz der die AfD in Dienst-E-Mails verunglimpfenden Richter.
Nun attackiert Veit gegenüber der - mit Millionenbeträgen durch die Bundesregierung finanzierten - Nachrichtenagentur "DPA" die AfD mit einer Schuldumkehr: "Es geht in Richtung Demontage unserer Demokratie", wirft die umstrittene Sozialdemokratin der konservativen Fraktion vor, um die von ihr der Parlamentskanzlei befohlenen Schwärzungen und Ausblendungen politisch verteidigen zu können. Der parlamentarische Geschäftsführer der AfD - Krzysztof Walczak - hatte Veit und ihren Mitarbeitern zuvor ein "rückschrittliches Demokratieverständnis ungefähr auf dem Stand des frühen 19. Jahrhunderts" vorgeworfen.
Walczak hatte zudem die agierenden Mitarbeiter der linken Parlamentspräsidentin "fehlende Rechtstreue, Zensur und letztlich mangelnde Einstellung zu ihrer Tätigkeit und zur Demokratie" vorgehalten. Mit dem gezielten DPA-Interview schlägt Veit nun ihre Neutralität aufgebend mit manipulativen Argumenten und Schuldumkehr zurück: "Das ist eine gezielte Verunglimpfung des demokratischen Systems, mit der Verunsicherung geschaffen und der Staat und seine Organe delegitimiert und destabilisiert werden sollen.»
Um weitere Schuld gegen die AfD-Fraktion zu produzieren, sprach Veit von Verunsicherung ihrer Mitarbeiter, nachdem die AfD diese für die illegitimen Schwärzungen und Ausblendungen öffentlich zur Rechenschaft zog. Zu ihrer Verteidigung benutzte Veit erneut die Totschlag-Argumente "Datenschutz" und "Persönlichkeitsrechte". Zudem versucht Veit, die nun 10 Abgeordneten der konservativen Fraktion noch vor dem Zusammentreten des neuen Landesparlaments zu bedrohen, in dem diese "sehr gezielt beobachtet" werden sollen.
Hintergrund der Debatte sind im Verdacht stehende parteipolitische Verunglimpfungen durch Hamburger Richter und Staatsanwälte gegen die AfD - und dies über ihre dienstlichen E-Mail-Konten. Aus Sicht der AfD liegen Verstöße gegen die Verfassung vor. Die Partei forderte dazu Stellungnahmen der dafür verantwortlichen Richter, um den Sachverhalt zu prüfen.
Die Verfassung gibt dem Parlament hierfür eine Zuständigkeit in Form der Richteranklage, die öffentlich und nur unter Nennung der Namen der betroffenen Richter erfolgen kann. Dies will die SPD-Politikerin Veit offenbar mit allen Mitteln und Methoden einschl. Schuldumkehr versuchen, zu verhindern. Die angreifbar zensierte Rede zu den Verunglimpfungen durch Hamburger Richter und Staatsanwälte kann auf den Seiten der Bürgerschaft angehört werden. -
Niederträchig agierende Göttinger Staatsanwälte greifen jetzt auch direkt AfD-Abgeordnete an.
 |
Diese Göttinger Staatsanwälte verfolgen politische Kritiker und AfD-Politiker. (Foto: CBS/60 Minutes, Screenshot: HANSEVALLEY) |
Hannover, 13.03.2025: Die Göttinger "Petz- und Denunziations-Behörde" ZHIN bei der örtlichen Staatsanwaltschaft geht jetzt nicht mehr nur gegen kritische Kommentare von Niedersachsen in Sozialen Medien vor. Die insgesamt neun politische von der rot-grünen Landesregierung gesteuerten Staatsanwälte und Ermittler greifen jetzt auch die niedersächsische Familienpolitikerin und AfD-Landtagsabgeordnete Vanessa Behrendt direkt juristisch an.
Der Vorwurf der - durch die US-Fernsehreportage "60 Minutes" des Senders "CBS" - unrühmlich bekannt gewordenen und vor laufender Kamera "niederträchtig" kicherenden und sich über verfolgte System-Kritiker schadenfroh freuenden - Staatsbediensteten werfen der konservativen Helmstedter Abgeordneten ernsthaft "Volksverhetzung" vor. Auslöser für die Verfolgung der politisch nicht genehmen Politikerin war ein Kommentar von Behrendt auf dem Netzwerk X.
Darin bezeichnete sie die sogenannte "Regenbogenfahne" als Symbol für die Gefährdung von Kindern durch pädophile Lobbygruppen und LGBTQ-Propaganda. Vanessa Behrendt erklärte gegenüber den Medien: „Wenn der Einsatz für den Schutz von Kindern vor sexuellem Missbrauch und schädlicher LGBTQ-Propaganda als angebliche Volksverhetzung dargestellt wird, zeigt das einmal mehr den bedenklichen Zustand der Meinungsfreiheit in diesem Land und das politische Agieren der weisungsgebundenen Staatsanwaltschaft der Göttinger Zentralstelle zur Bekämpfung von Hasskriminalität im Internet."
Dieses Verfahren dient eindeutig dem Zweck, die politische Opposition und mich persönlich einzuschüchtern. Meine Kritik an der Regenbogenfahne ist, gemäß Artikel 5 des Grundgesetzes, eine vollständig zulässige Meinungsäußerung. Nach diesem Artikel hat jeder das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten. Gerade für frei gewählte Abgeordnete des Landtages muss dies doch insbesondere gelten."
Die Helmstedterin macht klar: Ich lasse mich jedoch nicht durch ein offensichtlich politisch motiviertes Verfahren der zu Recht in der Kritik stehenden Zentralstelle zur Bekämpfung von Hasskriminalität im Internet einschüchtern und werde weiterhin für die Rechte von Kindern und Familien in diesem Land kämpfen.
Zudem habe ich großes Vertrauen in die niedersächsische Justiz. Der politische Einsatz für den Schutz der Schwächsten in unserer Gesellschaft kann in einer Demokratie nicht ernsthaft durch ein offensichtlich politisch motiviertes Verfahren sanktioniert werden. Daher bin ich fest davon überzeugt, dass das Verfahren eingestellt wird und sehe dem mit Gelassenheit entgegen.“
Der Kölner Medienanwalt Markus Haintz hatte Ende Februar d. J. gegen die international scharf kritisierten, politisch abhängigen Staatsanwälte und ihr Verhalten als "hässliche Deutsche" eine offizielle Dienstaufsichtsbeschwerde bei der zuständigen Staatsanwaltschaft der südniedersächsischen Universitätsstadt eingeleitet. Markus Heintz schreibt in seiner Beschwerde: "Sie verhöhnen damit die Menschen, die Opfer von (unverhältnismäßigen) Hausdurchuchungen werden. Ein solches Verhalten von Staatsbediensteten und Organen der Rechtspflege ist nicht zu tolerieren."
Eine weitergehende Stellungnahme des SPD-geführten Justizministeriums mit der Ankündigung der Fortsetzung von Verfolgungen kritischer Internet-Nutzer kann in einer AFP-Meldung nachgelesen werden. Offensichtlich versucht die linke Landesregierung durch Anklagen ihrer Göttinger Gesinnungsverfolger auch verhasste Politiker direkt zu verfolgen. -
Blanke Angst in Bramfeld:
"Absolut arroganter" Online-Händler Otto-Versand schmeisst bis zu 1.000 Mitarbeiter raus.
 |
Otto.de ist nicht nur "Under Construction". Hier wird jetzt abgerissen.
(Grafik: Otto.de, Foto: HANSEVALLEY) |
Hamburg, 10.03.2025: Beim Bramfelder Distanzhändler "Otto.de" wird jetzt radikal der Rotstift angesetzt. Nachdem bis Ende August d. J. kurzfristig 480 Arbeitsplätze in insgesamt 8 der 13 eigenen Call-Center des angeschlagenen Versandhändlers ersatzlos gestrichen werden, geht der Kahlschlag bei dem - in der Branche als "absolut arroganten" Online-Händler" bekannten - Versender jetzt erst richtig los.
Bereits im neuen Geschäftsjahr 2026/2027 müssen insgesamt 80 Mio. € Kosten runter - und das dauerhaft, verkündete "Otto.de"-Vorstand Marc Oppelt in einem internen Schreiben. Unter dem hochtrabenden Titel "Elevate - Ottos Weg zu Wachstum und Kosteneffizienz" verkündet der aus eigenem Verschulden gegen "Amazon", "Temu" & Co. nur eingeschränkt wettbewerbsfähige Ex-Katalog-Versender den radikalen Exitus beim letzten Universal-Großversender aus Deutschland. Ab 2027 soll es voll ans Eigenmachte gehen.
Insgesamt stehen laut Informationen der "Hamburger Morgenpost" bis zu 1.000 Jobs auf der Streichliste."Niemand weiß, welche Bereiche und welche Mitarbeiter es treffen wird. Die Belegschaft ist total verunsichert, fast jeder hat Angst, entlassen zu werden", beschreibt ein leitender Angestellter die blanke Angst auf dem "Otto"-Campus in Bramfeld nach der Ankündigung des verharmlosenden "Sanierungsprogramms".
Betriebsrat Michael Hufnagel bringt auf den Punkt: Hinter ständigen Kosteneinsparungsprogrammen stecke eine Unternehmenspolitik "ohne klaren Kurs", die schon jetzt in vielen Bereichen des Unternehmens zu "Verzweiflung über ständig zunehmende Arbeitsverdichtung" führe, so der Gewerkschafter zur "Mopo". Eine der schwersten Fehlentscheidungen ist die Gier der Eigentümer-Familie Otto, Umsätze allein für sich zu behalten, und deshalb erst im Sommer 2020 ein Marktplatz-Geschäft zugelassen hat - 21 Jahre nach Amazon in Deutschland.
"Otto" steckt seit mehr als 2 Jahren mit dreistelligen Millionenbeträgen in den roten Zahlen und das Eigengeschäft mit als teuer geltenden Angeboten hinkt seit dem Ende der Corona-Pandemie massiv Wettbewerbern wie "Amazon" hinterher. Im Dezember hatte der Hamburger Familienbetrieb mitgeteilt, sein junges Bekleidungsunternehmen "About You" an den Berliner Konkurrenten "Zalando" zu verkaufen. Aus den Millionen-Einnahmen soll auch die Sanierung der "Otto"-Handelssparte mitfinanziert werden.
-
AfD-Fraktion Hamburg klagt Bürgerschaftspräsidentin wegen Zensur von öffentlicher Rede an.
 |
In der Hamburger Bürgerschaft regiert eine offenbar undemokratische SPD-Frau.
Foto: Hamburgische Bürgerschaft |
Hamburg, 03.03.2025: In der letzten Bürgerschaftssitzung der Legislaturperiode wurde die Rede des AfD-Abgeordneten Krzysztof Walczak an mehreren Stellen mit Pieptönen zensiert. Hintergrund der Debatte sind im Verdacht stehende parteipolitische Aussagen von Hamburger Richtern und Staatsanwälten gegen die AfD über ihre dienstlichen E-Mail-Konten. Aus Sicht der AfD liegen Verstöße gegen die Verfassung vor. Die AfD forderte dazu Stellungnahmen der dafür verantwortlichen Richter, um den Sachverhalt zu prüfen. Die Verfassung gibt dem Parlament hierfür eine Zuständigkeit in Form der Richteranklage, die öffentlich und nur unter Nennung der Namen der betroffenen Richter erfolgen könnte.
Der Parlamentarische Geschäftsführer Krzysztof Walczak erklärte: „Nicht selten werden unsere Anfragen und Anträge von der Bürgerschaftspräsidentin und der Bürgerschaftskanzlei mit Schwärzungen zensiert. Das ist schlimm genug. Dass nun sogar eine Rede kurz vor der Bürgerschaftswahl zensiert wurde, ist unerträglich und undemokratisch.
Dabei sind wahrheitsgetreue Aufzeichnungen und Berichte von Parlamentssitzungen ausdrücklich durch die Verfassung aufgrund der Erfahrungen im Absolutismus mit staatlicher Zensur geschützt; auch in Hamburg in Artikel 16 der Landesverfassung. Derartige Zensurmaßnahmen belegen ein rückschrittliches Demokratieverständnis ungefähr auf dem Stand des frühen 19. Jahrhunderts.
-
AfD Niedersachsen fordert Abwicklung der "Denunziationsbehörde" ZHIN der Staatsanwaltschaft Göttingen.
 |
Schadenfroh lachende und kichernde Staatsanwälte der ZHIN in Göttingen.
Bild: CBS/60 Minutes, Screenshot: HANSEVALLEY |
Hannover, 28.02.2025: Die AfD-Fraktion im Niedersächsischen Landtag fordert die sofortige Auflösung der Meldestelle und "Petz-Behörde" ZHIN bei der Staatsanwaltschaft in Göttingen. Auslöser für die geforderte Schließung der Abteilung mit neun Ermittlern und rd. 3.500 Fällen pro Jahr ist das "niederträchtige" Verhalten der drei weltweit bekannt gewordenen Staatsanwälte bei der Aufzeichnung eines Interviews der "CBS"-Reportage-Sendung "60 Minutes".
Dabei ging es um die Verfolgung von Niedersächsischen Internetnutzern, deren kritischer Äußerungen in Social-Media-Kanälen und ihre Verfolgung mit Hausdurchsuchungen und Beschlagnahmungen Ende November '24.
AfD-Fraktionsvorsitzender Stephan Bothe sagte in der Aktuellen Stunde zu den drei "hämisch lästernden" Staatsanwälten der politisch agierenden Göttinger "Petz-Behörde" ZHIN anlässlich der CBS-Reportage mit Bildern von Hausdurchsuchungen und Beschlagnahmungen am 11. bundesweiten Aktionstag gegen "Hasspostings" und ihrer Verteidigung durch SPD-Innenministerin Bettina Behrens:
"Dieses Verhalten von führenden Staatsanwälten in Niedersachsen ist nicht nur unangemessen ihrem Amt gegenüber, nein, es ist bosshaft und niederträchtig und damit völlig inakzeptabel." Der AfD-Landespolitiker weiter: "Zur Klarstellung: Selbstverständlich ist das Netz kein rechtsfreier Raum. Und bei schlimmsten Persönlichkeitsverletzungen oder inakzeptablen Volksverhetzungen müssen Strafverfolgungsbehörden ermitteln."
Bothe zusammenfassend: "Warum aber bei minderschweren Fällen Hausdurchsuchungen und Beschlagnahmungen benötigt werden, wenn es sich um öffentliche Posts handelt, zu klar zuzuordnenden Accounts, ist in den meisten Fällen völlig unnötig."
Der Fraktionsvorsitzende zur Forderung der Schließung: "Und damit ist die Frage, wozu wir dieses ZHIN in dieser Form wirklich brauchen mehr als berechtigt. Frau Ministerin Wahlmann: Kümmern wir uns doch endlich um die echten Verbrechen im Land. Was wir bestimmt nicht brauchen, ist eine Denunziationsbehörde, die an ganz dunkle Zeiten erinnert."
Bothe verwies auf den §188 StGB, der Politiker gegen Beleidigungen schützen soll ("Majestätsbeleidigung"). Bothe referenzierte auf mind. 500 Fälle staatsanwaltwaltschaftlicher Ermittlungen von Mitte '23 bis Mitte '24 allein in Niedersachsen durch die ZHIN - eine Verdoppelung gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Er kritisierte, dass die Rot-Grüne Landesregierung weder genaue Zahlen zu den politisch-motivierten Verfolgungen kennt und vorsichtshalber nicht einmal eine Statistik geführt wird.
SPD-Innenministerin Daniela Behrens hatte zuvor die "Bestrafungsaktionen" der Göttinger Staatsanwälte verteidigt und die wegen Missbrauchs im Amt mit einer Dienstaufsichtsbeschwerde belasteten Staatsanwälte in Schutz genommen. Nach ihrer Meinung sei es richtig, mit staatsanwaltschaftlichen Mitteln gegen "Hass und Hetze" vorzugehen, obwohl es dazu keine rechtliche Grundlage im Gesetz gibt.
AfD-Fraktionschef Bothe erwiderte die Meinung der Innenministerin im Landtag: "Diese Aussage der Innenministerin Behrens zum bundesweiten Aktionstag gegen sogenanntes "Hass-Posting" zeigt nicht nur eine totalitäre und radikale Grundhaltung, nein, diese Aussage macht auch deutlich, das es an dem Tag nicht vorrangig um Ermittlung potenzieller Straftäter ging, nein, an diesem Tag ging es um die Einschüchterung der Bürger in Niedersachsen und Deutschland."
Der Kölner Medienanwalt Markus Haintz hatte in der vergangenen Woche gegen die international scharf kritisierten, politisch abhängigen Staatsanwälte und ihr Verhalten als "hässliche Deutsche" eine offizielle Dienstaufsichtsbeschwerde bei der zuständigen Staatsanwaltschaft der südniedersächsischen Universitätsstadt eingeleitet. Markus Heintz schreibt in seiner Beschwerde: "Sie verhöhnen damit die Menschen, die Opfer von (unverhältnismäßigen) Hausdurchuchungen werden. Ein solches Verhalten von Staatsbediensteten und Organen der Rechtspflege ist nicht zu tolerieren."
Der Hamburger Medienanwalt Joachim Steinfhöfel ging mit den drei hämisch lachenden Staatsanwälten am Dienstag vergangener Woche hart ins Gericht. Der bekannte Jurist bezeichnete morgendliche, einschüchternde Hausdurchsuchungen mit Beschlagnahmungen als "Machtdemonstrationen des Staates". Dies mache man auch "mit einer gewissen Genugtuung und Freude an der verliehenen Macht". Gegenüber "Welt TV" sagte Steinhöfel zu den erkennbar "niederträchtigen Reaktionen" der Staatsanwälte:
"Wie sie sich freuen und wie sie kichern, dass Leuten ihr Handy weggenommen wird, so hämisch und niederträchtig. Was sind das für Menschen? Sie sollen die Meinungsfreiheit und Persönlichkeitsrechte verteidigen und auch zugunsten des Beschuldigten ermitteln - und sie sitzen da und reiben sich die Hände, dass sie einen Menschen morgens um Sechs schockieren und einschüchtern können. Ist dass das Gesicht eines freiheitlichen Staates?"
Die SPD-Parlamentspräsidentin und langjährige AWO- und SPD-Funktionärin Hanna Judith Naber unterbrach die Rede des AfD-Fraktionsvorsitzenden mehrfach, erkennbar um die Rede zu stören, wie der Videomitschnitt zeigt. Die Rede des AfD-Spitzenpolitikers inkl. der politischen Störmanöver der SPD-Funktionärin kann auf "YouTube" abgerufen werden (ab (ca. 8:28) Die von US-Vizepräsident J. D. Vance als "Orwell" und "Irrsinn" öffentlich scharf kritisierte Situation in Deutschland kann in der 13 Minuten langen Reportage online auf den Seiten von "CBS News" ohne Bezahlschranke abgerufen werden. Eine weitergehende Stellungnahme des SPD-geführten Justizministeriums mit der Ankündigung der Fortsetzung von Verfolgungen kritischer Internet-Nutzer kann in einer AFP-Meldung nachgelesen werden. -
"Absolut arroganter" Online-Händler Otto-Versand will 80 Mio. € einsparen.
 |
Lange Zeit Millionen-Verluste kleingeredet. Jetzt kommen die Millionen-Einsparungen.
Grafik: Otto.de |
Hamburg, 24.02.2025: Das seit seit Jahren rückgängige Geschäft als deutscher Online-Händler, das schwache Weihnachtsgeschäft '24 und der scharfe Wettbewerb mit amerikanischen une chinesischen Marktplätzen sorgt beim noch größten deutschen Versender "Otto.de" für einen weiter verschärften Sparkurs. Im kommenden Geschäftsjahr müssen die Bramfelder 80 Mio. € einsparen.
Gegenüber dem "Hamburger Abendblatt" bestätigte ein Otto.de-Sprecher die nach Jahren des Schönredens erforderliche Rotstiftpolitik: „Wir müssen uns mit Blick auf die aktuelle Marktsituation in den kommenden Jahren finanziell robuster aufstellen, und das bedeutet auch Kostenanpassungen und die Optimierung von Prozessen über die Entscheidungen zu den Kundencentern hinaus.“
Kurzfristig werden 480 Arbeitsplätze in insgesamt 8 der 13 Call-Center des angeschlagenen Versandhändlers ersatzlos gestrichen. Dies betrifft die Standorte Alzenau, Bad Salzuflen, Bochum, Niederzier, Kassel, Nürnberg, Leipzig und Stuttgart. Sie werden bis Ende August d. J. dicht gemacht. Übrig bleiben die Call-Center in Dresden, Erfurt, Hamburg, Magdeburg und Neubrandenburg mit rd. 700 Mitarbeitern.
Als Begründung für den kurzfristigen Stellenabbau in den Call-Centern nennt die "Otto"-PR ein verändertes Nutzungverhalten. Es würden immer weniger Telefonate mit dem Kundendienst geführt. Die Zahl der Kundenanrufe sank in den vergangenen fünf Jahren nach Otto-eigenen Angaben um 30 %, die Zahl der Bestellungen via Telefon um 80 %. Damit ist das Telefon kein lukrativer Vertriebskanal mehr für "Otto.de".
„In wirtschaftlich unsicheren Zeiten überlegen Verbraucherinnen und Verbraucher genauer, was wann zu welchem Preis gekauft wird. Insbesondere für größere Anschaffungen werden Preise länger beobachtet und die Menschen warten auf Rabattaktionen“, sagt Bitkom-Hauptgeschäftsführer Bernhard Rohleder als Reaktion des schwachen Weihnachtsgeschäfts 2024.
"Otto" steckt seit mehr als 2 Jahren mit dreistelligen Millionenbeträgen in den roten Zahlen und das Eigengeschäft des erst 2020 zum Marktplatz erweiterten Online-Händlers hinkt seit dem Ende der Corona-Pandemie massiv Wettbewerbern wie "Amazon" hinterher. Im Dezember hatte der Hamburger Familienbetrieb mitgeteilt, sein junges Bekleidungsunternehmen "About You" an den Berliner Konkurrenten "Zalando" zu verkaufen. Aus den Millionen-Einnahmen soll auch die Sanierung der "Otto"-Handelssparte mitfinanziert werden.
-
Rot-grüne Minister in Hannover wollen weiter auch unschuldige Internet-Kritiker durch niederträchtig lachende Staatsanwälte in Göttingen mit Hausdurchsuchgungen verfolgen.
 |
Nach hämischem Gelächter muss sich die Politik vor die "Petz-Anwälte" stellen.
(Foto: CBS News/60 Minutes, Screenshot: HANSEVALLEY) |
Hannover, 21.02.2025: Nachdem US-Vizepräsident J.D. Vance die Justiz in Niedersachsen für ihr überzogenes Eingreifen im Zusammenhang mit häufig nicht justiziablen Meinungsäußerungen im Internet scharf kritisierte, haben das niedersächsische Innen- und das Justizministerium erklärt, man wolle doch "nur die Demokratie schützen".
Zugleich kündigten sie an, ihre Praxis u. a. mit Hausdurchsuchungen und Beschlagnahmungen weiter vorantreiben zu wollen. Anlass war eine weltweit für Aufsehen erregende Reportage des US-Fernsehsenders "CBS" über das Vorgehen der Göttinger Staatsanwaltschaft im Rahmen des von SPD-Bundesinnenministerin Nancy Faeser anberaumten „Aktionstags gegen Hasskriminalität im Netz“ im Dezember 2024. Ansgar Schledde, Vorsitzender der AfD Niedersachsen, erklärte zu den renitenten Erklärungen der Landesregierung in Hannover:
„Drei ‚Staatsdiener‘ amüsieren sich darüber, wie sie die Bürger für unbedachte Äußerungen im Internet tyrannisieren. Die CBS-Reportage muss jeden echten Demokraten zutiefst erschrecken. US-Vizepräsident J.D. Vance nennt es Wahnsinn, den jeder in Europa und den USA zurückweisen muss. Jemanden zu beleidigen, sei kein Verbrechen. Die Reaktion aus Behrens Innenministerium ist ganz im verschleiernden links-grünen Propaganda-Sprech gehalten.
Übersetzt heißt sie: Wir scheren uns keinen Deut darum, was wir den Menschen antun. Wer allzu deutlich die herrschenden Zustände kritisiert, muss mit drastischen Folgen rechnen. Politiker, die so denken, brauchen ebenfalls drastische Konsequenzen. Sie gehören schnellstmöglich aus jeder Position mit Verantwortung in unserer Demokratie entfernt. Am kommenden Wahlsonntag darf sich niemand diese Gelegenheit entgehen lassen.“
Der Kölner Medienanwalt Markus Haintz hat in dieser Woche gegen die international scharf kritisierten, politisch abhängigen Staatsanwälte und ihr Verhalten als "hässliche Deutsche" eine offizielle Dienstaufsichtsbeschwerde bei der zuständigen Staatsanwaltschaft der südniedersächsischen Universitätsstadt eingeleitet. Markus Heintz schreibt in seiner Beschwerde: "Sie verhöhnen damit die Menschen, die Opfer von (unverhältnismäßigen) Hausdurchuchungen werden. Ein solches Verhalten von Staatsbediensteten und Organen der Rechtspflege ist nicht zu tolerieren."
Der Hamburger Medienanwalt Joachim Steinfhöfel ging mit den drei hämisch lachenden Staatsanwälten am Dienstag d. W. hart ins Gericht. Der bekannte Jurist bezeichnete morgendliche, einschüchternde Hausdurchsuchungen mit Beschlagnahmungen als Machtdemonstrationen des Staates. Dies mache man auch "mit einer gewissen Genugtuung und Freude an der verliehenen Macht". Gegenüber "Welt TV" sagte Steinhöfel zu den erkennbar "niederträchtigen Reaktionen der Staatsanwälte:
"Wie sie sich freuen und wie sie kichern, dass Leuten ihr Handy weggenommen wird, so hämisch und niederträchtig. Was sind das für Menschen? Sie sollen die Meinungsfreiheit und Persönlichkeitsrechte verteidigen und auch zugunsten des Beschuldigten ermitteln - und sie sitzen da und reiben sich die Hände, dass sie einen Menschen morgens um Sechs schockieren und einschüchtern können. Ist dass das Gesicht eines freiheitlichen Staates?"
Die "Internet-Petz-Behörde" ZHIN, die in Niedersachsen für die Verfolgung von echter und vermeintlicher Hasskriminalität im Netz ernannt wurde, verzeichnete seit dem Beginn ihrer Arbeit am 1. Juli 2020 u. a. aufgrund Ihres Online-Petz-Portals einen stetigen Anstieg der Verfahren. Von 1. Juli '23 bis zum 30. Juni '24 nahmen u. a. die drei wegen erkennbarer Häme und Schadenfreude in der Schusslinie stehenden Staatsanwälte mehr als 3.500 Ermittlungsverfahren auf, davon allein rd. 1.500 über ihr hauseigenes "Petz-Portal" – eine Steigerung von mehr als 60 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum 2022 bis 2023.
In mehr als 500 der gemeldeten Fälle wurden zwischen Mitte 2023 und Mitte 2024 gegen mutmaßliche Täter Anklage erhoben oder ein nach Möglichkeit abschreckender Strafbefehl mit möglichst hohen Tagessätzen beantragt. Das hohe Engagement der sich nun mit einer Dienstaufsichtsbeschwerde herumschlagenden Ankläger entspricht einer Verdopplung im Vergleich zum Vorjahr 22-23.
SPD-Justizministerin Kathrin Wahlmann lobte die Arbeit der ZHIN bereits zur Veröffentlichung des Zwischenberichts im September '24: „Die Zentralstelle zur Bekämpfung von Hass und Hetze im Internet ist die Speerspitze der Bekämpfung digitaler Gewalt in Niedersachsen. Nicht nur wird dort mit größter Expertise und höchster Konsequenz an der Verfolgung von Hasskriminalität im Netz gearbeitet – nun haben es die Kolleginnen und Kollegen auch innerhalb von kurzer Zeit geschafft, die neue rechtliche Möglichkeit der digitalen Strafantragsstellung technisch umzusetzen."
Die von US-Vizepräsident J. D. Vance als "Orwell" und "Irrsinn" öffentlich scharf kritisierte Situation in Deutschland kann in der 13 Minuten langen Reportage online auf den Seiten von "CBS News" ohne Bezahlschranke abgerufen werden. Eine weitergehende Stellungnahme des SPD-geführten Justizministeriums mit der Ankündigung der Fortsetzung von Verfolgungen kritischer Internet-Nutzer kann in einer AFP-Meldung nachgelesen werden. -
Nach Dienstaufsichtsbeschwerde aus Köln:
Hamburger Medienanwalt Steinhöfel nimmt schadenfreudig kichernde Göttinger Staatsanwälte auseinander.
 |
Die drei in der Schusslinie Staatsanwälte der Göttinger "Petz-Behörde"
(Foto: CBS News/60 Minutes, Sceenshot: HANSEVALLEY) |
Hamburg, 20.02.2025: Der unter anderem aus diversen Prozessen gegen "Facebook" bekannte Medienanwalt Joachim Steinhöfel geht mit den drei "schadenfreudig kiechernden" Staatsanwälten der "Petz- und Zensurbehörde" ZHIN in Göttingen hart ins Gericht. Der Hamburger Jurist bezeichnete morgendliche, einschüchternde Hausdurchsuchungen mit Beschlagsnahmungen als Machtdemonstrationen des Staates. Dies mache man auch "mit einer gewissen Genugtuung und Freude an der verliehenen Macht".
Gegenüber "Welt TV" sagte Steinhöfel am Dienstag d. W. zu den drei offensichtlich "niederträchtigen" Göttinger Staatsanwälten:
"Wie sie sich freuen und wie sie kichern, dass Leuten ihr Handy weggenommen wird, so hämisch und niederträchtig. Was sind das für Menschen? Sie sollen die Meinungsfreiheit und Persönlichkeitsrechte verteidigen und auch zugunsten des Beschuldigten ermitteln - und sie sitzen da und reiben sich die Hände, dass sie einen Menschen morgens um Sechs schockieren und einschüchtern können. Ist dass das Gesicht eines freiheitlichen Staates?"
Der Kölner Medienanwalt Markus Haintz hat gegen die international scharf kritisierten, politisch abhängigen Staatsanwälte und ihr Verhalten als "hässliche Deutsche" eine offizielle Dienstaufsichtsbeschwerde bei der zuständigen Staatsanwaltschaft der südniedersächsischen Universitätsstadt eingeleitet.
Markus Heintz schreibt in seiner Beschwerde: "Sie verhöhnen damit die Menschen, die Opfer von (unverhältnismäßigen) Hausdurchuchungen werden. Ein solches Verhalten von Staatsbediensteten und Organen der Rechtspflege ist nicht zu tolerieren."
Die drei in der "CBS News"-Produktion "60 Minutes" über verfolgte Einwohner Niedersachsens - im Rahmen eines bundesweiten von SPD-Innenministerin Nancy Faeser angeordneten Aktionstages - und die Beschlagnahmung von Laptops und Smartphones hämisch lachenden Beamte sind die drei Göttinger Staatsanwälte (von links nach rechts):
- die Staatsanwältin Svenja Meininghaus
- der Staatsanwalt Dr. Matthäus Fink und
- der Oberstaatsanwalt und stv. Pressesprecher Frank-Michael Laue.
Aus Angst vor weitergehenden Konsequenzen zu Lasten der drei erkennbar schadenfroh reagierenden Göttinger Staatsanwälte wurde ihre persönliche Vorstellung auf der Seite der niedersächsischen "Zentralstelle zur Bekämpfung von Hasskriminalität im Internet" kurzerhand abgeschaltet.
Verantwortlich für den Betrieb der "Zentralstelle zur Bekämpfung von Hasskriminalität im Internet" ist die Niedersächsische SPD-Justizministerin Kathrin Wahlmann. Die Zentralstelle "ZHIN" wurde 2020 im SPD-regierten Niedersachsen eingerichtet. In einer Zwischenbilanz stellte der ebenfalls wegen Gelächter im Rampenlicht stehende Oberstaatsanwalt Laue 2021 fest:
-
Autoriär agierende Hamburger Bürgerschaftskanzlei zensiert Beweise über hetzende Richter und Staatsanwälte.
 |
Die Kanzlei der Bürgerschaft macht sich gerade der möglichen Vertuschung schuldig.
(Foto: Michael Zapf, HHBUE) |
Hamburg, 19.02.2025: Nach dem Bekanntwerden von E-Mails mehrerer Hamburger Richter und Staatsanwälte und ihrer dienstlichen E-Mails, in denen sie herablassend über die AfD herzogen, fordert die AfD nun jursitische Konsequenzen. Die AfD-Fraktion beantragt, den Verdacht eines Verstoßes gegen Verfassungsgrundsätze durch Hamburger Richter und Staatsanwälte aufzuklären.
Zunächst sollen die betreffenden Richter Gelegenheit erhalten, binnen 14 Tagen Stellung zu nehmen, um mögliche Verstöße gegen Grundsätze des Grundgesetzes, insbesondere der richterlichen Unabhängigkeit, aufzuklären. Richter, die gegen Grundsätze des Grundgesetzes verstoßen, können von der Bürgerschaft vor dem Bundesverfassungsgericht angeklagt werden.
Den entsprechenden Antrag (Drs. 22/18040) sowie die Beweismittel hierzu hat die laut AfD zunehmend autoritär agierende Bürgerschaftskanzlei, die der SPD-Präsidentin der Bürgerschaft untersteht, ohne nähere Begründung und mit pauschalen Totschlagargument auf den Datenschutz, zensiert. Die AfD-Fraktion hat die Bürgerschaftskanzlei aufgefordert, eine angemessene Begründung für ihre Zensurmaßnahme bis heute nachzuliefern. Des Weiteren wurde die Bürgerschaftskanzlei aufgefordert, darzulegen, wie die Abgeordneten der Bürgerschaft unzensiert von den Inhalten des Antrags und der Beweismittel Kenntnis nehmen können. Der Parlamentarische Geschäftsführer der AfD in der Hamburgischen Bürgerschaft, Krzysztof Walczak, erklärte:
"Wenn strukturelle Zweifel an der Unabhängigkeit der Justiz aufgrund der parteipolitischen Agitation mehrerer Hamburger Richter und Staatsanwälte über dienstliche E-Mail-Konten aufkommen, wird das Vertrauen in die Justiz nachhaltig erschüttert. Das dürfen wir gerade in Zeiten von zunehmender Politikverdrossenheit und Misstrauen in den Staat nicht zulassen. Unser Rechtsstaat muss vor potenziellen Verfassungsbrechern geschützt werden, egal ob sie eine Robe tragen oder nicht. In der Justiz ist kein Platz für parteipolitische Hetze."
Der Hamburger Politiker weiter: "Zu einem rechtsstaatlichen Verfahren, das wohl einige Richter der AfD gemessen an ihren Äußerungen am liebsten absprechen würden, gehört es aber auch dazu, die Betroffenen zunächst anzuhören und ihnen die Möglichkeit zu geben, den Verdacht gegen Sie auszuräumen. Daher veröffentlichen wir die schlimmsten hetzerischen Aussagen der betroffenen Richter in unserem Antrag, geben aber im besten rechtsstaatlichen und demokratischen Sinne die Möglichkeit, sich hiergegen zu verteidigen. Wir fordern von den Urhebern dieser Aussagen eine Stellungnahme, um mögliche Grundgesetzverstöße aufzuklären.“
Hintergrund: Anfang Februar d. J. sollte in Hamburg eine Podiumsdiskussion stattfinden, zu der sowohl der Hamburgische Richterverein als auch der Hamburgische Anwaltverein eingeladen hatten. Die Einladung eines AfD-Politikers sorgte für massive Kritik aus linken Kreisen – die Veranstaltung wurde in der Folge abgesagt.
Medien berichteten im Anschluss, dass hetzerische Anti-AfD-Äußerungen über dienstliche E-Mail-Konten von Richtern und Staatsanwälten liefen und Druck ausübten, damit die Veranstaltung abgesagt wird. Der Antrag der AfD-Fraktion mit den schlimmsten Äußerungen der Richter und Staatsanwälte kann hier nachgelesen werden. -
Medienanwalt geht gegen Göttinger Staatsanwälte wegen Verhöhnung von Verfolgten ihrer "Petz-Behörde" vor.
 |
Ihre hämische Lache ging um die Welt. Jetzt stehen sie im Feuer.
(Screenshots: @Haintz_MediaLaw, Netzwerk X) |
Göttingen, 19.02.2025: Die drei in der amerikanischen "CBS News"-Produktion "60 Minutes" über verfolgte Bundesbürger und die Beschlagnahmung ihrer Laptops und Smartphones vor laufender Kamera hämisch lachenden Beamte sind die drei Göttinger Staatsanwälte (on air von links nach rechts):
- die Staatsanwältin Svenja Meininghaus
- der Staatsanwalt Dr. Matthäus Fink und
- der Oberstaatsanwalt und stv. Pressesprecher Frank-Michael Laue.
Aus Angst vor weitergehenden Konsequenzen zu Lasten der drei erkennbar schadenfroh reagierenden Göttinger Staatsanwälte wurde ihre persönliche Vorstellung auf der Seite der niedersächsischen "Zentralstelle zur Bekämpfung von Hasskriminalität im Internet" kurzerhand abgeschaltet.
Der Kölner Medienanwalt Markus Haintz hat gegen die international scharf kritisierten, politisch abhängigen Staatsanwälte und ihr Verhalten als "hässliche Deutsche" eine offizielle Dienstaufsichtsbeschwerde bei der zuständigen Staatsanwaltschaft der südniedersächsischen Universitätsstadt eingeleitet.
Markus Heintz schreibt in seiner Beschwerde: "Sie verhöhnen damit die Menschen, die Opfer von (unverhältnismäßigen) Hausdurchuchungen werden. Ein solches Verhalten von Staatsbediensteten und Organen der Rechtspflege ist nicht zu tolerieren."
Der Medienexperte begründet seine Beschwerde weitergehend auf dem Netzwerk X: "Die drei politisch abhängigen Beamten hatten sich in der weltweit bekannten und äußerst reichweitenstarken US-Sendung 60 Minutes auf CBS dreist lachend darüber amüsiert, dass Bürger geschockt sind, wenn man deren Handys beschlagnahmt.
Die Verhöhnung von Menschen, die Opfer von meist unverhältnismäßigen und häufig auch schlicht rechtswidrigen Hausdurchsuchungen und Beschlagnahmen werden, ist für staatliche Organe der Rechtspflege völlig inakzeptabel und muss dienstrechtliche Schritte nach sich ziehen."
FDP-Vize und Rechtsanwalt Wolfgang Kubicki aus Schleswig-Holstein erklärte gegenüber "Bild": "Wer im Angesicht dieser Bilder noch gut schlafen kann, dem sind die Grundrechte offensichtlich egal. Die Freiheit der Meinung ist die Grundlage der Freiheit überhaupt und darf nicht so leichtfertig eingeschränkt werden.“
Verantwortlich für die Einrichtung der "Zentralstelle zur Bekämpfung von Hasskriminalität im Internet" ist die Niedersächsische SPD-Justizministerin Kathrin Wahlmann. Die Zentralstelle "ZHIN" wurde 2020 im SPD-regierten Niedersachsen eingerichtet. In einer Zwischenbilanz stellte der ebenfalls wegen Gelächter im Rampenlicht stehende Oberstaatsanwalt Laue 2021 fest:
Die von US-Vizepräsident J. D. Vance als "Orwell" und "Irrsinn" öffentlich scharf kritisierte Situation in Deutschland kann in der 13 Minuten langen Reportage online auf den Seiten von "CBS News" ohne Bezahlschranke abgerufen werden. -
HANSETECHTEST:
Passfotos von CEWE und DM? Aufgehangene App, fehlerhafte Passfotos, katastrophales Personal.
 |
Die CEWE- und DM-Passfoto-App.
Erst großen Wirbel machen und dann nicht liefern.
Screenshot: HANSEVALLEY |
Berlin, 14.02.2025: Das Hanse Digital Magazin HANSEVALLEY hat die unter den Markennamen "CEWE" und "DM" angebotene Passfoto-App für Android und iPhones getestet. Ergebnis: Die App ist unausgereift, der Online-KI-Abgleich hängt sich auf und der von "CEWE" bereitgestellte Passbild-Service gibt Bilder mit deutlicher Licht-Spiegelung in Brillengläsern als behördenkonform frei. Damit können Kunden des fast 10,- € teuren Angebots nicht sicher sein, dass die mit der App gemachten Passbilder von Bürgerämtern, Bürgerzentren bzw. Kundenzentren bei der Beantragung von Personalausweisen oder Reisepässen auch wirklich angenommen werden.
Die Kunden werden mit dem Preis von 10,- € für 6 Passbilder von "CEWE" zudem über den Tisch gezogen. Der identische Service in der von der Drogeriemarkt-Kette "DM" gelabelten "Fotoparadies"-App kostet nur knapp 6,- € - und damit satte 4,- € weniger als beim Oldenburger Fotodruck-Monoplisten. Neben der zweifelhaften Qualität der im Apple App- bzw. Google Play-Store lediglich mit 3,0 bzw. 3,3 von 5 Sternen schlecht bewerteten Passfoto-App lässt auch das Verhalten der Pressestelle von "CEWE" in Oldenburg zu wünschen übrig:
Zunächst wussten die Mitarbeiter nicht, wie die Abrechnung in der App funktioniert, dann verzögerte sich die Ausstellung eines Test-Gutscheins um einen ganzen Tag und schließlich verweigerte die Pressestelle unter dem Sport-Marketer Christian Wilbers einen kostenfreien Test mit Ausdruck des zweifelhaften Passbildes an einem Fotodruck-Automaten von "Budni", "DM", "Kaufland" und "Müller".
Dies wäre ohnehin nur schwer möglich gewesen, da in der ausgewählten "DM"-Filiale am Berliner Tauentzien nicht angelernte Kräfte den Fotoservice betreuen mussten. So dauerte es mehr als eine geschlagene halbe Stunde, bis aus dem Lager im Keller eine neue Rolle Fotopapier am Fototresen war und die von ihrer Filialleiterin allein gelassenen Mitarbeiterinnen nach diversen Versuchen den Fotodrucker wieder in Gang setzten.
Die leitende Mitarbeiterin pöbelte unseren Redakteur auf seinen Hinweis eines Pressetestes schließlich mit dem dahin gerotzten Satz "dann ist das halt so" kundenfeindlich herabwürdigend an. Die leitende Mitarbeiterin machte keine Anzeichen, ihren überforderten Mitarbeiterinnen am "Kodak"-Fotoservice zu helfen. Außer kontrollierenden Blicken und pampigen Kommentaren qualifizierte sich die Angestellte nicht als Leitungspersonal der Filiale.
Beim Test des Vor-Ort-Passbild-Services von "DM" in Verantwortung der überforderten Führungskraft ging schief, was schief gehen konnte: Zunächst wartete unser Redakteur eine Ewigkeit auf eine den Passbild-Computer (eine Box mit iPad, Fotolinse und Licht) bedienende Mitarbeiterin. Dieser machte sich schließlich auf Grund eines billigen Metallständers "Made in China" selbstständig. Drei Mitarbeiterinnen klebten die vermeintliche Profilösung anschließend mit Klebeband amateurhaft wieder zusammen.
Das abschließende Ergebnis der HANSETECHTESTS: Testurteil für die "CEWE" - und "DM"-Passfoto-App: "MANGELHAFT". Grund: fehlerhafte Passfotos, die als korrekt ausgeben wurden. Testurteil für den "DM"-Passfoto-Service vor Ort: "KATASTROPHAL". Die Redaktion des Hanse Digital Magazins rät von Passfoto-App und -Service der Firmen "CEWE" und "DM" dringend ab.
-
Hamburger Richter hetzen in internen Dienst-E-Mails gegen die AfD.
 |
Auch Richter des Oberlandesgerichts sollen intern gegen die AfD gehetzt haben.
(Foto: Christoph Braun, Lizenz: CCO 1.0) |
Hamburg, 12.02.2025: Gestern hat das österreichische "Freilich-Magazin" einen Artikel veröffentlicht, der mutmaßlich mehrere parteipolitische Aussagen von Hamburger Richtern und Staatsanwälten gegen die AfD dokumentiert. Die Aussagen stammen aus einem internen E-Mail-Leak, der der AfD-Bürgerschaftsfraktion vorliegt. Die E-Mails sind mutmaßlich von dienstlichen E-Mail-Konten der Freien und Hansestadt Hamburg abgesendet worden. Das Freilich-Magazin gibt an, dass bisher niemand die Authentizität der E-Mails bestreitet.
Der verfassungspolitische Sprecher der AfD-Bürgerschaftsfraktion und Parlamentarische Geschäftsführer, Krzysztof Walczak, erklärt: „Wenn es stimmt, dass mehrere Hamburger Richter, zum Teil sogar bis hinauf zum Landgericht oder Oberlandesgericht, über dienstliche E-Mail-Konten parteipolitische Hetze gegen eine legale und von der Verfassung geschützte Partei wie die AfD betrieben haben, dann ist das nichts anderes als ein Skandal. Das gesamte Vertrauen in die Judikative, die Unabhängigkeit der Justiz und den Rechtsstaat hängen davon ab, dass Richter sich in Ausübung ihres Amtes parteipolitisch neutral verhalten."
Der Hamburger AfD-Politiker weiter: "Richter haben in unserer Rechtsordnung weitgehende Machtbefugnisse, können Recht sprechen und Menschen sogar ins Gefängnis sperren. Wenn jeder Bürger nun aufgrund seiner Parteimitgliedschaft befürchten muss, von einem Richter abgelehnt und benachteiligt zu werden, begründet das nicht nur die Befangenheit im Einzelfall. Es erschüttert das Vertrauen in die Judikative und den Rechtsstaat insgesamt. Vor allem scheint es sich hierbei nicht um einen Einzelfall zu handeln, sondern gleich mehrere Hamburger Richter und Staatsanwälte zu betreffen. Gegen einen möglichen verfassungsfeindlichen Amtsmissbrauch muss mit allen verfassungsmäßigen Mitteln vorgegangen werden."
Der Hamburger Abgeordnete stellt klare Forderungen an die offenbar links-agitierenden Richter: "Von den betroffenen mutmaßlichen Urhebern dieser E-Mails erwarte ich, dass sie sich zum Vorwurf der Neutralitätspflichtverletzung im Amt umgehend äußern. Ich wiederhole: Sollte es zutreffen, dass über dienstliche E-Mail-Konten parteipolitische Hetze von Richtern gegen die AfD betrieben wurde, ist das nicht hinnehmbar. Es ist aus meiner Sicht Verfassungsbruch. Für diesen Fall sieht Artikel 63 Absatz 3 der Hamburger Landesverfassung vor, dass solche Richter vor dem Bundesverfassungsgericht angeklagt werden können. Wir prüfen derzeit, ob wir gegen die betroffenen Richter einen entsprechenden Antrag auf Richteranklage wegen Verfassungsbruchs in die Bürgerschaft einbringen.“
-
Rostocker Bürgerschaft stimmt gegen genderter Sprachpanscherei der links-ideologischen Bürgermeisterin.
 |
In der Hansestadt Rostock lehnt die Bürgerschaft Gendern strikt ab.
(Foto: Bundesanstalt für Wasserbau, Lizenz: CC BY-SA 4.0) |
Rostock, 04.02.2025: Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock gendert nicht mehr. Die Rostocker Bürgerschaft hat Mitte Januar d. J. entschieden, dass in der Außenkommunikation der Stadt keine Gendersternchen oder Sonderzeichen verwendet werden dürfen und stattdessen die amtlichen Rechtschreibregeln gelten. Der Beschluss bestätigt eine Entscheidung vom Dezember '24, die aufgrund eines Widerspruchs der links-ideologischen Oberbürgermeisterin Eva-Maria Kröger erneut diskutiert wurde.
Kröger könnte den Beschluss nun rechtlich vom Innenministerium prüfen lassen. Der Vorsitzende der CDU Mecklenburg-Vorpommern, Daniel Peters, erklärt hierzu:
„Die Entscheidung der Bürgerschaft deckt sich mit dem Wunsch einer großen Mehrheit der Gesellschaft: Die Menschen wollen keine Sprachpanscherei, sie lehnen es ab, wenn Worte absichtlich falsch geschrieben werden, um damit eine vermeintlich progressive gesellschaftliche Haltung zum Ausdruck zu bringen."
Es ist diese toxische Linksagenda von Landesregierung und Oberbürgermeisterin gegen die große Mehrheit der Bevölkerung, die nicht nur Verdruss schürt, sondern auch die Gesellschaft spaltet und letztlich das Erstarken des politisch rechten Randes bewirkt, sagt der CDU-Vorsitzende und Landtagsabgeordnete.
-
SPD-Schulbehörde lässt Hamburger Lehrer mit Tablets und Smartboards allein.
 |
Die GEW lässt die Arbeitsbedingungen der Hamburger Lehrer untersuchen.
Grafik: GEW Hamburg |
Hamburg, 29.01.2025: Die Gewerkschaft GEW in Hamburg hat in einem Arbeitspapier die digitale Ausstattung der weiterführenden Schulen rund um Alster und Elbe im Kontext zur beruflichen Belastung von Lehrkräften veröffentlicht. Ein Kernergebnis: Zwar sind Hamburgs Mittel- und Oberstufe mit Tablets, Smartboards & Co. besser ausgestattet, als der Bundesdurchschnitt. Bei Konzepten zur digitalen Vermittlung von Inhalten herrscht jedoch teilweise Chaos.
Hauptkritikpunkt der "Kooperationsstelle Hochschulen und Gewerkschaften" der Universität Göttingen, die für die GEW in Hamburg Lehrer befragt hat: Teilweeise fehlen Strategien zur Anwendung digitaler Technik, teilweise herrscht Ahnungslosigkeit bei der Einbindung der Lehrkräfte und teilweise fehlt schlicht der technische Support. Die Autorinnen und Autoren der Studie warnen in der Folge vor einer "digitalen Kluft" zwischen den Schulen.
Die befragten Lehrer werden noch konkreter: Der Einsatz digitaler Medien ist für Lehrkräfte oft eine zusätzliche Arbeitsbelastung, so die Studienergebnisse. "74 Prozent nehmen die Digitalisierung als zusätzliche Aufgabe, insofern auch als zusätzliche Arbeitsbelastung wahr", berichtet Studienleiter Frank Mußmann aus Göttingen. An zwei Drittel der Schulen herrscht keinerlei Klarheit darüber, wie digitales Lehren und Lernen überhaupt funktionieren soll. Hinzu kommen technische Probleme und fehlende Räume für die digitale Vermittlung von Inhalten.
Die Zwischenauswertung stammt aus Befragungen im Rahmen der Arbeitszeit- und Belastungsstudie von Hamburger Lehrern, die die GEW im Sommer d. J. vollständig vorstellen will. Die jetzt als Arbeitspapier veröffentlichte Stichprobe umfasst Ergebnisse von 925 befragten Lehrkräften an 118 weiterführenden Schulen der Hansestadt. Dabei nutzen mit 94 % die meisten der Lehrer täglich oder mindestens einmal in der Woche digitale Medien für den Unterricht.
Weitere Details zum Thema und die Forderungen, um die z. T. dramatischen Zustände abzustellen gibt es bei der GEW Hamburg. -
LKA und Polizei Niedersachsen in schweren Justizskandal verwickelt.
 |
Über den Ermittlungsbehörden in Hannover verdunkeln sich die Wolken.
(Foto: Lizenz: CC0, via Pxhere) |
Hannover, 14.01.2025: Die aktuelle Berichterstattung zu einer Razzia bei einer IT-Firma, die im Zusammenhang mit den Ermittlungen gegen einen mutmaßlich korrupten Staatsanwalt aus Hannover stehen soll, kommentiert die Parlamentarische Geschäftsführerin der CDU-Fraktion im Niedersächsischen Landtag, Carina Hermann, wie folgt:
„Die neuen Entwicklungen in diesem Justizskandal sind zutiefst beunruhigend. Besonders brisant ist die offenbar jahrelange Zusammenarbeit der durchsuchten IT-Firma mit der Zentralen Polizeidirektion Niedersachsen und dem LKA. Wenn eine Firma, die von einem verurteilten Mitglied einer Kokainbande gegründet wurde, regelmäßig Verträge mit zentralen Polizeibehörden des Landes erhalten konnte, wirft das schwerwiegende Fragen zur Vergabepraxis und zu den Sicherheitsstandards in Niedersachsen auf."
Die Christdemokratin weiter: "Es stellt sich im Zusammenhang mit dem Gesamtkomplex rund um den mutmaßlich korrupten Staatsanwalt zudem die dringende Frage, welche weiteren Sicherheitslücken bestehen und was möglicherweise noch im Verborgenen liegt. All das sind sehr ernste Vorgänge. Ministerin Wahlmann hat bislang behauptet, es gäbe keinen Skandal. Sollte sich jedoch herausstellen, dass bei der Vergabe von Aufträgen bewusst Sicherheitsrisiken in Kauf genommen oder jedenfalls fahrlässig verkannt wurden, wird diese Einschätzung nicht haltbar sein."
Die Göttinger Abgeordnete bringt auf den Punkt: "Darüber hinaus müssen auch die Rolle des ehemaligen Innenministers Pistorius sowie der aktuellen Innenministerin Behrens kritisch beleuchtet werden. Es muss jetzt unverzüglich aufgeklärt werden, ob die öffentlichen Hinweise auf mögliche Unregelmäßigkeiten und Maulwürfe bei der Polizei seitens des Innenministeriums ausreichend verfolgt wurden.
Ebenso muss die Landesregierung erklären, wann mit der heute durchsuchten Firma Verträge über welche konkreten Dienstleistungen geschlossen und wann diese beendet wurden. Das Innen- und das Justizministerium stehen in der Verantwortung, diese Vorgänge schnellstmöglich und vollständig darzulegen und dafür Sorge zu tragen, dass die niedersächsischen Strafermittlungsbehörden keinen weiteren Schaden nehmen.“
-
"Lügenbarone" von ARD-aktuell wollen zu politisch manipulierenden Faktencheckern werden.
 |
Ausgewählte Beispiele von Tagesschau-Falschinformationen.
Quelle: ÖRR-Blog |
Hamburg, 09.01.2025: Die in den vergangenen mehr als drei Jahren rot-grüner Bundesregierung politisch zunehmend einseitig berichtende Redaktion von "ARD-aktuell" mit "Tagesschau", "Tagesthemen" und "Nachtmagazin" sowie den Digitalangeboten von "Tagesschau.de" und "Tagesschau24" will sich noch stärker als vermeintlich seriöse "Faktenchecker" verkaufen.
Nach der Ankündigung von "Meta"-CEO und "Facebook"-Gründer Mark Zuckerberg, zunächst für die USA sämtliche "Faktenchecker" bei "Facebook", "Instagram" und "Threads" rauszuwerfen und wie das Netzwerk "X" von Technologie-Unternehmer Elon Musk auf unzensierte Social-Media-Beiträge und Community-Kommentare zu setzen, hat sich die politisch abhängige ARD dazu genötigt, sich in Deutschland nun selbst als vermeintliche Instanz gegen Falschinformationen aufzustellen.
Dabei wurde die Hamburger Redaktion von "ARD-aktuell" beim NDR in den vergangenen Jahren wiederholt dabei erwischt, die Wahrheit verdreht, Tatsachen verschwiegen und ARD-Mitarbeiter als vermeintlich neutrale Experten in den Nachrichten verkauft zu haben. Der unabhängige Medienservice "ÖRR-Blog" veröffentlicht wöchentlich die unseriösen, verfälschten und politisch vorsätzlich Meldungen von ARD, ZDF und DLR einschl. manipulierter Nachrichten von "ARD-aktuell".
Der kritische Hamburger Medienanwalt und Bestseller-Autor Joachim Steinhöfel kommentierte die jüngste Entwicklung auf dem Netzwerk "X": "Die Faktenchecker waren einfach zu politisch voreingenommen und haben mehr Vertrauen zerstört als geschaffen, insbesondere in den USA“, sagt Zuckerberg. Noch! arbeitet er bei uns mit "Correctiv", denen man "dreckige Lügen" vorwerfen darf. Rausschmeissen, Mark! Noch heute!"
In seinem Buch "Die digitale Bevormundung" berichtet Steinhöfel von den oft rechtswidrigen Faktenchecks bei "Facebook" in Deutschland durch das mehrfach gerichtlich verurteilte Kampagnen-Büro von "Correctiv". Die Geschichte der - mit Millionen-Beträgen durch Bund, Länder und private Stiftungen von George Sorros u. a. subventionierte - Aktivisten-Kollektiv um eine vermeintliche "Wannsee-Konferenz 2.0" von Januar 2024 darf per Gerichtsbeschluss als "Dreckige Lüge" benannt werden. Unterdessen versucht der Behördenleiter der Netz-Aufsichtsbehörde BNetzA - Klaus Müller -, Mark Zuckerberg in Deutschland erkennbar unter Druck zu setzen. Auf dem in links-grünen Kreisen verhassten Netzwerk "X" verlautbarte der Grüne Funktionär: "Nach dem "DSA" (Digital Service Act, die Red.) ist die Zusammenarbeit von sehr großen Onlineplattformen (VLOP) mit Faktencheck-Organisationen zwar nicht zwingend vorgeschrieben, allerdings sinkt ihr Sanktionsrisiko, wenn sie es in der EU tun."
Zugleich holte Müller die Drohung manipulierter Wahlen hervor: "Nach den Election Guidelines gilt dies in der EU bei Wahlen als risikominimierende Maßnahme nach § 35 DSA bzgl. systemischer Risiken. Arbeitet ein "VLOP" nicht mit Faktencheckern zusammen, muss er nachweisen, dass er andere, gleich wirksame Risikominimierungsmaßnahmen ergreift."
Auf die Presseanfrage der "Bild"-Zeitung gegenüber der Bundesnetzagentur, ob und in welchem Umfang "Faktenchecker" die Verbreitung von Falschinformation verhindern, antworterte die BNetzA: "Nein".
-
Überfordertes Hamburg Welcome Center gefährdet Arbeit von Arbeitsmigranten.
 |
Außen 'hui', innen eher 'S.ustall', so die Fakten.
(Foto: HMG, Senat Hamburg) |
Hamburg, 06.01.2025: Erfahrungsberichte sowie die jüngsten Antworten auf eine Anfrage der Linksfraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft zeigen massive Mängel beim "Hamburg Welcome Center" des Senats: Der Bearbeitungsstau bei den E-Mails ist im vergangenen Jahr gegenüber 2023 noch weiter angewachsen: Mittlerweile liegen dort 8.100 unbeantwortete E-Mails. Die Wartezeit auf einen Termin zur Beantragung oder Verlängerung von Aufenthaltserlaubnissen beträgt im Schnitt fast fünf Monate bzw. 144 Tage.
Carola Ensslen, migrationspolitische Sprecherin der Linksfraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft: "Wenn der Senat behauptet, die 8.100 unbeantworteten E-Mails beträfen zum Teil auch erledigte Vorgänge, dann ist das keine Entwarnung. Wer ein dringendes Anliegen hat und keine Antwort bekommt, ist ziemlich frustriert und verzweifelt. Im Welcome Center scheint es nicht einmal eine Priorisierung der Anliegen zu geben. Massive Auswirkungen haben auch die Wartezeiten bei den Aufenthaltserlaubnissen."
So werde der Wechsel von einer abgeschlossenen Ausbildung in den Job als Fachkraft ausgebremst. Wer nur eine Verlängerungsfiktion für die Ausbildung hat, darf maximal 20 Stunden als Fachkraft arbeiten. Ein Vollzeitjob ist nicht erlaubt. Wer den Arbeitgeber wechseln will, darf gar nicht arbeiten. Das sind unhaltbare Zustände, so die Bürgerschaftsabgeordnete. Der Senat müsse dringend mehr Stellen im "HWC" schaffen.
Das "Hamburg Welcome Center" in der Süderstraße in Hamburg-Hammerbrook soll eigentlich Fachkräfte aus dem Ausland willkommen heißen und ihnen bei der Integration helfen. Im Interesse der internationalen Fachkräfte und der Arbeitgeber sollte eine zügige und reibungslose Bearbeitung selbstverständlich sein, betont die Linksfraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft.
-
Senatorin feiert Hamburg als führenden Innovationsstandort - Opposition rechnet mit rot-grünen Märchen ab.
 |
Außen hui, innen ziemlich pfui - stellt die Hamburger Opposition fest.
Foto: HANSEVALLEY |
Hamburg, 18.12.2024: Der rot-grüne Senat der Freien und Hansestadt hat sich am Dienstag d. W. in der Landespressekonferenz im Hamburger Rathaus als "dynamischste Innovationsregion in Deutschland" verkauft. Als Beweis führt die für Wirtschaftsförderung verantwortliche SPD-Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard die drei geplanten Forschungs- und Wissenschaftsparks in Altona, Bahrenfeld und Bergedorf an. Jetzt will der Senat in Harburg rund um Technische Universität und Fraunhofer CML einen weiteren Innovationsstandort aka "internationalen Hotspot" errichten.
Auf einer Gesamtfläche von 80 Hektar soll ein "standortübergreifendes Innovationsquartier" rund um Harburger Hafen und Fußgängertunnel entwickelt werden, das zur "Förderung von Synergien" beitragen soll. Die Themenschwerpunkte liegen laut Senat auf "Green Technologies", Luftfahrt, Maritimen Themen, Medizintechnik, Digitalisierung und Materialwissenschaften.
SPD-Co-Vorsitzende Melanie lobte die Aktivitäten ihres Senats: "Hier haben wir Know-how und Flächen, um in Zukunft eine Tech City zu gestalten, in der wir Gründer in der Unternehmensentwicklung unterstützen und ausreichend Flächenangebote schaffen. In der Fortführung unserer Flächenstrategie wollen wir hier für alle Zielgruppen und Bedarfe ein Angebot vorhalten."
Prof. Götz Wiese, wirtschaftspolitischer Sprecher der CDU-Fraktion kontert der Selbstbeweihräucherung aus der Landespressekonferenz: „Der rot-grüne Senat attestiert Hamburg, in der Champions League zu spielen, definiert aber offenbar selbst deren Maßstäbe. Denn ein genauerer Blick zeigt: In die Top 10 Europas hat es Hamburg nicht geschafft. Deutschlandweit rangiert Hamburg weiter hinter Oberbayern, Berlin und Karlsruhe."
Der Professor für Steuerrecht an der "Bucerius Law School" weiter: "Die EU stellt bei Hamburg grundlegende Schwächen fest, die einen dauerhaften Spitzenplatz in weitere Ferne rücken lassen. Das sind die Kategorien überdurchschnittliche Digitalkompetenz, Verkauf innovativer Produkte und lebenslanges Lernen. Solange Hamburg in diesen Basiskategorien nicht vorankommt, wird sich unsere Stadt innovationspolitisch eher mit dem Klassenerhalt beschäftigen. Hamburg kann mehr.“
Die FDP-Spitzenkandidatin für die Bundestagswahlen 2025, Katarina Blume, stellt klar: "Innovationen werden nicht durch städtische Flächen vorangetrieben, sondern durch kluge Köpfe. Rot-Grün muss eine Strategie entwickeln, um international noch attraktiver zu werden für die besten Fachkräfte. Dazu gehören auch ein Angebot an bezahlbaren Wohnungen und eine gute Anbindung der überwiegend abgelegenen Innovationsparks.“
Die stv. Landesvorsitzende der Hamburger FDP schenkt den rot-grünen Senatoren kräftig ein: „Der gute Wille allein reicht nicht, Hamburg muss sich auch an den Ergebnissen der Innovationspolitik messen lassen. In Zukunftstechnologien wie der Künstlichen Intelligenz liegt Hamburg weiterhin zurück im Vergleich zu Städten wie München oder Karlsruhe. Die Zahl der zuletzt stark gestiegenen Firmenpleiten weckt die Sorge, dass die Innovationskraft der Stadt nicht so stark ist."
-
Geplanter Digitalpakt 2.0 laut CDU, FDP und Bitkom Augenwischerei, Selbstaufgabe und Sparversion.
 |
Die meisten Länder förderung nur digitale Geräte und keine Lehrerweiterbildung.
(Foto: Radio Bremen/Claudia Euen) |
Berlin, 16.12.2024: Der in der vergangenen Woche vom vorübergehenden Bundesbildungsminister Cem Özdemir und den Kultusministern der 16 Bundesländern verabredete "Digitalpakt 2.0" wird von zahlreichen Seiten massiv kritisiert. Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Nadine Schön, nannte den über Monate verschleppten Kompromiss "eine Augenwischerei":
"Digitale Bildung ist Schlüsselaufgabe zukunftsgerichteter Politik und so viel mehr als nur der Einsatz von Smartboards und Laptops im Klassenzimmer. Sie bereitet junge Menschen auf eine Welt vor, in der technologische Fähigkeiten genauso wichtig sind wie Lesen und Schreiben. Deshalb fordern wir neben digitaler Ausstattung von Schulen auch innovative Konzepte, eine gute pädagogisch-didaktische Begleitung digitaler Medien im Unterricht und die Vermittlung digitaler Grundkompetenzen, etwa zum Programmieren."
Die am Freitag verkündete Absichtserklärung zum "Digitalpakt 2.0" sei "Augenwischerei". Bildungsminister Özdemir überreiche den Ländern einen "ungedeckten Scheck" in Höhe von 2,5 Mrd. €. Für einen solchen Digitalpakt 2.0 habe die Ampel keine Vorsorge im Haushalt getroffen und den Bundestag als Haushaltsgesetzgeber auch nicht in die Verhandlungen einbezogen. Cem Özdemir könne den Schulen keine Planungssicherheit geben. Dies könne nur die neue Bundesregierung.
Ria Schröder, bildungspolitische Sprecherin der FDP-Bundestagsfraktion, ergänzte: "Die Einigung zum Digitalpakt konnte deshalb so schnell zustande kommen, weil Özdemir jeden Anspruch an bessere digitale Bildung in Deutschland aufgegeben und die Forderungen der Länder einfach akzeptiert hat. Das ist kein Ergebnis von Verhandlungen, sondern Folge der Selbstaufgabe des Bundes. Dass dies von der SPD-Fraktion mitgetragen wird, ist ein Armutszeugnis."
Die Liberale Abgeordnete ergänzte: "Keine verpflichtenden Fortbildungen von Lehrkräften, keine Verankerung von Medienkompetenz im Unterricht, kein zusätzliches Engagement der Länder. Der Digitalpakt bleibt weit hinter den Erwartungen zurück, zum Schaden der digitalen Bildung und Zukunftschancen junger Menschen."
Bitkom-Hauptgeschäftsführer Bernhard Rohledder stellte fest: "Wir bedauern allerdings, dass das veranschlagte Budget deutlich kleiner ausfällt als beim ersten Digitalpakt und keine Mittel für digitale Lehr- und Lernmaterialien sowie die IT-Administration umfasst. Eine ambitionierte digitale Bildung muss über die technische Ausstattung der Schulen und Lehrkräftequalifizierung hinausgehen, und auch das gibt es nicht zum Nulltarif."
Zwischen 2025 und 2030 sollen rd. 5 Mrd. € in die Digitalisierung der Schulen investiert werden – jeweils zur Hälfte von Bund und Ländern finanziert, wobei sich die Länder bereits laufende und geplante Investitionen anrechnen lassen können. Die Verhandlungen dauern mittlerweile zwei Jahre, trotzdem war der erste Digitalpakt im Mai dieses Jahres ohne Anschlussprogramm ausgelaufen.
Mitte des Jahres forderten in einer Studie des Digitalverbandes Bitkom 90 % der Lehrkräfte eine möglichst schnelle Anschlussfinanzierung des Digitalpakts. 93 % sagten, ein Digitalpakt 2.0 müsse auch Gelder für Lizenzen, Lernmaterialien und Fortbildungen enthalten.
-
DPA macht sich zum Handlanger des von Rot-Rot installierten gefährlichen Skandal-Chefs des Thüringer Geheimdienstes.
 |
Mittlerweile bundesweit in der Diskussion: Die Machenschaften des Stephan Kramer-
(Grafik: apollo-news.net) |
Hamburg, 16.12.2024 *Update 19.12.2024*: Die an der Elbe sitzende Deutsche Presse-Agentur hat im Skandal um den thüringischen Verfassungsschutz-Chef Stephan Kramer ersichtlich Fakten unterschlagen und eine politisch manipulierte Geschichte ohne erforderliche Gegenrecherche veröffentlicht. Das geht aus der Kritik des Chefredakteurs von "Apollo News" - Max Mannhart - auf dem Netzwerk "X" hervor, der die bundesweit für Aufsehen erregende Geschichte mit seiner Redaktion recherchierte. Die mehr als 20 redaktionellen Mitarbeiter des konservativen Online-Magazins "Apollo News" aus Berlin hatten die Geschichte über mehrere Monate in einer Tiefenrecherche ausgegraben, vertrauliche Dokumente eingesehen, mit aktuellen Mitarbeitern des Thüringischen Verfassungsschutzes gesprochen und zahlreiche Insider um den in der Kritik stehenden Kramer interviewt. In Ihrer Titel-Geschichte "Der Kramer-Komplex" konstatieren sie, dass der Thüringer Inlandsgeheimdienst unter Behördenleiter Kramer und Ministerpräsident Ramelow zur "politischen Maschine" vor allem gegen die AfD umfunktioniert wurde. Der Landesdienst der Presseagentur DPA in Erfurt manipulierte in seiner Meldung vom 13.12.2024: "Hintergrund (für die Beantragung eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses durch die AfD, die Red.) sind Vorwürfe gegen Kramer in Medienberichten - unter anderem geht es um Geheimnisverrat". Damit verweigert die sich selbst als neutral verkaufende Agentur publizistisch unsauber einer Nennung der Quelle für die umfassende Exklusivberichterstattung über AfV-Chef Kramer, sprich dem konservativen Nachrichtenkanal "Apollo News". Stattdessen lies DPA den mit der Kramer-Affäre in der Schußlinie stehenden und seit 2017 vorgesetzten Dienstherren Kramers - SPD-Innenminister Georg Maier - unkommentiert zu Wort kommen: "Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) sprach am Rande der Plenarsitzung von einer "Kampagne gegen Stephan Kramer": "Bei den Vorwürfen sei "nichts Neues dabei". Alte und bereits geklärte Sachverhalte seien "von rechten Medien" zusammengefasst und daraus eine "Verschwörungsgeschichte" gestrickt worden," so Maier.
Die Fakten sprechen eine andere Sprache: Die Referatsleitung "Rechts- und Linksextremismus" des Amtes war über drei Jahre unbesetzt, weil kein erfahrener Jurist unter dem offenbar übergriffigen Kramer auf den Schleudersitz wollte. Mittlerweile wird die Stelle von einer Berufseinsteigerin besetzt, die sich den - Zitat Mitarbeiter - "Jähzorn und erratischen Anordnungen" des früheren Mitglieds des deutschen Ablegers "Wolfpack Germany" der russischen Rockergruppe "Nachtwölfe" aussetzen muss. Im August 2014 feierten die "Nachtwölfe" die "Rückgewinnung" der Krim durch Russland.
"Apollo-News" berichtet weiter von Drohungen und systematischen Mobbing gegen Mitarbeiter, zurückgehaltenen Akten, privaten Beweissammlungen gegen die AfD, rätselhaften Belegen für vermeintlichen Extremismus, Intrigen mit Journalisten und den aufgrund seiner 2015 nachgewiesenen Beteiligung beim "Wolfspack Germany" gesicherten Rockerkontakten nach Russland. Einer der schwersten Vorwürfe: Kramer hat sich strafbar mit Journalisten über Geheimnisse ausgetauscht. Für das Innenministerium damals Grund genug, gegen den schwierigen AfV-Chef vorzugehen. Nicht das einzige Verfahren gegen Kramer.
Die aktuellen Recherchen gegen den Siegener Sozialpädagogen und in der jüdischen Gemeinde aufgrund radikaler Äußerungen gegen den Bestseller-Autor und langjährigen SPD-Politiker Thilo Sarazin umstrittenen Konvertiten und Gender-Fan Kramer werfen ihm als Chef des Thüringer Inlandsgeheimdienstes vor allem eine tendenzielle, unprofessionelle Amtsführung vor.
Kramer nennt die aktuell 20 % AfD-Wähler pauschal "brauner Bodensatz". Er hatte 2018 als Erster einen AfD-Landesverband zum "Prüffall" erklärt. 2020 war er der Erste, der einen Landesverband als "Verdachtsfall" einstufte. Nur ein Jahr später war er der Erste, der die AfD in Thüringen in seiner Funktion als politischer Beamter mit Weisungsgebundenheit der Landesregierung unter Bodo Ramelow als "gesichert rechtsextrem“ einstufte.
Die langjährige CDU-Politikerin Erika Steinbach pointierte die Machenschaften von Kramer auf "X": "Er ist weisungsgebunden und macht das, was die thüringische Landesregierung fordert. Wenn von ihm gefordert wird, die AfD als verfassungsfeindlich einzustufen, dann hat er das zu tun und er macht es außerdem mit besonderer Freude. Die gesetzlich vorgeschriebene Qualifikation für sein Amt sucht man vergeblich."
Kramer hat laut "Apollo News"-Recherchen ein Zusatzgutachten zur Einstufung der AfD als "gesichert rechtsextrem" aus dem Jahr 2021 zum Entsetzen von Mitarbeitern der Behörde handstreichartig unterschlagen. Darin werden Urteile des Bundesverfassungsgerichts zitiert. dass bei mehrdeutigen Aussagen im Kontext der Meinungsfreiheit zugunsten des Betroffenen interpretiert werden muss.
Ebenfalls dort nachzulesen ist, dass Aussagen von Abgeordneten im Thüringer Landtag gemäß Immunität nicht belangt oder verfolgt werden dürfen. Für Kramers politische Ziele eine Giftlektüre. Zeugen berichten gegenüber den Rechercheuren, Kramer habe das Gutachten-Verbot durchgedrückt, um "dem Gegner keine Argumente zu liefern“.
Kramer wurde von Ex-Ministerpräsident und PDS-/Linksparteifunktionär Bodo Ramelow ohne die laut Landesverfassungsgesetz notwendige Qualifikation eines Richters am 1. Dezember 2015 in das Amt des thüringischen Verfassungsschutz-Chefs gehievt (Kramer hat in vier Anläufen in Marburg, Frankfurt, Bonn und Marburg versucht, Jurist zu werden). Der Sozialpädagoge hat sich als persönlicher Feind der AfD positioniert und diese juristisch angreifbar als "gesichert rechtsextrem" abgestempelt. Pikant: Der Verfassungsschutz hatte Ramelow selbst wegen Kontakten zur Kommunistischen Partei DKP seit den 80er-Jahren beobachtet.
Das Magazin "Apollo-News" kommentierte die Machenschaften um den vom Linken-Funktionär Ramelow als Verfassungsschutz-Chef installierten Kramer: "Die Vorgänge um Stephan Kramer delegitimieren den Staat – zeigen sie doch, wie der Verfassungsschutz unter Kramer und Ramelow zu einem Agitations- und Propagandaorgan umfunktioniert wurde, der einen entgrenzten politischen Kampf ohne Legitimation führt. Die aktivste Gefahr für die Demokratie geht aus diesem Landesamt aus, von diesem Chef." Der Oldenburger Verfassungsrechtler Prof. Volker Boehme-Neßler wirft dem umstrittenen Partei-Hopper (Kramer ist SPD-Mitglied und war zuvor FDP- und CDU-Mitglied) einseitigen "politischen Aktivismus" vor, der die Grenzen des Verfassungsschutzes überschreitet. Der Fraktionsvorsitzende der AfD im Thüringer Landtag, Björn Höcke, sagte zu Vorwürfen gegen den linken und damit parteiischen Chef des AfV, er habe seine "Behörde als Kampfinstrument gegen den AfD-Landesverband missbraucht".
Der mit den Stimmen von SPD, Linkspartei-Splittergruppe BSW und direkten Stimmen der von der CDU als unvereinbar ausgegrenzten Linkspartei zum thüringischen Ministerpräsidenten gewählte CDU-Funktionär Mario Voigt schweigt zu den offensichtlich bedrohlichen und strafrechtlich zu beurteilenden Machenschaften seines Verfassungsschutz-Chefs. Kritiker auf "X" gehen davon aus, dass die CDU und ihre linken Koalitionäre in Erfurt und auf Bundesebene die Kramer-Affaire bis zur Bundestagswahl Ende Februar '25 versuchen, totschweigen und unter den Teppich zu kehren.
Die AfD-Fraktion setzte in der vergangenen Woche als stärkste Fraktion im Thüringischen Landtag gegen den Widerstand der Altparteien und des regierenden Links-Bündnisses einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur Kramer-Affäre ein. Dabei geht es auch um das Verhalten zweier MDR-Journalisten, die einen vertraulichen Informanten nach dessen berechtigter Kritik an der Arbeit des AfV-Chefs laut "Apollo-News" an genau diese Behörde verraten haben. Der MDR spielt zu den schweren publizistischen Verstößen seiner bis heute für den Sender tätigen Redakteure "toter "Käfer", hat nun jedoch interne Ermittlungen wegen "schwerer Verstöße" gegen die zwei Mitarbeiter eingeleitet.
Der AfD-Sprecher für Verfassungsschutz-Angelegenheiten im Erfurter Landtag, Stefan Möller, erklärte: "Ein deutliches Schlaglicht wirft der Vorgang auch auf die parlamentarische Kontrollkommission dieses Geheimdienstes, die zwar lange Berichte schreibt, aber mit keinem Wort die sehr detaillierten Verdachtsmomente des Geheimnis- bzw. Informantenverrats erwähnte. Diese Vertuschungstendenz spricht dafür, den Sachverhalt zum Gegenstand eines eigenen Untersuchungsausschusses zu machen und dabei auch die Rolle der Dienstvorgesetzten zu untersuchen.“
Für den Erfolg der AfD sind die systematischen Ermittlungen und Vor-/Verteilungen des politisch geführten Thüringer Verfassungsschutzes nicht abträglich: Parteichefin Alice Weidel ist laut aktueller "Insa"-Umfrage für "Bild" mit 21 % und 3 Punkten Zuwachs beliebteste Spitzenkandidatin der Bundestagsparteien - gleichauf mit dem wegen seiner Aussagen zu "Frieden auf dem Friedhof" umstrittenen CDU/CSU-Chef Friedrich Merz. Laut ARD-Umfrageinstitut "Infratest-Dimap" hat die AfD in Deutschland ein Wählerpotenzial von bis zu 25 % der Stimmen. Laut "Deutschlandtrend" vom Oktober d. J. lehnt eine Mehrheit der Deutschen von 45 % ein politisch motiviertes Verbot der AfD ab, in Ostdeutschland sind es 57 %.
-
Angeschlagener Otto-Versand versilbert erfolgreichen Mode-Versender About You an Zalando aus Berlin.
 |
Die drei About You-Vorstände bleiben auch unter Zalando an Board.
Foto: About You |
Berlin/Hamburg, 12.12.2024: Der Berliner Online-Bekleidungs-Händler, Marktplatz-Anbieter, Logistik-Dienstleister und Software-Produzent "Zalando" will bis Sommer kommenden Jahres seinen kleineren Konkurrenten, den jungen Hamburger "Otto-Konzern"-Modehändler "About You" vollständig übernehmen. Das teilten beide Unternehmen am Mittwoch d. W. (11.12.2024) überraschend mit. Dazu sollen im Rahmen des "Project Pearl“ alle Anteile für 6,50 €/Aktie aufgekauft werden. "Zalando" bezahlt die Übernahme aus eigener Tasche, ohne Kredite aufzunehmen. Eine Kapitalerhöhung soll es ebenfalls nicht geben.
In beiden Companies ist der dänische Unternehmer Anders Holch Polvsen beteiligt ("About You": 19,7 %, "Zalando": 10,1 %). Der Geschäftmann hinter der "Bestseller"-Group mit insgesamt 16 Modemarken und der Investment-Gesellschaft "Heartland" (u. a. "Jack & Jones", "Only", "Only & Sons" und "Vera Moda") hat mit den Beteiligungen an "About You" und "Zalando" frühzeitig Online-Absatzkanäle für sich gesichert. Der Großgesellschafter verdiente bei "About You" besonders kräftig mit: 2023/2024 kauften die Hamburger allein bei den ihm gehörenden "Bestseller"-Firmen, wie "Jack & Jones" und "Vera Moda", Ware für 207 Mio. € ein - überproportional viel im Vergleich zum Umsatz. Er gilt mutmaßlich Strippenzieher der Transaktion zu sein.
Experten spekulieren seit Langem, ob die "Bestseller"-Schwestern eines Tages zusammen gehen. Für den Hamburger "Otto-Versand" als Gründer von "About You" ist der Verkauf der Anteile im Wert von insgesamt 1,13 Mrd. € ein glücklicher Umstand und Rettungsanker. "Otto" steckt seit mehr als 2 Jahren mit dreistelligen Millionenbeträgen in den roten Zahlen und das Eigengeschäft des erst 2020 zum Marktplatz erweiterten Online-Händlers hinkt seit dem Ende der Corona-Pandemie massiv Wettbewerbern wie "Amazon" hinterher.
"Otto" will mit seinen aus dem Verkauf geschätzt 418,1 Mio. € das Kerngeschäft von "Otto.de" sanieren und weitere einzutreibende Forderungen für die Inkasso-Tochter "EOS" aufkaufen. Hauptgesellschafter an "About You" sind die "Otto Group"/"Otto AG für Beteiligungen" (rd. 37 %), der "Otto-Konzern"-Erbe Benjamin Otto (rd. 8 %) und der dänische "Bestseller"-Chef Anders Holch Polvsen (rd. 20 %) - mit zusammen rd. 73 % inkl. der drei Gründer mit 7,3 %. Alle Gesellschafter erklärten, ihre Anteile vollständig abzugeben und damit Kasse zu machen. "About You" ist seit dem Börsengang im Juni 2021 mit einem Ausgabekurs von 23,- € auf Pennystock-Niveau von bis zu unter 3,- € abgestürzt.
Zum Börsengang war der junge Hamburger Bekleidungsversender "About You" noch 3,9 Mrd. € wert. Die Anteile der Hamburger "Otto-Konzern"-Tochter stiegen am Mittwoch nach Bekanntwerden der Übernahme fast auf Übernahmekurs. Der Wert der Berliner lag zeitgleich bei 35,15 €. Die Hamburger haben derzeit rd. 1.250 Mitarbeiter, allein bei der Tochterfirma "Scayle" arbeiten 300 Angestellte. Ihr Job ist aller Wahrscheinlichkeit nach ziemlich sicher. Die Berliner haben etwa 15.000 Beschäftigte unter Vertrag.
"Zalando"-Co-Geschäftsführer Robert Gentz erklärte: „Die Strategie von About You und unsere Strategie passen sehr gut zusammen und die Assets von About You im Privat- und Unternehmenskundengeschäft sind eine hervorragende Ergänzung zu unseren.“ Als kombiniertes Unternehmen werde man in der Lage sein, einen noch größeren Marktanteil in Europa abzudecken.
Mit der Transaktion ergebe sich „ein überzeugendes Wertschöpfungspotenzial, welches die beiden in der gleichen Branche tätigen Unternehmen generieren können“, zitiert die "Börsen-Zeitung" den Mit-Begründer von "Zalando". Die Berliner erhoffen sich für den fusionierten Mode- und Dienstleistungs-Konzern bis zu 100 Mio. € mehr an operativem Gewinn pro Jahr. "Zalando" fuhr im Geschäftsjahr 2023 insg. 10 Mrd. € Umsatz ein, "About You" gerade einmal 1,94 Mrd. €. Die beiden Marken "About You" und "Zalando" sollen parallel im Endkundengeschäft erhalten bleiben. Dabei soll "About You" die jüngere Kundschaft adressieren.
Im B2B ergänzen sich die beiden Unternehmen: Während "Zalando" mit "ZEOS" auf ein Netzwerk von 12 eigenen Logistikzentren, rund 20 Retourenzentren und mehr als 40 lokalen Transportdienstleistern zurückgreifen kann, den Marktplatz-Software-Anbieter "Tradebyte" aus Ansbach für mehr als 90 verschiedene Marktplätze übernommen hat, konnte "About You" mit "Scayle" eine erfolgreiche E-Commerce-Software in den Markt bringen. Dabei ist "Scayle" der einzige echte Aktivposten von "About You", Der Mode-Versender hängt bislang bei Strategie und Logistik an der kurzen Leine des angeschlagenen "Otto"-Konzerns einschl. "Hermes".
Die mittlerweile als eigenständige GmbH geführte Software-Firma "Scayle" (vormals "About You Tech") hat der übergeordneten Aktiengesellschaft "About You SE" im vergangenen Jahr bereits 118,9 Mio. € Umsatz gebracht - und damit 9,7 % des Konzern-Gesamtumsatzes. Das Shop-System mit externen Nutzern, wie "Baby-Walz", "Babymarkt", "Deichmann", "Depot", "Fielmann", "Marc O' Polo", "Mister Spex" und "S. Oliver" besteht im Kern aus einem Shop-, Order- und Produkt-Management, Checkout-Services sowie diversen Marketing-Tools. Vor kurzem kam auch ein eigenes, BaFin-zertifiziertes Payment-Tool dazu.
Die größten Online-Modehändler in Deutschland waren im vergangenen Jahr auf Platz 1 der als teuer, langsam und "arrogant" geltende "Otto-Versand", gefolgt von der wachsenden Online-Sparte des schwedischen Multi-Marken-Konzerns "H&M" und der in 2022 noch auf Platz 2 rangierende Berliner Modekonzern "Zalando". Größter Herausforderer der deutschen und europäischen Mode-Versender ist der chinesische Billig-Anbieter "Shein". Er erreichte im vergangenen Jahr allein in Deutschland 49 Mio. € Umsatz und kletterte im Ranking auf den 7. Platz.
E-Commerce-Experten rechnen mit weiteren Fusionen im deutschen und europäischen Modehandel. So steht die ehemalige "Bestseller"-Beteiligung "Asos" aus Großbritannien ebenso unter Beobachtung, wie der junge britische Versender "Boohoo".
-
"Kampagnenblatt" Spiegel entlarvt mit Skandal-Titel gegen Lindner endgültig seine Ideologie.
 |
Wer ist der wahre Täuscher: FDP-Chef Lindner oder Spiegel-Chef Korbjuweit?
Montage: NIUS |
Hamburg, 10.12.2024: Nach den Relotius-Fälschungen und der heimlichen US-Regierungsfinanzierung des vom "Spiegel" genutzten, vermeintlich unabhängigen Recherche-Netzwerks "OCCRP" ist das umstrittene linkslastige Hamburger Nachrichten-Magazin "Spiegel" erneut in der gesellschaftlichen Kritik: Die acht an der aktuellen Titelgeschichte des Magazins arbeiteten Reporter und Redakteure verfälschten unter Chefredakteur Dirk Korbjuweit (Foto) mit dem Titel "Der Täuscher" Fakten um den an den Pranger gestellten FDP-Bundesvorsitzenden Christian Lindner.
So unterstellt der "Spiegel" dem Ex-Finanzminister, seinem Vertrauten und vormaligen FDP-Bundesgeschäftsführer Carsten Reymann zu einer lukrativen Verbeamtung geholfen habe. Eine glatte Falschbehauptung. wie auch das unabhängige Nachrichtenportal "Nius" berichtet. In der Online-Version des 6,- € teuren Polit-Blattes muss die Redaktion kleinlaut zurückrudern: „Anmerkung der Redaktion: In einer früheren Fassung hieß es, Christian Lindner habe im Finanzministerium dafür gesorgt, dass sein Vertrauter Carsten Reymann verbeamtet worden sei. Tatsächlich wurde Reymann bereits Jahre zuvor in einem anderen Ministerium verbeamtet.“ Nicht genug: Auf dem Hinweis des FDP-Spitzenpolitikers „Sie kennen ja meine berufliche Situation ...“ bei der "Bild"-Gala des "Axel-Springer-Verlags" für die Spendenaktion von "Ein Herz für Kinder" machten die manipulativen Redakteure des "Spiegel" den Bundespolitiker mit der Aussage "Lindner knausert bei Spendengala“ zum herzlosen Geizhals. "Stern"-Redakteur Julius Betschka kommentierte die Dreistigkeit der "Bertelsmann"-Kollegen: „Lindner knausert, obwohl er viermal so viel spendet wie der SPD-Chef. Sein gar nicht soo schlechter Witz wird als ernste Aussage hingestellt. Manchmal zweifle ich schon.“ Auch in diesem Fall musste die "Spiegel"-Redaktion in der Online-Version öffentlich zurückrudern.
FDP-Vize Wolfgang Kubicki teilte gegen die manipulativen Machenschaften der Hamburger Redakteure mit Schlagseite auf "X" aus: „Wenn Christian Lindner vor laufender Kamera das Vierfache spendet wie Lars Klingbeil, lautet die Schlagzeile beim Spiegel: ‚Lindner knausert‘. Falls sich jemand fragt, wie hoch der Tatsachengehalt des aktuellen Spiegel-Covers ist. Vor dem Hintergrund der Tatsache, dass die NZZ herausgefunden hat, dass der Spiegel über Lindner negativer als über Frau Weidel berichtet, kann man nur von einem Kampagnenblatt sprechen.“
-
Nach 2 Mio. € Subventionen manipuliert DPA peinlichen Ausrutscher der Grünen Außenministerin.
 |
Politiker vor Peinlichkeiten schützen: Jetzt wissen wir, warum die DPA Geld vom Staat nimmt.
(Foto: Michael Kappler, Grafik: Medium Magazin, Screenshot: HANSEVALLEY) |
Berlin/Hamburg/Mainz, 09.12.2024: Die durch mehr als 2 Mio. € staatliche Subventionen der links-grünen Bundesregierung korrumpierte Presseagentur "DPA" hat einen peinlichen Versprecher der - immer wieder in rhetorische Fettnäpfchen stampfenden - Grünen Außenministerin Baerbock versucht, durch vorauseilenden Gehorsam vor öffentlicher Kritik und berechtigter Häme zu schützen.
Der zentrale Newsroom der "Deutschen Presse-Agentur" in der "Axel-Springer-Passage" in Berlin-Kreuzberg korrigierte eigenständig die von der Hannoveraner Spitzenpolitikerin gegenüber Russlands Außenminister Sergej Lawrow getätigte Falschaussage: „Sie können sich selbst etwas vormachen, nicht aber der Welt, nicht den 1,3 Milliarden Menschen in Europa." Baerbock hatte sich gegenüber Lawrow auf der internationalen OSZE-Ministerkonferenz auf Malta am Donnerstag vergangener Woche lächerlich gemacht.
Die "DPA" manipulierte die Aussage ohne ausdrücklichen Wunsch des Außenministeriums eigenständig und brachte so bundesweit ein verfälschtes Zitat in den "DPA"-Nachrichtenticker mit den Worten: „Sie können sich selbst etwas vormachen, nicht aber der Welt, nicht den 1,3 Milliarden Menschen in der OSZE-Region.“ Damit brach die wegen der staatlichen Zuwendungen bereits massiv kritisierte "DPA" jegliche Regeln unabhängigen Journalismus. Deutschlands größte und umstrittene Presse-Agentur kassierte für die Manipulation des Poltiker-Statements daraufhin einen Shitstorm im Internet und musste sich schließlich für ihre Politik-hörige Verfälschung der Aussage entschuldigen.
Schließlich vermeldete die von der rot-grünen Bundesregierung offenbar bereits gekaufte Agentur auf dem Netzwerk "X": „Darin dokumentieren wir im Wortlaut wieder das ursprüngliche Zitat inklusive des Fehlers und machen unseren Standards entsprechend den Ablauf transparent.“ Auch die Nachrichtenredaktion des staatlich beeinflussten und kontrollierten ZDF manipulierte die Original-Aussage der regelmäßig rhetorisch in Fettnäpfchen tretenden Außenministerin. Die wegen politischer Verfälschungen wiederholt in der Schußlinie stehende "Tagesschau" von "ARD aktuell" aus Hamburg beschäftigte sich lediglich mit einer vermeintlichen Kritik an der Anwesenheit des russischen Außenministers.
Die peinliche Enthüllung über die Manipulation des "DPA"-Statements wurde von der unabhängigen Wochenzeitung "Junge Freiheit" an die Öffentlichkeit gebracht. -
FAZ, Spiegel und Zeit jubeln linke Politiker hoch und schreiben bürgerliche Volksvertreter nieder.
 |
Spiegel-Verlag Hamburg: Links ist uns nicht links genug.
Foto: HANSEVALLEY |
Zürich, 04.12.2024: Die renommierte "Neue Zürcher Zeitung" hat insgesamt 5.600 Artikel während der Ampel-Regierung von Dezember 2021 bis November 2023 der drei vermeintlichen deutschen Leitmedien "FAZ", "Spiegel" und "Zeit" ausgewertet. Im Mittelpunkt der Analyse der Zeitungs- und Zeitschriftenartikel ohne Agenturmeldungen stand die Frage: Welches Medium jubelt welchen Politiker hoch und welche Politiker werden von welchen Medien schlecht geschrieben oder tot geschwiegen?
Ergebnis: Die mittlerweile links abdriftende "FAZ" und ihre Redakteure fahren total auf die Israel-feindliche und in eine Visa-Affaire verstrickte grün-ideologische Außenministerin Baerbock ab. 44 % aller Artikel der Frankfurter über die Ex-Trampolinspringerin mit umstrittenem Studienabschluss jubeln die Hannoveranein in den siebten Himmel, 39 % waren neutral und nur 29 % beschäftigten sich mit Pleiten, Pech und Pannen der Visagisten-Stammkundin.
Die Hamburger "Zeit" ist im Umkehrschluss besonders manipulativ unfair zu bürgerlichen und konservativen Politikern: So hauen die unjournalistisch agierenden Redakteure der "Holtzbrinck"-Wochenzeitung die AfD-Vorsitzende und Fraktionschefin im Bundestag jenseits jeglicher Sachlichkeit zu sage und schreibe 90 % negativ in die Pfanne. Die Kollegen der "FAZ" können sich in 65 % aller Artikel nicht zusammenreißen und beim "Spiegel" schlägt man zu 59 % nur zu gern auf die gewählte Abgeordnete ein.
Auch beim CDU-Kanzlerkandidaten und seinem Grünen Möchtegern-Herausforderer finden die linken Journalisten Mittel und Wege, ihre Ideologie ins Blatt zu bringen: So wird Friedrich Merz gern als "populistisch“, "peinlich“ oder "unpopulär“ abgestempelt, um ihm ein Negativ-Image zu verpassen. Der mit missratenem Heizgesetz und mehr als 800 Angriffen per Strafverfahren gegen Kritiker attackierende Habeck wird von der Journaille dagegen gern als "beliebt“, "pragmatisch“ und "verantwortungsvoll“ schöngeredet.
Die Technische Universität Dortmund stellte in ihrer aktuellen Studie zu "Demokratie und Journalismus" auf erschreckende Weise fest: rd. 2/3 der Journalisten in Deutschland ticken politisch ausgesprochen links. Während die linken Parteien SPD, Grüne, Linke und BSW je nach Sonntagsfrage aktuell auf nur noch auf rd. 33,0 % kommen, hält die deutsche Journaille zu 64 % und damit zu rd. 2/3 zum Linksblock im Parteiensystem. Mit 41 % grünen Anhängern verehren deutsche Journalisten besonders die in der Bevölkerung kritisch betrachteten Minister Baerbock, Habeck und Paus.
Rechnet man das mit 23 % knappe Viertel an politisch nicht interessierten Journalisten raus, kommt der Linksblock aus Ampel-, sowie alten und neuen Oppositionsparteien sogar auf eine 82 %-ige Zustimmung. Dagegen wird die in der Bevölkerung von rd. 19 % präferierte AfD von der Journaille komplett ausgeblendet - oder wie bei "FAZ, Spiegel und Zeit" systematisch tot geschrieben.
-
Inflation verdirbt Händlern das Black-Friday-Geschäft.
 |
Die schöngefärbte Otto-Fassade bröckelt auch am Black Friday.
Foto: HANSEVALLEY |
Hamburg, 04.12.2024: Die vermeintliche Rabattschlacht rund um "Black Friday" und "Cyber Monday" war in Deutschland aufgrund der aktuellen Inflation von rd. 2,2 % nicht so erfolgreich, wie es einzelne Händler in ihrer PR glauben machen wollen. Zwar ist die Anzahl der Einkäufe europaweit um 10 % gestiegen. Allerdings haben die Kunden zugleich für rd. 4 % weniger gekauft, in der Bundesrepublik für 3 %.
Das fand die Commerce-Media-Plattform "Criteo" in einer Umfrage unter europaweit 5.000 Händlern und Marken - davon 800 aus Deutschland - heraus. Auch die Hamburger Mobile-Marketing-Plattform "Appsflyer" von "Gruner + Jahr" entlarvt die Jubelmeldungen von "Otto.de" und anderen vermeintlichen "Black Friday"-Gewinnern als offensichtliche Schönfärberei.
"Appsflyer" hat zum vorweihnachtlichen Shopping-Event die Aktivitäten von 75 Shopping- und E-Commerce-Apps aus Deutschland analysiert. Ergebnis: Zwar kletterten die Einläufe über die Apps um 142 % im Vergleich zu anderen November-Freitagen. Zugleich brach der Umsatz über die Shopping-Apps zum Vorjahres-Event um 14 % ein, berichtet das Marketing-Magazin "Horizont".
Der von Geschäftspartnern als "absolut arrogant" eingestufte Versandhändler "Otto.de" jubelte in einer Pressemitteilung am Dienstag (03.12.24), der "Black Friday" hätte dem als teuer, langsam und kundenfeindlich bewerteten Universalversender ein Plus von 18 % Bestellungen im Vergleich zu 2023 eingebracht, ebenso wie 12 % mehr Besteller. Zugleich lobte sich der in schwerem wirtschaftlichem Fahrwasser steckende Versender, 17 % höhere Bestellungen erhalten zu haben. Angaben zur Bestellhöhe machte "Otto.de" allerdings nicht.
Unterdessen könnte sich auch die Hoffnung der Händler auf ein starkes Geschäft zur diesjährigen Hauptweihnachtszeit zerschlagen. Der GfK-Konsumklimaindex sank laut Hochrechnung für Dezember auf minus 23,3 Punkte - und damit auf einen weiteren Tiefpunkt im Vergleich von -18,4 Zählern im November d. J. Der Wert markiert den niedrigsten Stand seit Mai '24 und übertrifft die pessimistischsten Prognosen, so der "Bankenbrief" des Bankenverbandes.
Damit ziehen die Verbraucher offenbar zum Vor- und Hauptweihnachts-Geschäft 2024 in großem Umfang Stacheldraht um ihre Brieftaschen. „In wirtschaftlich unsicheren Zeiten überlegen Verbraucherinnen und Verbraucher genauer, was wann zu welchem Preis gekauft wird. Insbesondere für größere Anschaffungen werden Preise länger beobachtet und die Menschen warten auf Rabattaktionen“, sagt Bitkom-Hauptgeschäftsführer Dr. Bernhard Rohleder.
-
Habecks Schnüffel-Agentur für Anzeigen-Tirraden gehört FDP-Nachwuchs-Chefin - ausgezeichnet mit 10.000,- € Startup-Preis von NRW mit CDU-Werbegesicht Henrik Wüst.
 |
Macht abmahnenden Politikern alle Ehre: Liberale Chefanschwärzerin Franziska Brandmann.
(Foto: Marvin A. Ruder - CC BY 4.0) |
Berlin/Hamburg/Rheine, 02.12.2024: Die Schnüffel- und Anschwärz-Agentur des Grünen Anzeigen-Rekord-Schreibers Robert Habeck gehört der Bundesvorsitzenden der FDP-Nachwuchsorganisation "Junge Liberale" - Franziska Brandmann (Foto). Als Testimonals prankten bis vor Kurzem sowohl der Grüne "Schwachkopf-Skandal"-Politiker Robert Habeck als auch CDU-Kollege und NRW-Ministerpräsident Henrik Wüst als Empfehlungen rechtswidrig auf ihrer Website.
Auf der Seite von "So Done" rühmte sich die vermeintlich mit KI-agierende Anschwärz-Agentur u. a. für Politiker der Altparteien, mit Stand September d. J. "7.816 Hasskommentare" angezeigt zu haben, vermeintlich einen "95 %-gen Erfolg" damit vor Gericht erzielt zu haben und im Schnitt 591,- € Schmerzensgeld herausgeholt zu haben - und dies, ohne eine dazu berechtigte Anwaltskanzlei zu sein. Brandmanns Anwalt spielte die Tatsachenbehauptungen herunter, keinen Rechtsrat zu geben und nur mögliche Verstöße aus sozialen Medien zu "monitoren". Die FDP-Politikfunktionärin erklärte in vorauseilendem Gehorsam, das Meme mit einer abgewandelten "Schwarzkopf"-Reklame als Habeck-Kritik mit dem Titel "Schwachkopf Professionell" selbst nicht anzuzeigen. Dennoch hat die geschäftstüchtige Agentur-Chefin im Dienst gegen vermeintlichen Hass und Hetze mit ihrer Agentur zahlreiche potenziell rechtswidrige Behauptungen aufgestellt, und wurde dafür von einem Berliner Rechtsanwalt in sage und schreibe acht Fällen - unter anderem wegen der Erfolgsbehauptungen - abgemahnt.
Bekannt wurde die Agentur "So Done", nachdem der - wegen seiner "Schwachkopf"-Anzeige und insgesamt mehr als 800 Strafanzeigen in der laufenden Legislatur-Periode in massive Kritik geratene - Schleswiger Grüne Noch-Bundestagsabgeordnete Robert Habeck am Rande des Grünen-Parteitages gegenüber der "Tagesschau" erklärte, als Unterstützung Agenturen für das Aufspüren von vermeintlichen Politiker-Beleidigungen zu beschäftigen.
Unabhängige und bürgerliche Medien spürten daraufhin die Werbeaussagen des Grünen Vorzeigekunden Robert Habeck und von NRW-Ministerpräsident Henrik Wüst auf der Firmenseite der FDP-nahen Schnüffel- und Anschwärz-Agentur "So Done" aus Rheine in NRW auf. Zudem nahmen sich kritische Anwälte die Schnüffel-Agentur näher vor und wurden gleich mehrfach fündig.
So mahnte Medienrechtler Joachim Steinhöfel CDU-Ministerpräsident Henrik Wüst dafür ab, mit seinem Werbetext für die FDP-nahe Anschwärz-Agentur die Neutralität zu verletzen. Minister Habeck lies sein offizielles Regierungsfoto gegen ein Privatbild austauschen und firmiert in der Agentur-Eigenwerbung nicht mehr als Minister, sondern nur noch als Abgeordneter. Steinhöfel hat mit höchstrichterlichem Urteil abgemahnt, da die Werbung eines Ministers für ein Unternehmen gegen die Pflicht zur neutralen Amtsführung verstößt.
Pikant: Brandmann wirbt auf ihrer Website von "So Done" neben den Logos linker oder links-manipulativer Medien, wie "Spiegel"; "Tagesschau" und "Tagesthemen", auch mit dem "Gründerpreis NRW - MUT". Dort kassierte sie mit ihren Mitgründern, dem Ex-FDP-Abgeordneten und Parteifunktionär Alexander Brockmeier und dem selbst ernannten Desinformations-Spezialisten Marcel Schliebs, 10.000,- € aus dem Steuersäckel für ihre Geschäftsidee einer Schnüffel- und Anschwärz-Agentur für Politiker der Altparteien von CDU bis Grünen. Medienanwalt Joachim Steinhöfel verurteilte das Geschäftsprinzip, für das Wüst bis zur Abmahnung Pate stand und Habeck immer noch mit seinem Namen steht, als „erbarmungslose Hetzjagd“, die „Bürger zur Beute“ mache: „Die Kommerzialisierung eines solchen gegen Machtkritik gerichteten Geschäftsmodells ist sittenwidrig und passt nicht zu einem freiheitlichen Staat“, so der kritische Jurist.
-
Belegschaft des "absolut arroganten" Otto-Versandes haben nach neuen Arbeitszeitregelungen offen Existenzängste.
 |
Von Anstand über Assets zum Absturz: Jetzt geht das Personal auf die Barrikaden.
Foto: HANSEVALLEY |
Hamburg, 28.11.2024: Die finanziellen Probleme des überalterten Hamburger Versandhauses "Otto" schlagen in der Bramfelder Zentrale mit ihren nur noch rd. 5.000 Mitarbeitern immer härter durch: Bei einer Betriebsversammlung ("Townhall-Meeting") am 14. November d. J. mit 3.000 Beschäftigten vor Ort und per Video traten die Existenzängste vieler langjährig aber auch in Teilzeit beschäftigter Angestellter offen zu tage.
Bereits zuvor gab es im Intranet einen "Shitstorm" gegen die "Otto"-Vorstände mit rd. 250 z. T. sehr kritischen Beiträgen, der bis heute anhält. In der Belegschaft herrscht nach den jüngsten Entscheidungen des Vorstandes eine Mischung aus Ärger, Wut, Enttäuschung und Existenzängsten. Bislang hatte "Otto" mit PR-Kampagnen rund um "Diversität" oder "New Work" versucht, seine zunehmend abgeschlagene Position im Markt schönzureden.
Der Vorstand des seit mehr als zwei Jahren in den roten Zahlen steckenden Distanzhändlers hatte nach einer großzügigen Homeoffice-Regelung während der Corona-Pandemie für alle Angestellten eine 50-prozentige Anwesenheitspflicht in Bramfeld ohne Rücksicht angeordnet. Damit soll die Mitarbeiter-Produktivität des hinter "Amazon" abgeschlagenen und mit "Ebay", "Galaxus", "Ikea" "Kaufland", "MediaSaturn", "Zalando" & Co. im Verdrängungswettbewerb steckenden "Universal-Versenders" erhöht werden.
Aufgrund des zunehmenden Drucks seitens der Belegschaft ruderte der umstrittene Vorstand z. T. zurück und milderte die strikte Präsenzpflicht auf Team- statt Einzelpräsenz mit einer dreimonatigen "Orientierungsphase" von Januar bis März '25 ab. "Otto" spricht in diesem Zusammenhang von "Activity Based Working", dass die Mitarbeiter in ihren Abteilungen flexibel organisieren sollen.
Durch die Verschärfung der Präsenzpflicht fürchten zahlreiche Mitarbeiter, der nach wie vor schlingernde Online-Händler und Marktplatz könnte Mitarbeiter entlassen, um seine Kosten zu reduzieren und sich gesund zu schrumpfen. Personalvorständin Katy Roewer wies die Befürchtungen zurück. Auch der Betriebsrat hat sich eingeschaltet. Er wurde - in bekannter "Otto"-Manier - offensichtlich zunächst nicht in die einschneidenden Pläne mit einbezogen.
Betriebsratsvorsitzende Grit Marlow-Buchholz bestätigte gegenüber dem "Hamburger Abendblatt", dass es in der Belegschaft auf dem "Otto"-Campus "weiter brodele". Die Gewerkschaftsvertreterin fordert vom Vorstand, dass die Arbeitnehmervertretung in die geplanten Änderungen der Homeoffice-Regelung einbezogen wird. Dies ist nach der "Abendblatt"-Berichterstattung vom Dienstag d. W. (26.11.24) offenbar immer noch nicht passiert.
„Wir werden täglich von Kollegen mit ihren persönlichen Problemen und in Härtefallsituationen angesprochen. Es gibt Existenzängste“, so Marlow-Buchholz gegenüber der Hamburger "Funke"-Zeitung. Die Mitarbeiter kritisieren den Verlust von Werten und Integrität seitens der "Otto"-Geschäftsführung. Auch die Kommunikationsstrategie steht unter Beschuss. Für ihre einsamen Entscheidungen wurde "Otto" zuvor bereits von unbegründet rausgeschmissenen Marktplatz-Händlern öffentlich kritisiert. Ein Dienstleister nannte das Klima in der Zusammenarbeit sogar als "absolut arrogant".
Weitergehende Hintergründe zu Entwicklung des einst stolzen Schuh- und Versandhändlers der Familie Otto zum "absolut arroganten" Online-Händler sind in der Investigativ-Geschichte "Assets stand Anstand: Der tiefe Fall des Otto-Versands" - bis heute mit mehr als 2.300 Lesern zu finden. -
Unqualifizierte Wirtschafts-Asylanten bringen nichts für den Hamburger Arbeitsmarkt. Automation und KI sind die Lösung.
 |
Die Handelskammer spricht in Sachen Fachkräfte und Asylanten Klartext.
Foto: HANSEVALLEY |
Hamburg, 27.11.2024: Der Wirtschaft an Alster und Elbe fehlen bis zum Jahr 2040 fast 200.000 Fachkräfte. Das zeigt der "Arbeitsmarktmonitor" des Hamburgischen Welt-Wirtschafts-Instituts HWWI im Auftrag der Handelskammer. Besonders dramatisch ist die Lage in den Bereichen Verkehr und Logistik, Schutz und Sicherheit (45.000) sowie in der Rohstoffgewinnung, Produktion und Fertigung (40.000).
„Der Fachkräftemangel ist schon lange ein Dauerbrenner unter den Geschäftsrisiken der Hamburger Wirtschaft, der sich nochmal dramatisch verschärfen wird“, so Sascha Schneider, Vizepräses der Handelskammer Hamburg. „Für mehr als die Hälfte der Unternehmen wirkt sich die vergebliche Suche nach Fachkräften unmittelbar auf die betriebliche Entwicklung aus".
Der HWWI-"Arbeitsmarktmonitor" prognostiziert, wie sich Politik und Rahmenbedingungen uf den Fachkräftemangel auswirken. „Die Zuwanderung hat aktuell nur einen geringen Einfluss auf den Fachkräftemangel, denn der überwiegende Anteil sind geringqualifizierte Personen. Der Effekt würde deutlich höher ausfallen, wenn vorrangig ausgebildete Fachkräfte zuwandern und mit weniger bürokratischem Aufwand in den Arbeitsmarkt integriert werden könnten“, analysiert Michael Berlemann, wissenschaftlicher Leiter des HWWI.
"Unternehmen sollten dem Fachkräftemangel viel stärker mit Innovation und Technologieoffenheit begegnen“, betont Malte Heyne, Hauptgeschäftsführer der Handelskammer Hamburg. „Automatisierungen und der Einsatz von Künstlicher Intelligenz können gerade in den stark betroffenen Branchen, wie der Logistik und der Industrie, eine Lösung sein. Und die Politik ist gefordert, endlich wirksame Schritte zu gehen."
-
EDEKA, Marktkauf und Netto wechseln zu Payback. Kommen REWE, Penny und DM im Gegenzug zu Deutschlandcard?
 |
Auch die EDEKA-Tochter Netto setzt ab 1.1.25 auf Payback statt Deutschlandcard.
Foto: Netto Marken-Discount |
Hamburg, 22.11.2024: Deutschlands größter Lebensmittelhändler - der Hamburger "EDEKA-Verbund" - wechselt mit seinen rd. 3.400 selbständigen Kaufleuten und insgesamt mehr als 11.000 Filialen zum Jahreswechsel 2024-2025 vom "Bertelsmann"-Bonuspunkte-Programm "Deutschlandcard" zum Konkurrenten "Payback" von "American Express". Mit dabei sind auch die zu "EDEKA" gehörenden rd. 160 Verbrauchermärkte von "Marktkauf" und die "EDEKA"-Discounter-Tochter "Netto" (ohne Hund) mit bundesweit 4.350 Filialen.
Mit der "EDEKA"-Gruppe verliert "Deutschlandcard" einen seiner stärksten Handelspartner im Bonuspunkteprogramm. Aktuell nutzen mehr als 20 Mio. Kunden das in München beheimatete Datenauswertungsprogramm. Laut aktuellen Andeutungen in der "Deutschlandcard"-Werbung und unbestätigten Informationen von HANSEVALLEY könnten die "EDEKA"-Konkurrenten" "REWE" mit über 3.800 Filialen, dessen Discounter-Tochter "Penny" mit mehr als 2.130 Filialen und der mit "REWE" kooperierende Drogeriemarkt "DM" mit über 2.100 Filialen im Gegenzug zu "Deutschlandcard" wechseln.
Bislang wurde offiziell verkündet, dass "REWE" mit "Penny" eigene Bonuspunkte-Programme in seinen Kunden-Apps einrichten und aufbauen wolle. Zudem geht die aktuelle "EDEKA"-Werbung für die künftige Partnerschaft mit "Payback" noch davon aus, dass "DM" bei "Payback" bleibt. Sollten sich die Informationen erhärten, würde es zu einem Tausch der Bonuspunkteprogramme der beiden größten Lebensmittel-Händler und ihrer Discounter kommen.
Kunden von "EDEKA", "Marktkauf" und "Netto" können ihre gesammelten "Deutschlandcard"-Punkte noch bis Ende Februar '25 in gewohnter Weise bei ihren Lebensmittel-Geschäften einlösen. Zudem können die Verbraucher ab 1. Januar '25 mit "Payback" als Karte, in der Bonuspunkte-App und integriert in die Kunden-Apps von "EDEKA" und "Netto" Punkte sammeln und einlösen. Offen ist, ob das Bezahlsystem "Payback Pay" auch in die Apps von "EDEKA" und "Netto" integriert wird.
"EDEKA" erhofft sich laut des Branchenblatts "Lebensmittel-Zeitung" mit dem Wechsel zu "Payback" vor allem „eine höhere Reichweite, effektivere und gezieltere Werbeanstöße sowie bessere Kundendaten“. Unterdessen macht sich der "EDEKA"-Konzern erneut unbeliebt: Laut Online-Portal "Der Westen" will die Hamburger Zentrale von ihren Lieferanten bis zu 2 % des Umsatzes zusätzlich kassieren, um mit "Payback" Kasse zu machen. Die Hersteller legen sich dagegen offenbar quer. Die Hamburger "EDEKA"-Konzernzentrale will sich über die internen Querelen mit seinen Lieferanten nicht öffentlich äußern.
Damit erhebt sich erneut der Verdacht, dass der Hamburger Handelsriese über die Köpfe seiner Partner hinweg Entscheidungen durchdrückt. Zuletzt war "EDEKA" in Verruf geraten, nach dem die Zentrale im Vorfeld der Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen eine völlig verkorkste Anti-AfD-Hetz-Anzeige in "FAZ" und "Zeit" veröffentlichen ließ, um sich bei linken Parteien und Habecks Wirtschaftsministerium für millionenschwere Subventionen einzuschleimen. Daraufhin hatten Händler und Kunden u. a. in Sachsen-Anhalt und ganz Ostdeutschland über "X" massive öffentliche Kritik an der selbstherrlichen Konzernpolitik geübt (HANSEVALLEY berichtete).
-
Studie bescheinigt Hamburg Abwärts-Spirale vom "Tor zur Welt" zur Sackgasse.
 |
Hamburg droht auf Grund seiner Pfeffersack-Mentalität abzurutschen.
Foto: HANSENVALLEY |
Hamburg, 21.12.2024: Die Zufriedenheit der Hamburger mit ihrer Stadt nimmt spürbar ab. Die Einwohner orientieren sich stärker in Richtung Umland und wandern in Außenbezirke und kleinere Städte im Umkreis ab. Das ist eines der Ergebnisse einer aktuellen Studie des Brand Science Institute (BSI), in der mehr als 1.000 Probanden aus der Hansestadt nach ihren Erwartungen und Lebensprioritäten befragt wurden. Ohne eine Neuausrichtung ihrer Strategien riskiert die Freie und Hansestadt, im Wettbewerb um Lebens- und Arbeitsqualität den Anschluss an "Second Cities" wie z. B. Lübeck zu verlieren.
Während mittelgroße Städte durch Flexibilität und Innovationen florieren, kämpft Hamburg nach Ansicht der Probanden mit den Nachteilen einer überfüllten, zunehmend unpersönlichen Großstadt. Sie sehen das Umland im Aufstieg. Danach wird die Metropolregion zunehmend als Rückzugsort wahrgenommen, der Freiheit, Sorglosigkeit und eine gesunde Umgebung bietet - eine Alternative zur überfüllten, vom Tourismus geprägten Metropole.
Das Image Hamburgs als "Tor zur Welt" steht nach Ansicht der befragten Hamburger infrage, wenn die Stadt ihre Strukturen nicht an die veränderten Erwartungen anpasst und sich weiter lediglich auf den Faktor Tourismus konzentriert. Die Hamburger wünschen sich im Zentrum und in den Stadtteilen Angebote, die digitale Innovationen mit physischer Präsenz kombinieren: Click-and-Collect-Services, lokale und digitale Outlets sowie personalisierte Erlebnisse, die nicht nur praktisch, sondern auch emotional ansprechend sind.
Während sogenannte "Second Cities" bereits nahtlose Übergänge zwischen Online- und Offline-Angeboten bieten, bleiben solche Ansätze in Hamburg weitgehend ungenutzt oder werden nicht ausreichend wahrgenommen. Ohne eine gezielte Digitalisierung regionaler Angebote kann Hamburg langfristig an Attraktivität als Lebens- und Wirtschaftsstandort für seine Bewohner verlieren, fasst die Studie zusammen.
Die Ergebnisse verdeutlichen, dass sich Hamburg nach Ansicht seiner Einwohner im Wettbewerb mit aufkommenden "Second Cities" positionieren muss. Mittelgroße Städte setzen auf Lebensqualität, Nachhaltigkeit und digitale Exzellenz, während Hamburg Gefahr läuft, in traditionellen Strukturen und einer einseitigen Ausrichtung auf den Tourismus zu verharren. Ein exemplarisches Beispiel für eine sich digitalisierende "Second City" als "Smart City" ist aus Beobachtungen des Hanse Digital Magazins die Hansestadt Lübeck.
"Der Trend zur Abwanderung in kleinere Städte im Umland zeigt, dass viele Hamburger nach mehr Freiraum, Nähe zur Natur und einem geringeren urbanen Druck suchen. Parallel dazu hat die Pandemie globale Dynamiken verstärkt, die Second Cities für Hamburger als zukunftsweisende Alternativen etablieren. Diese Städte kombinieren Lebensqualität mit effizienter Infrastruktur und bieten somit eine attraktive Alternative zu den oft stagnierenden Metropolen", erläutert Prof. Nils Andres, Gründer und Geschäftsführer des Brand Science Institute (BSI). "Dieser lokale Wandel ist Teil eines globalen Phänomens. Die wachsende Bedeutung von Second Cities prägt unsere Städte und verändert grundlegende Strukturen."
Hamburg muss aus Sicht der Probanden mutige, zukunftsorientierte Schritte unternehmen, um seine Attraktivität und Relevanz nicht nur für Touristen, sondern auch bei seinen Einwohnern zu sichern. Dazu gehört die Stärkung regionaler Angebote, die Förderung hybrider Lebens- und Konsummodelle sowie eine konsequente Digitalisierung städtischer Strukturen. Die Zukunft liegt in der Fähigkeit, das Beste aus globaler Innovation und lokaler Nähe zu vereinen. Hamburg hat durch seine Weltoffenheit dabei die Chance, eine Balance zwischen Metropole und "Second City" zu schaffen - sofern es jetzt handelt, so die Studie.
-
Grüne Spitzekandidaten Habeck und Baerbock bombadieren in drei Jahren Ampel fast 1.500 Kritiker mit Strafanzeigen.
 |
Die Grünen Ampel-Minister Habeck & Baerbock im Kampf gegen der Rest der Republik.
Grafik: Statista |
Berlin, 19.11.2024: Der am vergangenen Wochenende in Wiesbaden trotz drohender Einstelligkeit seiner Partei mit 96 % zum "Kanzlerkandidaten" der Grünen gekührte Robert Habeck ist Deutschlands aktivster Anzeigen-Schreiber gegen Kritiker seiner Person im Internet. Dabei werden laut Medienberichten auch harmlose Kritiken auf Social Media mit staatlicher Strafverfolgung überzogen.
Der im Dezember 2021 zu einem der Vizekanzler der mittlerweile gescheiterten Ampel gewählte gebürtige Lübecker spannte im Zeitraum September 2021 bis August 2024 insgesamt 805-mal Polizei, Staatsanwaltschaften und Gerichte gegen Kritiker vor allem im Internet für seine ideologischen Zwecke ein. Aktuell steht Habeck in der Kritik, wegen eines Memes mit dem Titel "Schwachkopf-Professional" einen 64-jährigen Rentner und seine 13-jährige schwerkranke Tochter morgens um 6.15 Uhr mit einer Hausdurchsuchung in Angst und Schrecken versetzt zu haben.
 |
Die Anzeige gegen den Urheber des Internet-Memes brachte Habeck in die mediale Schußlinie.
Meme: Stefan Niehoff, mit KI bearbeitet |
Eine offizielle Aufstellung des Bundesjustizministeriums - nachzulesen bei "Statista" - zeigt: Mit mehr als 800 Strafanzeigen - nach eigenen Angaben von Recherche-Agenturen für ihn ermittelt - toppt der in der vergangenen Woche wegen einer "Schwachkopf"-Anzeige in die Schußlinie von Kritikern und Medien geratene Bundestagsabgeordnete des Wahlkreises Flensburg-Schleswig sogar seine gebürtige Hannoveraner Parteifreundlin Annalena Baerbock.
Die zuletzt wegen geheimgehaltenen, auf Steuerzahlerkosten veranstalteten Abendessen mit juden- und israelfeindlichen Palästinenser-Aktivisten umstrittene Außenministerin der zerbrochenen Ampel bringt es im selben Zeitraum 2021 bis 2023 auf 513 u. a. persönlich initiierte Strafverfolgungen gegen Kritiker. Die beiden auf dem Jubel-Parteitag gekürten Grünen Spitzenkandidaten für die vorgezogene Bundestagswahl am 23. Februar '25 bringen zusammen allein 1.318 Strafanzeigen zusammen.
Interessant: Die im Ranking folgenden Bundesminister, Ex-FDP-Justizminister Marco Buschmann und Ex-FDP-Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger, erstatteten lediglich 26 bzw. 24 Anzeigen. Selbst die Grünen Partei- und Regierungsfreunde Cem Özdemir und Lisa Paus zeigten im genannten Zeitraum lediglich 14 bzw. 10 Fälle von Beleidigung und anderen tatsächlichen oder vermeintlichen Straftaten an.
Sieben Bundesminister hielten es in den vergangenen drei Jahren gar nicht für nötig, Online-Kritiker mit Hausdurchsuchungen und Gerichtsprozessen zu überziehen - oder machten falsche Angaben auf die AfD-Anfrage im Bundestag. Unter ihnen ist auch SPD-Innenministerin Nancy Faeser. Dabei spielt für Habeck und Baerbock vor allem der Politiker-Paragraf 188 StGB eine besondere Rolle. Er schützt Politiker bei Beleidigungen, die nachteilig für ihr Amt sein können.
Habeck erklärte in einer PR-Verlautbarung gegenüber dem Ampel-nahen ARD-Politikmagazin "Bericht aus Berlin", er habe sich zu Beginn der Legislaturperiode entschieden, "Beleidigungen und Bedrohungen zur Anzeige zu bringen".
 |
Auf persönliche Strafanzeige von Robert Habeck fiel die Kripo Steinfurt morgens um 6.15 Uhr ein.
Foto: Quelle Christoph Lemmer/Netzwerk X |
Mit der durch die Staatsanwaltschaft Bamberg übertrieben initiierten Hausdurchsuchung bei dem 64-jährigen Rentner Stefan Niehoff aus dem bayerischen Hofheim und seiner am Down-Syndrom erkrankten Tochter im Zusammenhang mit dem "Schwachkopf"-Skandal geriet Habeck in der vergangenen Woche bei Wählern, Kritikern, Social-Media-Nutzern und Medien in die öffentliche Schusslinie. Habeck hatte zu seiner Rechtfertigung gegenüber der ARD antisemitische Aktivitäten als maßgeblichen Grund für die morgendliche Hausdurchsuchung mit Beschlagnahmung eines Tablets unterstellt. Maßgeblich waren laut Pressemitteilung jedoch die Paragraphen 185, 188 und 192 StGB.
Die Statistik zu den Strafverfolgungs-Aktivitäten der Grünen Anzeigenschreiber Habeck und Baerbock kann bei "Statista" eingesehen werden. Die Kollegen des Nachrichten-Portals "NIUS" sammeln aktuell weitere Fälle u. a. wegen irrwitziger Strafverfolgungen durch Habeck & Co. Opfer der Grünen Strafanzeigen-Kanonade melden sich per E-Mail unter schwachkopf@nius.de. Weitere Informationen zu den Recherchen des unabhängigen Berliner Nachrichten-Mediums gibt es auf nius.de
-
40 % der deutschen Schüler können Computer nicht richtig bedienen.
 |
Deutsche Schüler werden am Computer immer schlechter.
(Foto: Ivan Aleksic, Unsplash) |
Paderborn, 18.11.2024: Eine internationale Studie zu den digitalen Fähigkeiten von Achtklässlern hat erschreckende Entwicklungen zu Tage gefördert: Danach besitzen mehr als 40 % (40,8 %) der Schüler nur wenige Grundkenntnisse in der Nutzung von Computern und mobilen Geräten. Die Fähigkeiten sind in den vergangenen 10 Jahren massiv um mehr als 10 % zurückgegangen (2013: 29,2 % Problemschüler).
Bei dem Computertest wurden die Fähigkeiten der Jugendlichen geprüft, wie gut sie mit bestimmten Programmen umgehen können und ob sie in der Lage sind, vorgestellte Informationen auf ihren Wahrheitsgehalt hin überprüfen und einordnen zu können. Nur ein kleiner Teil konnte mit dem PC weitgehend sicher umgehen.
Nur 1,1 % der deutschen Schüler erreichen die höchste Kompetenzstufe (2013: 1,9 %). Als Krönung sollten die Schüler für jüngere Mitschüler am Computer einen digitalen Rundgang für ein Museum entwickeln. Die deutschen Gymnasiasten schnitten übrigens überdurchschnittlich gut ab.
Dem neu eingesetzten Bundesbildungsminister Cem Özdemir bereite es Sorgen, dass die digitalen Kompetenzen auch an soziale und herkunftsspezifische Faktoren gekoppelt seien, so der Grünen-Politiker in einem Statement. Lehrkräfte müssten Kindern auch einen sicheren und selbstbestimmten Umgang mit digitalen Medien vermitteln können, zitiert die "Tagesschau" den Minister.
"Diese 40 Prozent der Jugendlichen, von denen wir denken, dass sie Digital Natives sind, können im Grunde genommen nur klicken und wischen", sagte die Studienleiterin Birgit Eickelmann während einer Pressekonferenz in der Kultusministerkonferenz von Bund und Ländern in Berlin.
Für die Studie wurden im Frühjahr und Sommer '23 in Deutschland bundesweit 5.000 Schüler der 8. Klassen aller Schultypen an Computern getestet. Außerdem waren rd. 2.300 Lehrer an 230 Schulen an der Studie beteiligt. International wurden im Rahmen der globalen Studie Schüler aus 30 Ländern befragt, davon aus 22 EU-Staaten. Deutschland schneidet weltweit auf Platz 13 im oberen Mittelfeld ab.
-
Ministerpäsident Günther erwartet von SH-SPD-Chefin öffentliche Entschuldigung zur KI-Manipulation durch Segeberger MdB.
 |
Daniel Günther hat die Schnauze voll von einer manipulativen SPD im Land.
Foto: CDU SH/Makoschey |
Kiel, 15.11.2024: Schleswig-Holsteins Ministerpräsident und CDU-Landesvorsitzender Daniel Günther zählt die SPD-Chefin des SH-Landesverbandes - Serpil Midyatli - öffentlich für die KI-Manipulation einer Rede von Friedrich Merz durch den Segeberger SPD-Bundestagsabgeordneten Bengt Bergt an. Anlass für den offenen Brief ist das Totschweigen der unethischen Manipulation durch die SPD-Oppositionsführerin im Kieler Landtag.
Das auf dem Instagram-Account des gebürtigen Brandenburgers Bergt veröffentlichte KI-Video legte dem CDU-Bundes- und Fraktionsvorsitzenden Friedrich Merz mittels künstlicher Intelligenz vorsätzlich Falschaussagen in den Mund. So wird dem CDU-Chef unterstellt, die Demokratie zu verachten und nur aus parteitaktischen Gründen auf eine schnelle Neuwahl zu dringen. Eingeblendet ist dabei der Hinweis: "Achtung: Künstliche Inkompetenz".
Lukas Kilian, CDU-Generalsekretär in Schleswig-Holstein, nannte die KI-Manipulation in einer ersten Stellungnahme als "ekelhaften Schmutz und AfD-Methoden". SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich kündigte seinerseits an, dass er beim Erhärten des Verdachts dafür sorge, "dass dieser oder diese Abgeordnete sich bei Ihnen entschuldigt, Herr Kollege Merz".
In seinem offenen Brief legt Daniel Günther nach: "Es sorgt in meiner Partei allerdings zunehmend für Unverständnis, dass es bis heute kein einziges öffentliches Wort der Distanzierung durch Dich als Vorsitzende der SPD Schleswig-Holstein gegeben hat. Im Gegenteil: Du hast Dich bewusst in Schweigen gehüllt und Deinen Sprecher rechtfertigende Worte und Vorwürfe gegen die CDU Schleswig-Holstein formulieren lassen".
Günther setzt der offenbar feige Deutsch-Türkin Midyatli die Pistole auf die Brust: "Gerade in Schleswig-Holstein pflegen wir seit vielen Jahren einen fairen Umgang zwischen den demokratischen Parteien. Umso mehr irritiert auch mich Dein Schweigen in dieser Angelegenheit. Um wieder zu einem fairen Umgang zurückzukehren, erwarte ich für meine Partei eine klare Distanzierung durch Dich, mindestens in der Form, wie es der Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion getan hat."
Der "Spiegel" hatte über die als Satire getarnte KI-Manipulation des Segeberger SPD-Abgeordneten zuerst berichtet. (Foto: CDU SH/Makoschey) Redaktioneller Hinweis: Das norddeutsche Digitalisierungsmagazin HANSEVALLEY schließt die Darstellung von politischen Position und Zielen seitens Volksvertretern und politischen Parteien aus, die künstliche Intelligenz vorsätzlich missbrauchen, um damit politische Gegner öffentlich herabzusetzen und zu verunglimpfen. Die Redaktion arbeitet gemäß des Hanse Digital Codex HANSECODEX. -
Neues Klinik-System am UKE in Hamburg droht zu scheitern und landet vor Gericht.
 |
Auf den Stationen des UKE wird weitgehend digital gearbeitet.
Foto: HANSEVALLEY |
Hamburg, 13.11.2024: Das renommierte Universitätsklinikum "UKE" ist mit der Einführung eines neuen, allumfassenden Klinik-Informations-Systems für mind. 28 Mio. € Kosten u. a. durch häufige Systemabstürze in schweres Fahrwasser geraten, wie das Wirtschaftsmagazin "Business Insider" berichtet. Im Mittelpunkt steht die KIS-Software "G3-Clinical" des bekannten deutschen Herstellers "CompuGroup Medical" aus Koblenz.
Das inhabergeführte Unternehmen hat die millionenschwere Neuentwicklung in mehr als 10 Jahren konzipiert. Im Hamburger "UKE" soll "G3-Clinical" erstmals in allen Bereichen eingesetzt werden und das bisherige "KIS" ablösen. Dies ist zugleich die größte geplante Installation in einer deutschen Klinik. Stattdessen liegt das IT-Projekt für mehr als 15.000 Arbeitsplätze in Eppendorf weit hinter dem Zeitplan und sorgt für Frust bei zahlreichen Mitarbeitern, berichtet "Business Insider".
Das der Hamburger Wissenschaftsbehörde unterstellte Universitätsklinikum hat gegen den Hersteller "CGM" aufgrund millionenschwerer Mehrkosten und massiver Verzögerungen rechtliche Schritte eingeleitet. "CGM" hatte sich 2021 in einer 2-jährigen, europaweiten Ausschreibung gegen den Wettbewerb durchgesetzt. Der Echtzeitbetrieb sollte bereits 2022 in der zum UKE gehörenden "Martini-Klinik" beginnen.
-
About You bringt eigenes Bezahlsystem für Online-Händler.
 |
Die Otto-Tochter About You will auch mit Zahlungsabwicklung mitmischen.
Grafik: Scayle |
Hamburg, 08.11.2024: Nach der Online-Handelsplattform für E-Commerce-Shops namens "Scayle" hat die "Otto"-Versand-Tochter "About You" eine eigene Firma für Online-Bezahldienste gegründet. Mit "Scayle Payments" will das vom umstrittenen Hamburger Online-Marketer Tarek Müller mitgegründete E-Commerce-Unternehmen auch beim Bezahlen u. a. über "Scayle" mitverdienen.
Mit der 2024 durch die BaFin erteilten Genehmigung für Zahlungsdienste will der Newscomer noch bis zum Ende des Geschäftsjahres im Februar 2025 beginnen, seinen Marktplatz-Partnern auf "About You" wie den extern betreuten Online-Shops die selbst entwickelten Zahlungsservices anbieten. Aktuell arbeiten daran nach eigenen Angaben rd. 50 Mitarbeiter daran.
Damit tritt "Scayle Payments" auch in Konkurrenz zum konzerninternen Zahlungsdienst "Otto Payments", der vor allem die Marktplatz-Händler auf dem ins Trudeln geratenen Online-Markplatz "Otto.de" die Zahlungsabwicklung abnimmt. "Otto Payments" wurde erst vor 2 Jahren als Zahlungsdienste-Anbieter zugelassen.
Somit gibt es im überalterten, konservativen, sich aber links-woke verkaufenden "Otto"-Konzern sowohl zwei konkurrierende Zahlungsdienste-Anbieter, als auch zwei Online-Handelsplattform, neben "Scayle" auch "OSP" aus Dresden. Unter dem Strich setzt der tief verschuldete und als "absolut arrogant" geltende "Otto"-Konzern seine teuren Mehrfachstrukturen fort.
Das die Umsatzzahlen des Pennystock "About You" rettende Shop-System mit externen Nutzern, wie "Baby-Walz", "Babymarkt", "Deichmann", "Depot", "Fielmann", "Marc O' Polo", "Mister Spex" und "S. Oliver" besteht im Kern aus Shop-, Bestell- und Produkt-Management, Checkout-Services sowie diversen Marketing-Tools. Im vergangenen Jahr expandierte "Scayle" vor allem in die Benelux-Länder, nach UK und in die Nordics.
-
Bundesdruckerei versemmelt mit verstricktem IT-Dienstleister digitales Vorzeigeprojekt von grüner Aussenministerin Baerbock.
 |
Groß im Töne spucken, aber digital bringt die Grüne Baerbock nichts voran. (Foto: Olaf Kosinsky, Lizenz: CC-BY-SA-3.0-DE)
|
Berlin, 04.11.2024: Der links-grünen Außenministerin Annalena Baerbock fliegt ihr als digitales Prestigeprojekt ausgerufene "Auslandsportal" um die Ohren. Mit großer Hoffnung ging das von der staatlichen Berliner "Bundesdruckerei" zusammen mit dem privaten Berliner IT-Dienstleister "Init AG" entwickelte Portal für Visasangelegenheiten Mitte 2022 online.
Eine kleine Anfrage der AfD-Fraktion im Bundestag hat jetzt zu Tage gebracht: Das im Rollout befindliche "Auslandsportal" wird von den Konsularabteilungen kaum genutzt. Lediglich 88 der 167 Vertretungen haben das Portal bereits in Betrieb genommen. Im vergangenen Jahr gab es gerade einmal 866 Anträge über das IT-System, im laufenden Jahr bis Mitte Oktober nur 2.117 Verfahren.
Obendrein entwickelt sich das IT-Projekt zunehmend zu einem handfesten Skandal: Die mit dem Millionenauftrag betraute, staatliche "Bundesdruckerei" zeichnet laut Auswärtigem Amt verantwortlich für teils schwerwiegende Softwareprobleme. Die generell kommunikativ verschlossene Bundesdruckerei schiebt den schwarzen Peter an den externen Berliner Portal-Entwickler "Init AG" ab, der verantwortlich sei.
Besonders negativ stößt eine durch das Wirtschaftsmagazin "Business Insider" aufgedeckte Millionenschieberei auf: Eine für das "Auslandsportal" beim Auswärtigen Amt verantwortliche Mitarbeiterin wechselte Ende 2023 zur "Init AG". Dort wurde sie ebenfalls für das Portalprojekt verantwortlich - und bekam mit "Init" den Zuschlag über 6 Mio. € Budget. Nur eines von mehreren Beispielen personeller Verquickungen zwischen Auswärtigem Amt und "Init".
In der im September 2022 vorgestellten Digitalstrategie der Bundesregierung bewirbt die Ampel-Koalition ihr jetzt scheiterndes Pilotprojekt: „Wir entwickeln das Auslandsportal zur Digitalisierung der Prozesse im Rechts- und Konsularbereich für krisenresiliente und kundenfreundliche Verwaltungsdienstleistungen bei der Beantragung und Ausstellung von Visa und Pässen. So fördern wir ein modernes Deutschlandbild im Ausland und erhöhen unsere Attraktivität für hochqualifizierte Fachkräfte."
In der Schusslinie steht auch der externe Dienstleister des Auswärtigen Amtes, "Visametric". Das Unternehmen soll dubiose Beziehungen nach Moskau pflegen. "Visametric" gehört zu 60 % dem türkischen Unternehmen "iData", zu 40 % dem arabischen Investmentfonds "VMS Investments". Die kritisierte Firma wickelt u. a. die Visaangelegenheiten für das Auswärtige Amt im Iran und weiteren Staaten ab. Bereits im Mai '23 wurde ein Leiter von "VisaMetric" in Prestina verhaftet.
Im Jahr 2023 wurden weltweit 1,9 Mio. Visaanträge in den Konsularabteilungen gestellt und bearbeitet. In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres waren es bereits rd. 1,6 Mio. Anträge. Diese sollen ab Januar 2025 flächendeckend weltweit digital über das kritisierte und im Scheitern befindliche "BDR"-Portal abgewickelt werden.
-
Nur noch 1/3 der unter 30-Jährigen vertrauen ARD, ZDF & Co. als verlässliche Nachrichtenquelle - 2/3 der deutschen Journalisten ticken links.
 |
Hamburgs Bürgermeister Tschentscher (mi.) posiert im vom Senat mitfinanzierten Newsroom.
Foto: NDR-Hendrik Lüders |
Erfurt/Dortmund, 01.11.2024: Die junge Generation der heute 18- bis 29-Jährigen vertraut den öffentlich-rechtlichen Sendern von ARD, ZDF und DLR nur noch zu 33 %. Dagegen misstrauen 37 % der Generationen "W" und "Z" den politisch gesteuerten Hörfunk- und Fernsehsendern in Deutschland. Rd. 30 Prozent der jungen Bevölkerung kann oder will sich kein Urteil über den in diesem Jahr erstmals mit mehr als 10 Milliarden Euro subventionierten, staatsnahen Rundfunk machen.
Auch in der Gesamtbevölkerung der Bundesrepublik stürzt das Vertrauen in die regierungsnahen Radio- und TV-Sender ein: So vertrauen mit 47 % weniger als die Hälfte der Bundesbürger ARD, ZDF und DLR in der Nachrichten- und Informationsvermittlung. Das sind zentrale Ergebnisse einer aktuellen, repräsentativen Studie des Erfurter Markt- und Meinungsforschungsinstituts "INSA".
Die weitgehend aus Zwangsgebühren der "GEZ" finanzierten Sender auf Bundes- und Landesebene können nur noch auf die Hochbetagten über 70 Jahre setzen. Diese vertrauen den in den vergangenen Wochen und Monaten u. a. wegen fortlaufender Manipulation in der Gaza-Berichterstattung in die Kritik geratenen Sendern noch zu 67 % und damit mehrheitlich zu rd. 2/3.
Die Tagesschau hat heute ein Durchschnittsalter seiner Zuschauer von 62 Jahren. Lediglich 20 % der Zuseher um 20.00 Uhr ist heute unter 50 Jahre alt. Von den durchschnittlich rd. 9 Mio. € Zuschauern der ARD-Hauptnachrichtensendung sind nur noch rd. 400.000 junge Zuschauer in der Altersgruppe unter 30 Jahren. Damit droht der Produktion von "ARD Aktuell" beim NDR in Hamburg ein langjähriger Abstieg durch zunehmend wegsterbende alte und zugleich fehlende junge Zuschauer.
"INSA"-Chef Hermann Binkert brachte gegenüber dem Debattenmagazin "The European" auf den Punkt: „Die bei Jüngeren deutlich abnehmende Akzeptanz der öffentlich-rechtlichen Sender als vertrauenswürdige Quelle für politische Informationen sollte von den Verantwortlichen als dringender Appell begriffen werden, die eigenen Inhalte kritisch zu überprüfen und insbesondere eine solche Ausgewogenheit herzustellen, dass auch junge Leute ihnen Vertrauen schenken.“
 |
Zwei Drittel der deutschen Journalie tikt ausgesprochen links.
Grafik: INSA |
Zeitgleich mit den vernichtenden Ergebnissen zur Glaubwürdigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunksystems im Zusammenhang mit Nachrichten und Informationen hat die Technische Universität Dortmund in Ihrer aktuellen Studie zu "Demokratie und Journalimus" festgestellt: rd. 2/3 der Journalisten in Deutschland ticken politisch ausgesprochen links.
Während die linken Parteien SPD, Grüne, Linke und BSW je nach Sonntagsfrage aktuell auf nur noch auf rd. 33,0 bis 37,5 % kommen ("Infratrest Dimap" v. 31.10.24 bzw. "INSA" v. 28.10.24) hält die deutsche Journalie zu 64 % und damit zu rd. 2/3 zum Linksblock im Parteiensystem. Mit 41 % grünen Anhängern verehren deutsche Journalisten besonders die in der Bevölkerung kritisch betrachteten Minister Baerbock, Habeck und Paus. Rechnet man das mit 23 % knappe Viertel an poltisch nicht interessierten Journalisten raus, kommt der Linksblock aus Ampel-, sowie alten und neuen Oppositionsparteien sogar auf eine 82 %-ige Zustimmung. Dagegen wird die in der Bevolkerung von rd. 18-19 % präferierte AfD von der Journalie komplett ausgeblendet.
-
Grüne tarnen "Stasi"-Zensur hinter "Polarisierung" und "Destabilisierung" als "negative Auswirkungen auf Wahlen".
 |
Grüner Strippenzieher Habeck will Zensur nach chinesischem Vorbild.
(Foto/Video: DGAP, Screenshot: HANSEVALLEY) |
Berlin, 28.10.2024: Die links-ideologischen Grünen beabsichtigen, die Meinungsfreiheit im Internet weiter massiv zu beschneiden. Dabei soll der EU-weite "Digital Service Act" zur Regulierung von Social-Media- und anderen großen Plattformen gezielt missbraucht werden, um unliebsame Meinungen mit Hilfe der aktuell genutzten Schlagworte "Polarisierung" und "Destabilisierung der Gesellschaft" zu unterdrücken, nachdem den Grünen die Anti-"Hass und Hetze"-Propaganda die Europawahlen gekostet hat. Mittel zum Zweck ist der vom Grün-geführtem Wirtschaftsministerium unterstützte und der Grün-geführten Bundesnetzagentur eingesetzte rot-grün-geführte "Trusted Flagger" names "REspect".
Wie sich die von einem ausgebildeten Islam-Prediger geleitete, mit grünen Bundes- und Landesmitteln finanzierte, private "Stasi"-Agentur "REspect" die Löschung jenseits strafrechtlicher Vergehen vorstellt, erläuterte der umstrittene und mit einem "Hamas"-Unterstützer posierende Ahmed Gaafar schon 2021 in einer ARD-Reportage: „Wenn es nicht strafrechtlich relevant ist, dann werden wir schon einen Löschantrag beim Provider machen.“ Hinweise, welche nicht strafbaren Inhalte dennoch entfernt werden sollen, liefert der Leitfaden der Bundesnetzagentur für "Trusted Flagger":
Im Anhang der Bewerbungsanweisungen der "Stasi"-Behörde BNetzA findet sich unter dem Punkt einer vermeintlich "Unerlaubten Rede" der Begriff "Hassrede", die es im Strafgesetz nicht gibt. Dabei will BNetzA-Chef Müller mit seinen linken Flaggern alles an politisch nicht genehmer "Hassrede" verbannen, "unabhängig von Medium und Inhalt" - also auch im Alltag und vor Ort, was der "Digital Service Act" der EU nicht hergibt, wie der Name sagt.
Außerdem werden für die Schnüffler von "REspect" & Co. zahlreiche, vermeintlich unzulässige Inhalte“ gelistet, neben „Hassrede“ auch „negative Auswirkungen auf den zivilen Diskurs oder Wahlen“ Das ist die Grundlage hinter der Habeck-Propaganda von "Polarisierung" und "Destabilisierung der Gesellschaft". Die Meldestelle könnte damit alle Beiträge im Netz klassifizieren, die ihnen politisch nicht links genug sind. (HANSEVALLEY berichtete). Führende Juristen halten die Anweisungen der BNetzA für verfassungswidrig.
An oberster Stelle der verantwortlichen - und in einem Jahr zur Bundestagswahl antretenden - Zensur-Minister stehen die Grüne Ideologien und Antifa-Finanziererin des Familienministeriums, Lisa Paus, und Ihr Parteifreund, der grüne Strippenzieher und links-grüne BNetzA-Aufseher sowie Kinderbuchautor Robert Habeck. Als Instrument der Kontrolle versuchen die Grünen, nicht nur soziale Medien für ihre politische Kontrolle zu missbrauchen, sie nehmen dabei sogar das kommunistische Regime Chinas als Vorbild.
Als Beispiel für notwendige Zensur führt Habeck am 17. Oktober d. J. in einem Vortrag vor der Großindustriellen-Lobbyorganisation "DGAP" den US-Unternehmer Elon Musk und sein Social-Media-Netzwerk "X" (vormals "Twitter") ins Feld. Parallel zur Hetz-Kampagne der politisch links-verankerten "Bertelsmann"-Blätter "Spiegel" (Musk als "Staatsfeind Nr. 2" hinter Trump) und "Stern" ("Der Teufelspakt" zwischen Musk und Trump) versucht Habeck, die Unterstützung des "X"-Eigentümers Elon Musk für den US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump als Begründung für notwendige Zensur nach chinesischem Vorbild durchzudrücken (siehe Video im Link). "NIUS"-Redakteurin Pauline Voss rückt die links-grünen Allmachtsfantasien eines Robert Habeck zurecht: "In China herrscht strenge Zensur, die Chinesische Kommunistische Partei entscheidet, welche Zeitungen und Bücher die Bevölkerung lesen, welche Websites und digitalen Plattformen sie überhaupt im Netz aufrufen kann. Staatsmedien verkünden die Botschaften der Regierung. Ausgerechnet dieses Land nennt Habeck nun als Vorreiter einer Regulierung, die er sich auch für öffentliche Äußerungen in Deutschland wünscht." (Foto/Video: DGAP, Screenshot: HANSEVALLEY) Redaktioneller Hinweis des Chefredakteurs als Autor dieser Hanse Digital Nachricht:
Ich werde jederzeit gegen totalitäre Machenschaften in Deutschland aufstehen und lautstark demonstrieren, seien sie heute "Rot" oder "Grün" - im politischen Berlin oder in Bonn, getarnt als "Trusted Flagger" oder "Streitbeilegungsstelle" fernab des Strafgesetzbuches.
Das bin ich als DDR-Stasi-Opfer jedem einzelnen der 340 kaltblütig hingerichteten Mauertoten des totalitären SED-Stasi-Regimes schuldig. Ich verbitte mir von einem Kinderbuchautor gemaßregelt zu werden, was ich in einem freien Land sagen darf und was der rot-grün-linken Ideologie-Regierung nicht genehm ist.
-
FDP-Querschläger Kubicki rettet Hamburger SPD-Antisemitin Özoğuz den 17.000,- €-Job als Bundestagsvize.
 |
Staatsräson ist für den FDP-Juristen Kubicki wohl auch nur noch eine Floskel.
Foto: Olaf Kosinsky. Lizenz: CC BY-SA 3.0-de
|
Berlin/Hamburg, 24.10.2024: Der einflussreiche schleswig-holsteinische FDP-Bundestagsabgeordnete Wolfgang Kubicki hat der angeschlagenen, Islamisten-Freundin der Hamburg SPD - Aydan Özoğuz - offenbar in letzter Minute noch einmal ihren mit gut 16.840,- € dotierten Posten als Bundestagsvizepräsidentin gerettet, und die fortlaufend wegen islamistischer Propaganda im Kreuzfeuer stehende Kollegin im Präsidium vor dem Absturz bewahrt.
Wie das liberal-konservative Magazin "Tichys Einblick" berichtet, hat Kubicki den aktuellen, antisemitischen Insta-Post der wiederholt juden- und israelfeindlichen Deutsch-Türkin in einer eigens anberaumten Sitzung des Ältestenrats aller Bundestagspräsidentenals am vergangenen Freitag als "unappetitlich" beurteilt. Der israelfeindliche Repost mit einem Ausschnitt des brennenden Flüchtlingslagers im "Al-Aksa-Märtyrer-Krankenhaus" in Gaza falle aber unter die Meinungsfreiheit. Die Sache sei damit „erledigt“, so der Jurist im Bundestag.
Bei der CDU sorgte die Ampel-treue Rückendeckung für Empörung: Kubicki habe mit dieser Aussage alles noch schlimmer gemacht, berichtet "Tichys Einblick". Damit hat sich der streitbare Kubicki als nächster FDP-Politiker der links-ideologischen Ampel-Koalition unglaubwürdig gemacht. Der israelische Botschafter in Deutschland, die Deutsch-Israelische Gesellschaft, die Jüdische Gemeinde in Hamburg, die Jüdische Gemeinde sowie AfD, CDU und CSU fordern Konsequenzen aus dem erneuten, schwerwiegenden Ausfall der 57-jährigen Hamburger Antisemitin.
Mit Basta-Statements hatten am Freitag vergangener Woche SPD-Fraktionschef Mützenich und am Montag dieser Woche Hamburgs SPD-Finanzsenator Andreas Dressel versucht, die Debatte um die ausfällige Genossin und ihren erneuten Angriff auf das Existenzrecht Israels im Keim zu ersticken. Die SPD-Chefs Esken und Klingbeil spielen zu dem "Zionismus-Skandal" ebenso "toter Käfer", wie SPD-Kanzler Scholz.
Das von der erkennbaren Antisemitin Özoguz geteilte Bild wurde ursprünglich von der antiisraelischen Gruppe "Jüdische Stimme für einen gerechten Frieden" als Social-Media-Post veröffentlicht. Die linksradiale Organisation steht der Israel-Boykott-Bewegung "BDS" nahe. Auf dem Foto ist ein Ausschnitt des brennenden Flüchtlingslagers im "Al-Aksa-Märtyrer-Krankenhaus" in Gaza zu sehen, darüber die Aufschrift "This is Zionism" ("das ist Zionismus"). Özoguz hatte das Bild ohne kritische Einordnung in einem eigenen "Istagram-Real" als ihre Meinung veröffentlicht. -
Hamburgs Finanzsenator Dressel will Islamisten- und Partei-Freundin Özoguz wieder für den Bundestag nominieren.
 |
Die Islamisten-Freundin Özoğuz soll für die Hamburger SPD wieder in den Bundestag.
(Foto: Olaf Kosinsky, LizenZ. CC0) |
Hamburg, 22.10.2024: Der "Zionismus-Skandal" um die SPD-Bundestagsabgeordnete und Noch-Vizepräsidentin des Bundestages - Aydan Özoğuz - schlägt mit voller Wucht in der Hamburger Heimat der juden- und israelfeindlichen Deutsch-Türkin ein. Der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde an Alster und Elbe kauft der immer wieder islamistisch agitierenden SPD-Funktionärin die übereifrige Hochglanz-Entschuldigung vom Freitag vergangener Woche nicht ab.
Einer erneuten Aufstellung als Kandidatin für den Wahlkreis Wandsbek unter dem SPD-Kreisvorsitzenden Andreas Dressel sieht Gemeinde-Vorsitzender Philipp Stricharz äußerst kritisch. Davor müsse die SPD-Politikerin sich „von staatlichen und sonstigen Unterstützern der Hamas und der Hisbollah im In- und Ausland absolut eindeutig und nachhaltig distanzieren.“ Genau das untergräbt Özoğuz regelmäßig mit antisemitischen und islamistenfreundlichen Äußerungen.
Während offizielle Vertreter - wie Israels Botschafter Ron Prosor - klare Worte verlangen, warum die 57-jährige am Mittwoch-Abend vergangener Woche einen Antizionismus-Post der israelfeindlichen Organisation "Jewish Voice of Peace" unreflektiert als "Instagram"-Kurzvideo (Reel) veröffentlichte und damit als Spitzenpolitikerin das Existenzrecht Israels in Zweifel zog und zieht, springt ihr der für Skandale bekannte Hamburger Finanzsenator und SPD-Parteifreund Andreas Dressel zur Seite.
Der Vorsitzende des einflussreichen SPD-Kreisverbandes Wandsbek will die erneute Kandidatur Özoğuz' als Spitzenkandidatin der 15-Prozent-SPD bei den Bundestagswahlen im kommenden Jahr durchwinken. „Ja, der Post war ein Fehler. Aydan Özoğuz hat sich aber glaubhaft entschuldigt. Die SPD Wandsbek hält an ihr fest“, wiederholte Dressel die aktuelle PR der Sozialdemokraten aus Berlin. Am 16.11. d. J. soll sie als Spitzenkandidatin für Wandsbek, Anfang kommenden Jahres zur Spitzenkandidatin der gesamten Hamburger SPD gekrönt werden.
Damit will die Hamburger Partei mit Unterstützung von Dressel eine offensichtliche Antisemitin erneut zur Spitzenkandidatin machen, den israelfeindlichen "Instragram"-Skandal in bester Scholz-Manier aussitzen - und weitermachen, wie bisher. Unterdessen knöpft sich das feministische Frauenmagazin "Emma" die Antisemitin vor: "Aydan Özoğuz ist pro Kinderehe und pro Burka. Da ist nur logisch, dass die Islamistenfreundin auch ein heikles Verhältnis zu Israel hat", so die Redaktion auf dem Netzwerk "X". "Nun bekommt Aydan Özoğuz Ärger wegen der Gleichsetzung von Zionismus mit Verbrechen gegen Palästinenser. Eine Islamisten-Freundin war sie schon - ausgerechnet - als Staatsministerin für Integration", pointiert "Emma" weiter.
Die FDP-Rechtsexpertin Linda Teuteberg betonte gegenüber der "BILD"-Zeitung: „Die Verteufelung des Zionismus ist ein Brandbeschleuniger des Antisemitismus und mit dem Amt einer Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages nicht vereinbar.“ Der FDP-Bundestagsabgeordnete Frank Müller-Rosentritt bringt die Trickserei von Özoğuz nach dem "Zionismus-Skandal" auf den Punkt: „Eine inhaltliche Distanzierung von dem antizionistischen Beitrag fehlt.“ Özoğuz hat sich bis heute nur für das Teilen des Posts versucht zu entschuldigen, nicht für den Inhalt und die damit verbundene Botschaft, das Recht auf einen eigenen Staat sei vergleichbar mit Kriegshandlungen.
-
Hamburger SPD-Islam-Propagandistin Özoguz weigert sich als Bundestagsvize den Stuhl zu räumen.
Berlin, 21.10.2024, Update 1.1: Die rot-grün-ideologische Ampelregierung unter Olaf Scholz sieht keinen Grund, dass die Hamburger SPD-Juden- und Israelfeindin Aydan Özoguz ihren mit rd. 16.840,- € Gehalt im Monat plus rd. 5.000,- € monatlicher Pauschalen dotiereten Vizepräsidentenjob des Bundestages sofort räumen muss. Um die eindringliche Forderung von Israelischer Botschaft, Zentralrat der Juden, Deutsch-Israelischer Gesellschaft, der Jüdischen Allgemeinen sowie Politikern von AfD, CDU und CSU übers Wochenende zu retten, sprang ihr am Freitag der links-ideologische SPD-Fraktionsvorsitzende Rolf Mützenich zur Seite und behauptete, dass es keine Notwendigkeit zum Rücktritt gebe.
Zuvor hatte das SPD-Parteipräsidiumsmitglied Özoguz einen Hochglanz-PR-Post abgesetzt, in dem sie sich für verletzten Gefühle friedliebender Menschen scheinbar entschuldigen wollte. Sie sagte: „Es war ein Fehler, diese Instagram-Story zu teilen. Ich bitte um Verzeihung“. Dabei nahm sie den eigentlichen Post mit der israelfeindlichen und von Hamas-Terroristen und ihren Anhängern verbreiteten Lüge ausdrücklich nicht zurück. Damit blieb sie bei ihrer menschenverachtenden, islamistischen Grundüberzeugung. "NIUS"-Korrespondent Ben Brechtken kommentierte die unglaubwürdige Entschuldigung auf "X": "Diese "Entschuldigung" ist eine Schande. Diese Frau ist eine Schande. Diese Partei ist eine Schande."
In einer Sondersitzung des Ältestenrats des Bundestages hatte die Union direkt zuvor den sofortigen Rauswurf der kalkuliert islamistischen Terror verbreitenden Deutsch-Türkin und führeren Staatsministerin im Bundeskanzleramt für Intergration aus dem Wahlkreis Hamburg-Wandsbek aus dem linkslastigen Bundestagspräsidium gefordert. Von Bundestagspräsidentin und SPD-Parteifreundlin Bärbel Baas gab es in bester Parteidisziplin lediglich einen Rüffel.
 |
So sieht von SPDlern verbreitete Terror-Propaganda im Namen der Hamas aus.
Post: Aydan Özuguz, Netzwerk "X" |
Das von der erkennbaren Antisemitin Özoguz geteilte Bild wurde ursprünglich von der antiisraelischen Gruppe "Jüdische Stimme für einen gerechten Frieden" als Social-Media-Post veröffentlicht. Die linksradiale Organisation steht der Israel-Boykott-Bewegung "BDS" nahe. Auf dem Foto ist ein Ausschnitt des brennenden Flüchtlingslagers im "Al-Aksa-Märtyrer-Krankenhaus" in Gaza zu sehen, darüber die Aufschrift "This is Zionism" ("das ist Zionismus"). Özoguz hatte das Bild ohne kritische Einordnung in einem eigenen "Istagram-Real" als ihre Meinung veröffentlicht.
 |
Özuguz im Kreis von SPD-Antisimiten und Hamas-Supporter UNWRA-Chef Lazzarini.
Quelle: Peter Schmid/Netzwerk "X" |
Der antisemitische, menschenverachtende Post der Hamburgerin Özoguz ist nicht etwa ein versehentlicher "Ausrutscher" oder bedauerlicher "Einzelfall". Zuvor posierte sie mit dem außenpolitischen Sprecher der 15-Prozent-SPD im Bundestag - Nils Schmid - und dem Beauftragten der Bundesregierung für Religions- und Weltanschauungsfreiheit - dem SPD-Abgeordneten Frank Schwabe - direkt neben dem Chef der die islamistische Terrororganisation Hamas unterstützenden UN-Hilfsorganisation "UNWRA" - Philippe Lazzarini.
Dabei posierte sie in einem Post, der die Debatte um ein Verbot von "UNWRA" in der israelischen Knesset kritisierte und durch Schmid die Forderung nach einem Palästinenser-Staat unterstrich. Schon während des iranischen Raketenangriffs im April d. J. mit mehr als 600 Rakten des Mullah-Regimes warf sie Israel vor, den Angriff provoziert zu haben. AfD und CDU/CSU forderten schon damals ihren Rauschschmiss aus dem Bundestagspräsidium.
Der frühere Sprecher der Israelischen Armee (IDF), der israelisch-persische Politologe und Autor aus Göttingen - Arye (ARO) Sharuz Shalicar - kommentierte auf "X" die Versuche der islam-verherrlichenden Hamburger SPD-Abgeordneten: "Jetzt wird sich entscheiden, ob diejenigen, die üble antisemitische Propaganda verbreiten, einen festen Platz in der deutschen Gesellschaft und Politik haben, oder nicht. Als in Deutschland ingeborener & aufgewachsener Jude hoffe ich sehr, dass Deutschland wirklich aus der Geschichte gelernt hat."
-
Links-grüne Ampel-Ideologen beweisen "Der größte Lump im ganzen Land ist und bleibt der Denunziant".
 |
Unter dem Vorwand des Digital Service Acts baut Müller einen Schnüffelstaat auf.
Grafik: Account Klaus Müller/Netzwerk "X" |
Berlin, 17.10.2024: Die neue deutsche "Stasi"-Schnüffelbehörde BNetzA unter dem links-grünen Beamten Klaus Müller hat in einem Leitfaden zur Zulassung des von linken Ideologen geführten "Trusted Flaggers" - der zweifelhaften Privatorganisation "REspect" - genau festgelegt, wie die Organisation unliebsame Bundesbürger ausspionieren und im Internet verfolgen soll. Das dem Nachrichtenportal "Nius" vorliegende Papier beweist, dass die regierenden Ideologen Menschen „überwachen“ und Inhalte „aufspüren“ sollen.
Wörtlich heißt es in der von Wirtschaftsminister Habeck verantworteten Anweisung der Bundesnetzagentur: „Beschreiben Sie, wie Sie die zu überwachenden Inhalte und Plattformen auswählen“. Außerdem Schreiben die "Stasi"-Schnüffler aus Bonn: „Geben Sie gegebenenfalls die Bereiche illegaler Inhalte und die Arten von Online-Plattformen an, die Sie überwacht haben“. Zudem geht es in der Anweisung zur Ausschreibung um Schulungen, „um Ihr Verständnis für die technischen Werkzeuge und die Überwachung der Plattform zu verbessern“.
Entgegen der politischen Behauptung, dass "Trusted Flagger" lediglich strafrechtlich relevante Inhalte gemeldet bekommen sollen, die dann an die Social-Media-Plattformen zu Löschung weitergegeben werden, wie die Müller-"Stasi"-Behörde aktiv geheimdienstlich arbeitete Handlanger unter Vertrag nehmen. So müssen die Organisationen im Bewerbungsprozess nachweisen, über welche „Erfahrungen mit dem Aufspüren, Identifizieren und Melden illegaler Online-Inhalte“ sie verfügen. Da heißt es: „Machen Sie ausführliche Angaben zu den Methoden, mit denen illegale Inhalte aufgespürt, identifiziert (und bewertet) und gemeldet werden.“
Der bekannte Strafrechtler und Medienanwalt Joachim Steinhöfel bringt auf den Punkt: „Trusted Flagger (sprich: staatsnahe Denunzianten) sollen nach dem Leitfaden der Bundesnetzagentur ‚aufspüren‘ und ‚überwachen‘. Der Leitfaden ist eine moderne Zersetzungsfibel. Auf den Hinweis des ZEIT-Journalisten Jochen Bittner an Netzagentur-Chef Klaus Müller (Grüne) auf X, seine Äußerungen seien ‚offenkundig verfassungswidrig‘, erwiderte Müller, er ‚nehme das als Ansporn, noch klarer zu werden‘. Braucht es das wirklich?"
Steinhöfel pointiert, dass die Ampel Arm in Arm mit Brüssel die Verfassung verletze, die Gewaltenteilung verhöhne, digitale Schlägertrupps mit extremistischem Background mit Steuergeldern versehe und die Bürger zum Anschwärzen aufrufe. Im Anhang der Bewerbungsanweisungen der "Stasi"-Behörde BNetzA findet sich unter dem Punkt "Unerlaubte Rede" u. a. der Begriff der "Hassrede", die es im Gesetz nicht gibt. Dabei will Müller mit seinen linken Flaggern alles an politisch nicht genehmer "Hassrede" verbannen, "unabhängig von Medium und Inhalt" - also auch im Altag und vor Ort, was der "Digital Service Act" der EU nicht abdeckt, wie der Name sagt.
Ein weiterer verfassungsrechtlich angreifbarer Bereich sind "Negative Auswirkungen auf den zivilen Diskurs oder Wahlen". Hier stellt die Bonner "Stasi"-Truppe "Informationsmanipulation mit dem Ziel, die Integrität/den Ausgang von Wahlen zu beeinflussen" unter Verfolgung. Müller und seine Beamten erklären nicht, ob es sich dabei vor allem um bürgerliche und konservative Informationen in der Verfolgung handeln werde, die dem Machterhalt links-ideologischer Regierungen dienen.
Verfassungsrechtler Josef Franz Lindner von der Universität Augsburg stellt zu dem politisch auslegbaren Gummi-Paragrafen fest: „Trusted Flaggers sollen auch solche Meinungen melden, die eine ‚negative Wirkung auf den zivilen Diskurs‘ haben, heißt es in einem Leitfaden von Klaus Müller. Darunter kann man jede missliebige Äußerung fassen. Das ist krass rechtswidrig und der Einstieg in ein staatliches Zensursystem.“
Die Obfrau der AfD-Fraktion im Digitalausschuss des Bundestages, Barbara Benkstein, warnt: „Die Bundesregierung bedroht mit ihrer Kontroll- und Verbotspolitik zunehmend die Freiheit im Netz. Strukturen und Definitionen bleiben diffus, wenn linke Aktivisten festlegen, was ‚Hassreden‘ sein sollen. Die Berufung eines ersten sogenannten ‚Trusted Flagger‘ weckt dunkle Erinnerungen. Gesteuert vom grünen Chef der Bundesnetzagentur Müller und finanziert von der grün-ideologischen Ampel-Ministerin Paus soll der ‚Flagger‘ entscheiden, was wahr ist und was zensiert werden darf."
Ein ausführlicher Beitrag zum Thema "Stasi"-Methoden der link-grün-ideologischen Ampel-Regierung ist bei den Kollegen des Nachrichtenportals "Nius" nachzulesen. (Grafik: Account Klaus Müller, Netzwerk X) Redaktioneller Hinweis des Chefredakteurs als Autor:
Ich werde jederzeit gegen totalitäre Machenschaften in Deutschland aufstehen und lautstark demonstrieren, seien sie heute "Rot" oder "Grün" - im politischen Berlin oder in Bonn, getarnt als "Trusted Flagger" oder "Streitbeilegungsstelle" fernab des Strafgesetzbuches.
Das bin ich als DDR-Stasi-Opfer jedem einzelnen der 340 kaltblütig hingerichteten Mauertoten des totalitären SED-Stasi-Regimes schuldig. Ich verbitte mir von einem Kinderbuchautor gemaßregelt zu werden, was ich in einem freien Land sagen darf und was der rot-grün-linken Ideologie-Regierung nicht genehm ist.
-
Händler-Lobby will mit TÜV-Behörde und links-grüner Schnüffelbehörde BNetzA chinesische Online-Marktplätze an die Kette legen.
 |
20 % der Marktplatz-Umsätze in Deutschland gingen in Q3.24 an chinesische Plattformen, so der BEVH.
Foto: Markus Winkler, Unsplash) |
Hamburg, 16.10.2024: Eine Jeans für 13,- €, eine Smartwatch für 9,- € oder ein Blutdruckmessgerät für nicht mal 7,- €: Chinesische Online-Marktplätze wie "AliExpress, Shein und Temu", aber auch chinesische Onlinehändler auf amerikanischen Marktplätzen von "Amazon" oder "Ebay" locken Kunden mit extrem niedrigen Preisen und hohen Rabatten. Allein in den drei Monaten Juli bis September '24 kauften deutsche Verbraucher laut E-Commerce-Branchenverband "BEVH" für rd. 2,1 Mrd. € auf chinesischen Plattformen ein - bei insgesamt 9,2 Mrd. € gehandelten Waren über Online-Marktplätze inkl. "Amazon", "Ebay", "Kaufland", "Otto.de" & Co. - und dies ohne Online- oder Multichannel-Händler und Direktversender.
Die chinesischen Marktplatz-Plattformen - aber auch chinesische Online-Händler auf amerikanischen Marktplätzen - stehen in Deutschland und Europa zunehmend unter Druck der etablierten Handelslobby überkommener Kaufmannsfamilien, wie "Otto" und "Rossmann". Aufgrund ihrer extrem günstigen Endkunden-Preise ohne Zwischenhändler und deutsche Online-Anbieter verkaufen die Chinesen zahlreiche Artikel auf den chinesischen Marktplätzen für gerade einmal 10 % des auf "Otto.de" und in anderen deutschen Onlineshops geforderten Preises.
Lobbyvertreter in Deutschland und Europa wollen den chinesischen Anbietern das Geschäft im Liebsten sofort untersagen oder unmöglich machen, um den Markt wieder für überteuerte Chinaware in Online- und Vor Ort-Shops, wie "Otto", "Rossmann" oder "Wenko" abzuschotten. Dazu schicken sie auch vermeintlich unabhängige Testorganisationen wie den "TÜV" und Verbraucherschützer ins Feld, um den Ruf der chinesischen Anbieter nach Möglichkeit zu ruinieren und ihr angestammtes Oligopol-Geschäft in Deutschland zu sichern.
Der "TÜV-Verband" kritisiert, dass die Chinesen reihenweise unsichere oder sogar gefährliche Produkte nach Deutschland importieren. So würden scharfkantige Spielzeuge, vermeintlich ungenaue Gesundheitstracker, falsche oder gar keine CE-Kennzeichnungen sowie Produkte ohne vorgeschriebene Kontaktinfos für Regressforderungen verbreitet werden. Die Lobbyorganisation "TÜV" beruft sich wiederum auf die links-grün-ideologische Bundesnetzagentur und deren vermeintliche Kompetenz in Sachen Verbrauchsgütern.
Die "BNetzA" hat nach eigenen Angaben im Jahr 2023 rund 5.000 Warensendungen aus Drittstaaten (ohne nähere Länderangaben) kontrolliert und festgestellt, dass 92 % dieser Waren mehr oder weniger nicht den EU-Vorschriften entsprachen - unabhängig von Gefährlichkeit oder Lappalie. Die Lobbyvertretung "Handelsverband HDE" meldete erfreut, dass etwa 60 % der gelieferten Produkte wegen Verstößen gegen das Chemikalienrecht nicht verkehrsfähig seien.
Wie bei der Verfolgung unerwünschter Meinungen fernab links-grün-ideologischer Positionen verlangt der "TÜV"-Verband in einem aktuellen Positionspapier eine konsequente Anwendung des europäischen „Digital Services Act“ (DSA) als Totschlag-Methode. Unsichere Produkte müssten schnell von den Plattformen entfernt werden, Ansprechpartner in der EU erreichbar sein und manipulative Werbung unterbunden werden.
Zudem sollte die 45-Millionen-Nutzergrenze für große Marktplätze nach unten manipuliert werden, damit mehr Online-Händler strengere Vorgaben erfüllen müssten. „Im Online-Handel haben wir weniger ein Regulierungs- als ein Kontroll- und Durchsetzungsdefizit“, sagt Verbandschef Joachim Bühler. „Notwendig sind EU-weit ausreichende Ressourcen für den Zoll und die Marktüberwachung“, so der "TÜV"-Vertreter politisch realitätsfern der aktuellen Belastung von Zollbehörden inkl. des Zollpostamtes in Frankfurt/Main.
„Es muss sichergestellt werden, dass für Verbraucher und Behörden ein rechtlich verantwortlicher Ansprechpartner in der EU zur Verfügung steht, der für die Produktkonformität einsteht und im Schadensfall auch in Regress genommen werden kann“, so Bühler (gegenderte Schreibweise von "Verbauchern" entfernt, die Red.). Eine Überprüfung und dauerhafte Kontrolle dieser Ansprechpartner durch unabhängige Dritte sollte die Erreichbarkeit sicherstellen. Damit will sich die Kontrollbehörde "TÜV" offenbar selbst ein neues Geschäft eröffnen.
 |
Der chinesische Bekleidungs-Versender SHEIN macht About You, Zalando & Co. zu schaffen.
Foto: HANSEVALLEY |
Die EU-Kommission geht davon aus, dass im Jahr 2023 zwei Milliarden Pakete mit einem Warenwert von weniger als 150,- € – also unterhalb der Zollgrenze – an EU-Bürger (Genderschreibweise von "Bürgern" entfernt, die Red.) versandt wurden. Häufig seien sie falsch deklariert, um den Zoll zu umgehen, so eine weitere Schutzbehauptung, ohne diese stichhaltig beweisen zu können oder zu wollen. „Inwieweit die im Rahmen der laufenden Zollreform angekündigte Abschaffung der Zollbefreiung bis 150,- € Warenwert erfolgreich ist, bleibt abzuwarten“, so Lobbyist Bühler zu der von deutschen Händlern gern wiederholten Forderung gegenüber der Politik in Berlin und Brüssel.
Die sich zunehmend als europäische Vollstreckungsbehörde initiierende EU-Kommission verlangt von dem chinesischen Marktplatz-Anbieter "Temu" aktuell bis 21. Oktober d. J. Informationen zuzuliefern, wie der chinesische E-Commerce-Konzern "PinDuoDuo" den bereits 2015 gegründeten Online-Shop "Temu" vor dem Verkauf gefälschter Waren schützen will. Dabei beruft sich die Von-der-Leyen-Administration auf den von ihr verabschiedeten "Digital Service Act", der große Plattformen zunehmend regulieren und damit an die Kette legen soll. Im schlimmsten Fall kann die EU gegen die milliardenschweren Plattformen lediglich Bußgelder verhängen, das eigentliche Geschäft aber nicht verhindern.
Deutsche, europäische und internationale Kunden kaufen bei "AliExpress", "Shein" und "Temu" direkt in China ein - nicht innerhalb der Europäischen Union. Die Waren werden zumeist über internationale Tochtergesellschaften in Singapur und Luxemburg abgerechnet und dann direkt aus chinesischen Warenlagern per Luftfracht in alle Welt verschickt, über den Frachtflughafen Lüttich in die EU gebracht und z. B. in den Niederlanden verzollt. Das Märchen von einem Verstopfen des internationalen Luftfracht-Verkehrs flog auf, nachdem ein "Lufthansa"-Manager entgegnete, dass die chinesischen Sendungen eher für eine höhere Auslastung der Frachtkapazitäten sorgten, was ausdrücklich gewünscht wird.
Fragt man deutsche Verbraucher, was sie z. B. am chinesischen Marktplatz "Temu" besonders schätzen, gibt es klare Ansagen: Mit 82,8 % sehr guter und guter Bewertungen liegt die Produktvielfalt in Kategorien, wie Elektronik, Haus & Garten, Schmuck & Accessoires sowie Schönheit & Gesundheit unangefochten an der Spitze der Beliebtheitsskala, direkt gefolgt von 72,0 % positiver Beurteilung des Preis-Leistungs-Verhältnisses. Auf Platz 3 folgt mit 69,7 % positiver Beurteilungen die Bedienfreundlichkeit der App wie der Website von "Temu", fand das Hamburger Marktforschungsinstitut "Appinio" heraus.
Laut Stichprobe des Hanse Digital Magazins HANSEVALLEY verkaufen chinesische wie europäische und deutsche Marktplatz-Händler identische Billig-Artikel z. B. aus dem Sortiment Haushaltswaren auf "Amazon", "Ebay" und "Otto.de". Dieselben Artikel sind auf den chinesischen Plattformen "AliExpress" und "Temu" zu teilweise erheblich niedrigeren Preisen zu haben - inklusive Verzollung in der EU und Lieferung nach Hause mit "DHL" oder "Hermes" innerhalb von 10-14 Tagen.
-
Grüner Netzagentur-Chef heuert grüne und linke Ideologen für die "Streitbeilegung" im Internet an.
 |
Zentrale grüner "Stasi"-Fantasien für das Internet: die grün geführte Bundesnetzagentur.
(Foto: Eckard Henkel, Wikimedia, Lizenz: CC BY-SA 3.0 DE) |
Berlin, 11.10.2024: Nach einer links-grünen "Stasi"-Agentur mit einem umstrittenen ägyptischen Islam-Gelehrten an der Spitze und der aktuellen Intervention des Digitalministeriums zur offensichtlichen Islamisten- und Hamasnähe basteln die links-grün-ideologischen Parteifunktionäre mit Unterstützung der 15 %-SPD an der nächsten perfiden Stufe ihres grünen Überwachungssystems:
Auf den von Baden-Württemberg, Bayern und dem grünen Jugendministerium der Ideologin Paus mit Millionenbeträgen subventionierten "Trusted Flagger" namens "REspect" folgt eine "außergerichtliche Streitbeilegungsstelle", um die unerwünschten, jedoch nicht strafrechtlich angreifbaren Beiträge aus den sozialen Medien zu verbannen und eine politisch rot-grün-ideologische Einheitsmeinung zu erzwingen.
Die vom grünen Chef der politisch gesteuerten Bundesnetzagentur - Klaus Müller - in seiner Funktion als "Digital Service Coordinator" einberufene Schlichtungsstelle ist eine weitere, von grünen und roten Klimaaktivisten und Ideologen besetzte Stelle, um die Meinungsfreiheit in Richtung einer linken "Einheitsfront" einzuschränken. An der Spitze von "User Rights" stehen zwei nachweisbar linke Funktionäre, die künftig den Social-Media-Plattformen sagen sollen, was diese zu löschen haben.
Im Mittelpunkt der unabhängigen Recherchen von "NIUS" stehen die zwei Gründer der privaten Agentur "User Rights", Prof. Stephan Breidenbach und Raphael Kneer. Der Jurist Breidenbach ist strammer Funktionär des Klima-Vereins „GermanZero“, der sich für Klimaneutralität bis 2035 um jeden Preis einsetzt. Er leitet das „Legal und Policy Team“ und erarbeitete zusammen mit Wissenschaftlern und Juristen ein Gesetzespaket, das die Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels sichern sollte. Damit ist Breidenbach politisch nicht neutral.
Der SPDler Raphael Kneer betreibt eine Kanzlei für Arbeitsrecht, die auf Betriebsratsgründungen spezialisiert ist. 2022 trat Kneer bei der linken "Taz" unter dem Titel "Klima Klasse Krieg“ auf. Dabei wurde über einen Streik der Mitarbeiter des mittlerweile verkauften und eingstampften Kurierdienstes "Gorillas" diskutiert, verbunden mit der Frage, ob die - politisch ideologisch gendertes Zitat - „Arbeiter:innen die ausbeuterischen Verhältnisse akzeptiert“ hätten. Kneer ist politisch nicht neutral. "User Rights" windet sich auf Anfrage von "NIUS", ob sie politisch linke Ideologien vertreten und verweisen ausgerechnet auf die links-grün geführte, politisch beeinflusste Bundesnetzagentur als Genehmigungsbehörde: „Die Unabhängigkeit und Unparteilichkeit der Gesellschaft und ihrer Gesellschafter wurde im Zertifizierungsprozess von der Bundesnetzagentur nach Art. 21 Abs. 3 DSA umfassend geprüft."
"User Rights" versteckt sich hinter den europäischen Richtlinien, wie die Vertreter von Grünen und SPD generell, um ihre "Stasi"-Methoden durch die Hintertür einführen zu können: "Die Vorschriften sind zentraler Bestandteil der europäischen Gesetzgebung, um ideologische oder politische Einflussnahme im Rahmen der Streitschlichtung zu verbieten. Die Juristen, die die Streitschlichtung (sogenannte Streitschlichter) durchführen, müssen ebenfalls unabhängig und unparteiisch sein und dies regelmäßig schriftlich versichern und nachweisen.“
Bundesnetzagentur-Chef Klaus Müller brachte bereits im August d. J. auf den Punkt, in welche Richtung die Rolle von "User Rights" gehen könnte: „Die außergerichtliche Streitbeilegung ist eine einfache und schnelle Möglichkeit für Nutzer, sich gegen Entscheidungen von Online-Plattformen zu wehren. Dies gilt, wenn illegale Inhalte nicht gelöscht, Accounts gesperrt oder eben nicht gesperrt werden.“
In zwei der drei Szenarien, die Müller beschreibt, wird laut "NIUS" die außergerichtliche Streitbeilegungsstelle angerufen, weil die Plattform zu wenig gelöscht hat: weil „illegale Inhalte nicht gelöscht“ oder Accounts „nicht gesperrt“ wurden. Wer trotz eifrigen Meldens von unerwünschten Beiträgen keinen Erfolg erzielt, bekommt mit der links-grün geführten Streitbeilegungsstelle eine weitere Möglichkeit, politisch und ideologisch motivierte Löschungen durchzudrücken.
-
Ampel holt strammen Islam-Gelehrten als Chef der ersten grünen "Stasi"-Schnüffelagentur an Board.
 |
Hochmuth kommt vor dem Fall: Das gilt auch für Islamisten auf Insta-Posts.
Collage: NIUS |
Berlin, 10.10.2024: Der Versuch, unter dem Vorwand des europaweiten "Digital Service Act" eine staatlich finanzierte Schnüffelagentur nach "Stasi"-Vorbild gegen links-grün-ideologisch unliebsame Äußerungen auf Social-Media-Plattform zu errichten, fällt der desolaten und zerstrittenen Ampel-Regierung noch vor dem Arbeitsbeginn der neuen "Stasi"-Behörde auf die Füße.
Im Mittelpunkt steht eine links-grüne Seilschaft um den Partei-Strippenzieher und Möchtegern-Kanzler Robert Habeck, seinen Chef der Bundesnetzagentur und grünen Parteifunktionär Klaus Müller sowie den islamischen Chef der steuerfinanzierten "Stasi"-Meldestelle "REspect".
Auf seinem Instragram-Profilfoto zeigte sich der Leiter der künftigen und vom grün-ideologischen Familienministerium und den Landesregierungen von Baden-Württemberg und Bayern mit Steuermillionen subventionierten privaten Schnüffelagentur "REpect" - der strenge ägyptische Islamgelehrte Ahmed Haykal Gaafar - repräsentativ und freudestrahlend mit dem Unterstützer der islamistischen Terror-Organisation "Hamas", dem muslimischen Großimam Ahmed Al-Tayyib. Der wie Gaafar ebenfalls ägyptische Islam-Gelehrte hatte am 4. April 2002 Selbstmordattentate gegen Israel ausdrücklich gerechtfertigt und die Führer der arabischen Welt dazu aufgefordert, die Palästinenser in ihrem Kampf zu unterstützen,
so "Wikipedia" (Zitat: „
Die Lösung für den israelischen Terror liegt in einer Ausweitung von Fidai-(Selbstmord-)attacken, die Horror in die Herzen der Feinde Allahs schlagen. Die islamischen Länder, Völker, Führer usw. müssen diese Märtyrerattacken unterstützen.“
Die islamistischen Hintergründe des "REspect" -Chefs bringen nun auch Digitalminister Volker Wissing in Rage: „Eine Sympathie für die Hamas oder andere extremistische Grundeinstellungen sind nicht mit der Ausübung einer Tätigkeit als Trusted Flagger vereinbar,“ erklärte das Digitalministerium gegenüber dem Berliner Nachrichtenportal. Das FDP-geführte Ministerium verlangt Aufklärung gegenüber der grün-links-ideologisch geführten Bundesnetzagentur. Die Presseabteilung erklärte zugleich gegenüber dem unabhängigen Medienhaus "NIUS": "Wir kennen den Hintergrund des Fotos nicht".
Die Meldestelle „REspect“ wurde als erster "Trusted Flagger" (vertrauenswürdiger Hinweisgeber) von der Bundesregierung, genauer gesagt von der Bundesnetzagentur, benannt. Dieser kann damit an Social-Media-Plattformen als "Desinformationen", "Hassrede" sowie vermeintlich "Hass und Hetze" gemeldete Beiträge weitergeben, was zur Löschung führen kann.
Namhafte Juristen warnen vor einem links-grün-ideologischen Zensursystem vergleichbar der DDR-Staatssicherheit. Dies ist für Meinungs- und Pressefreiheit höchst problematisch. Der Professor für öffentliches Recht an der Uni Oldenburg - Prof. Volker Boehme-Neßler - machte auf "X" klar:
"Im Staat des Grundgesetzes ist alles erlaubt, was nicht ausdrücklich verboten ist. Was verboten ist, bestimmen die Gesetze und die Justiz. Private Institutionen, die vom Staat mit der Verfolgung von Hass und Hetze beauftragt werden, verstoßen deshalb gegen das Grundgesetz."
Stephan Brandner, stellvertretender Bundessprecher der AFD, wertet die Einrichtung der links-grünen "Stasi"-Schnüffelagentur als weiteren massiven Angriff auf die Meinungsfreiheit:
„Die Bundesnetzagentur nutzt die europäischen Digitale-Dienste-Vorschriften als Feigenblatt, um ihre grundgesetzwidrige Politik weiter auszuweiten. Statt sich auf gesetzwidrige Inhalte zu konzentrieren, weitet die Bundesnetzagentur den Anwendungsbereich beliebig auf die nicht näher bestimmten Begriffe von ‚Hass‘ und ‚Fake News‘ aus. Wir alle wissen, dass sie darunter alles fasst, was ihr nicht in den Kram passt und sich gegen die linke Regierung wendet. Dies ist ein massiver grundrechtswidriger Angriff auf die Meinungsfreiheit!“
Die links-grün-geführte Bundesnetzagentur - BNetzA - liegt in der Verantwortung des links-grün-geführten Wirtschaftsministeriums. Für den europaweiten "Digital Service Act" zur Kontrolle der Digitalplattformen ist in der Ampel allerdings das Digitalministerium von Volker Wissing verantwortlich, darunter fällt auch die Aufsicht über BNetzA-Chef Klaus Müller als neuer „Digital Service Coordinator“ nach EU-Vorgabe.
-
"Absolut arroganter" Otto-Versand rechnet sich gegenüber E-Commerce-Experten die Händlerzahlen schön.
 |
"Otto" will die Diskrepanz bei den abgehanden gekommenen Händeln nicht klären.
(Grafik: Neuhandeln/Versandhausberater/HighText-Verlag, Screenshot: HANSEVALLEY) |
Hamburg, 30.09.2024: Der Hamburger Drittanbieter-Plattform von "Otto.de" - "Otto Market" - sind aufgrund von Händlerflucht und Ad-hoc-Kündigungen offenbar mind. 866 Marktplatz-Händler verloren gegangen, was der von Kennern als "absolut arrogant" agierende Distanzhändler auch nach Beweisen seitens des E-Commerce-Fachportals "Neuhandeln" nicht zugeben will. Die PR von "Otto.de" behauptet in ihrer aktuellen Pressemeldung vom 26.09.24 zur 75-jährigen Existenz des Distanzhändlers, aktuell "rd. 6.500" Handelspartner zu haben - 200 mehr als im Vorjahr.
"Neuhandeln" und E-Commerce-Experte Joachim Graf haben dies "Otto.de" mit Auswertung zuverlässig arbeitender Crawler sicher widerlegt. Die digitale Auswertung der seit Frühjahr durch Verdoppelung von Gebühren und unbegründeten Kündigungen verunsicherten und flüchtenden Händlerschaft liegt danach nur noch bei 5.635 - und damit aktuell 866 Händler unter den Konzernangaben und sogar fast 1.000 Händler unter der Zahl zu Jahresbeginn.
Ursprünglich hatte der E-Commerce-Experte Mark Steier (Fachblog "Wortfilter") durch auslesen der Händleradressen per Crawler am 19.09.24 festgestellt, dass "Otto Market" sogar 1.178 Händler abhandengekommen sind. "Es fehlen 1.178 Seller" stellte Steier öffentlich fest - u. z. aufgrund von online ausgelesen Händler-IDs, die es in der linearen "Otto"-Händlernummerierung nicht mehr gibt. Das bestätigt eine Crawler-Liste von "Otto", die "Neuhandeln" überprüft hat. Ergebnis der Auswertung: 1.178 Händler, die als gelöscht markiert sind - exakt die Zahl von E-Commerce-Fachmann Steier.
Wie HANSEVALLEY berichtete, gingen "Otto Market" seit Jahresbeginn rd. 1.500 Händler vor allem durch Flucht vor steigenden Gebühren von der Fahne - in Richtung "Amazon", "Ebay", "Kaufland" & Co. Zugleich sollen laut "Otto"-Eigenangaben in derselben Zeit rd. 1.300 Händler neu dazu gekommen sein und aktiv als Händler online präsent sein. Damit müsste eine weitgehend stabile Anzahl an Dritthändlern auf dem Marktplatz haben, wie von "Otto" behauptet.
"Otto" verweigert gegenüber "Neuhandeln" offensichtlich eine ehrliche Erklärung. Am 24.09.24 argumentiert die PR-Abteilung: "Tatsächlich fehlen bei Ihnen rund 800 verkaufsfähige Partner, die meisten davon wurden in 2024 ongeboarded. Darüber hinaus finden sich veraltete Daten. Sie können also weiterhin beruhigt unseren Zahlen vertrauen."
"Neuhandeln" verlangt daraufhin eine Aufstellung der mehr als 800 "fehlenden Händler". Daraufhin schaltet die PR von "Otto" in den - bereits anderweitig kritisierten - "Arroganz-Modus": "Bitte haben Sie Verständnis: nein, weitere Details kommunizieren wir hierzu extern nicht. Sie werden verstehen: Wir haben wenig Interesse daran Personen, die unseren Händlerdaten auslesen, um damit ihre Dienstleistungen anzubieten, tiefergreifende Hinweise auf unsere Interna zu geben. ..." "Otto" behauptet, die aktuellen Crawler-Daten seien "alt".
Versandhandels-Experte und Verleger Joachim Graf bittet "Otto" daraufhin, ein einziges Beispiel für einen "verloren gegangenen" Marktplatz-Händler zu nennen, um die Diskrepanz zwischen "Otto"-Eigenreklame und aktuellen Crawler-Ergebnissen auflösen zu können - vergeblich. Erneut wimmelt "Otto" mit Glaubensbekundungen ab: "Das schafft die zuständige Abteilung leider nicht, aber Sie können beruhigt unsere Zahlen übernehmen - die stimmen garantiert."
Auf nochmalige Nachfrage zur Nennung eines einzigen Händlers, den "Neuhandeln" womöglich versehentlich nicht gecrawlt hatte und den es aber wirklich gibt, wimmelt die - ursprünglich vom in der Dauerkritik stehenden "Hermes-Versand" kommende - "Otto.de"-PR-Leitung endgültig ab: "... Ihre DIY-Messung wird immer fehlerhaft sein, das hatte ich Ihnen ja bereits erläutert, Sie haben ja die richtigen Zahlen von mir."
Joachim Graf stellt auf "Neuhandeln" fest: "Ich habe natürlich meine evangelische Schulausbildung absolviert. Aber Glauben gehört meines Wissens nach in die Kirche und nicht in die Medien und schon gar nicht in den E-Commerce." Das Fachportal hatte über eine Woche im offenen Dialog mit der "Otto.de"-PR-Abteilung versucht zu klären, wie 866 ersichtlich nicht mehr existierende Marktplatz-Händler nach Konzerndenke doch noch existieren und über die technisch als überaltert geltende Website "Otto.de" verkaufen.
Die gesamte Entwicklung der Recherche mit allen Stellungnahmen der "Otto.de"-PR-Abteilung in Hamburg-Bramfeld in chronologischer Reihenfolge gibt es bei den Kollegen von "Neuhandeln". Alle aktuellen Berichte zum Verlust von Marktplatz-Händlern bei "Otto Market", zu Verdoppelung von Gebühren und unbegründeten Rauswürfen von Marktplatz-Händlern, zur Anmaßung im Rahmen der "Pride Parade" in Hamburg im Namen der Gay-Community (aka "Queer") einen "
Kampf gegen Rechts" betreiben zu dürfen sowie den Machenschaften der "Otto-Konzern"-Inkasso-Tochter "EOS", erkennbar unberechtigte "Telekom"-Schulden eintreiben zu wollen, sind im
Hanse Recherche Magazin HANSEINVESTIGATION nachzulesen.
Weitergehende Hintergründe zu Entwicklung des einst stolzen Schuh- und Versandhändlers der Familie Otto zum "
absolut arroganten" Online-Händler sind in der Investigativ-Geschichte "
Assets stand Anstand: Der tiefe Fall des Otto-Versands" mi bis heute mit mehr als 2.200 Lesern zu finden.
-
Gierige DPA-Manager kassierten bis heute mehr als 2 Mio. € Subventionen der Bundesregierung.
 |
Die DPA-Bosse bekommen nicht genug von den süssen Regierungs-Subventionen.
(Foto: Michael Kappler, Grafik: Medium Magazin, Screenshot: HANSEVALLEY) |
Hamburg, 27.09.2024: Die millionenschwere Subvention der "Deutschen Presse-Agentur" durch verschiedene Ministerien der links-grünen Bundesregierung und ihrem Vorgänger wird zum Top-Thema in der Medienbranche. Das Branchenblatt "Medium Magazin" berichtet in seiner aktuellen Titelgeschichte „Wie viel Geld vom Staat darf es sein?“ im Details, wofür die offensichtlich gierigen "DPA"-Manager die Hand aufhielten und aufhalten - und wie sie reagieren, nachdem Bundestags-Vizepräsident Wolfgang Kubicki aus Schleswig-Holstein die dreiste "DPA"-Führung nach dem Aufdecken durch die "Bild"-Zeitung öffentlich an den Pranger stellte (HANSEVALLEY berichtete im Juli d. J.).
Wie jetzt durch das "Medium Magazin" an die Tagesoberfläche kommt, hat die "DPA" für Projekte von 2021 bis heute mehr als 2 Mio. € von Berliner Regierungsstellen kassiert - und das als eigentlich neutral zu agierdende Genossenschaft der deutschen Verlage und Medienhäuser:
- Vom noch rot-schwarzen Kulturbeauftragten im Kanzleramt gab's 750.000,- € für die Einführung personalisierter Inhalte bei regionalen Zeitungsverlagen, schöngefärbt unter dem Titel "Drive Me" (09.2021 - 12.2022).
- Für die "Stärkung der Demokratie" kassierten die nicht wirklich überparteilichen Hamburger Medien-Verkäufer zur Evaluierung eines "Democracy Newsrooms" 321.000,- € (11.2022 - 08.2023)
- Aktuell profitieren die Genossenschafts-Bosse für ein Medien-Schulungsprogramm namens "Wegweiser KI" im aktuellen Hypethema AI weitere 240.536,- € (04.2024 - 03.2025)
- Im "Jahr der Nachricht" kassieren die "DPA"-Vertriebler satte 1 Mio. € ohne Ausschreibung vom Innenministerium - um junge Leute für Journalismus zu begeistern und die "Resilienz gegen Desinformationen" in sozialen Medien zu stärken. (11.2023 - 12.2024)
Damit steht die als Genossenschaft von gut 170 Verlagshäusern und Rundfunksendern in der Kritik, nicht mehr unabhängig berichten zu können oder zu wollen. Nötig hat die "DPA" die staatlichen Fördergelder nicht: Der Konzernumsatz der Gruppe stieg trotz eines schwierigen Umfeldes auf 165,9 Mio. €. Mit 104,3 Mio. € gelang auch der Kerngesellschaft "DPA GmbH" mit dem eigentlichen Nachrichtengeschaft ein Umsatzwachstum.
Die wegen antisemitischer Ausfälle bei Veranstaltungen in der Kritik geratene Medienbeauftragte der Bundesregierung, Claudia Roth, ließ mitteilen, dass die "DPA" lediglich Projektträger sei und die Unabhängigkeit der Presse gewahrt bleibe. Eine Prüfung nach Artikel 107 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union stelle sicher, dass der Wettbewerb nicht verfälscht werde.
Geschäftsführer Peter Kropsch orakelt ein "negatives Framing" gegen die "DPA", vor allem aus der "konservativen und rechten Ecke". Womit die regierungstreue Position des "DPA"-Verantwortlichen gesichert erkannt ist. Gegenüber dem "Medium Magazin" beteuert er: "Bei den Projekten, für die wir Geld von Ministerien erhalten haben, gibt es zu unserer Redaktion eine Firewall." Dies ist durch seine eigene linke Position damit sicher widerlegt.
Chefredakteur Sven Gössmann erwidert gegenüber dem Branchenmagazin, in Bezug auf die Kundinnen Claudia Roth und Nancy Faeser nicht in Verdacht zu stehen, "dass wir sie jeden Tag an unsere Brust drücken". Der Inhaltechef legte reflexartig die bekannte Branchenargumentation auf den Tisch, dass nur die Nachricht im Mittelpunkt stehe.
Die "DPA" ist als größte deutsche Nachrichtenagentur praktisch ein Monopolist. Sie gilt vor allem in der politischen Berichterstattung auf Bundes- und Länderebene als tonangebend. Die Redaktionen der rd. 170 Gesellschafter beziehen über Nachrichtenticker, Landes- und Themendienste, Audiobeiträge sowie einen Fotodienst einen Großteil des Rohmaterials für ihre laufende Berichterstattung.
Die Agentur stellt ihren Kunden auch fertige und anpassbare Online-Ticker bereit, ohne dass Zeitungen oder Online-Medien selbst recherchieren oder auswählen müssen. Die Nachrichtenagentur wurde vor 75 Jahren gegründet, hat ihren Firmensitz in Hamburg und arbeitet mit einem zentralen Newsroom in der Axel-Springer-Passage in Berlin.
Die ganze Geschichte kann in der
aktuellen Ausgabe des "Medium Magazin" nachgelesen werden (Paypwall).
-
"Absolut arroganter" Otto-Versand verliert 1.500 Marktplatz-Händler innerhalb des laufenden Jahres.
 |
Otto auf dem Weg zur Plattform - wenn sie nicht vorher alle vergraulen.
Foto: HANSEVALLEY |
Hamburg, 24.09.2024: Der in wirtschaftlichen Schwierigkeiten steckende Handelskonzern "Otto" hat seit Jahresbeginn rund 1.500 Handelspartner von seinem Marktplatz verloren. Nach eigenen Angaben sollen sich fast ebenso viele Händler auf der Plattform neu angemeldet haben. Mit Stichtag 22. September '24 sind nach "Otto"-eigenen Angaben 6.464 Marktplatz-Händler angemeldet, berichtet das firmenfreundliche "Hamburger Abendblatt".
Das "Handelsblatt" meldet dagegen, dass durch erhöhte Gebühren und gezielten Rausschmiss insgesamt 1.000 Händler weniger auf der Plattform sind, als noch zum Jahresanfang. Bestätigt ist, dass sich nach Gebührenanhebungen im April d. J. rd. 500 Händler in Richtung "Amazon" und "Ebay" verabschiedet haben. Das "Handelsblatt" spricht von "massenhaften Abwanderungen".
Laut Analyse des Marktplatz-Experten Mark Steier hat "Otto" seit Jahresbeginn genau 1.178 Händleraccounts verloren, so die Wirtschaftszeitung. 1.000 Händler wurden danach von "Otto" selbst rausgeschmissen. „Unsere Kündigungen beruhen auf wiederholtem Fehlverhalten von Händlern“, erwiderte ein Sprecher aus Bramfeld.
"Ein fairer Umgang mit Partnern sieht anders aus", erwidert E-Commerce-Community-Manager Steier. Danach haben Händler im Schnitt allein rd. 10.000,- € für das Onboarding bei "Otto" hingelegt, um überhaupt etwas verkaufen zu können. Bei einer Reihe von Händlern kommt noch ein Betrag von bis zu 50.000,- € dazu, um die "Otto"-Software an die eigene Warenwirtschaft anzubinden. "Und nun werden sie ohne erkennbaren Grund gekündigt", bringt Steier auf den Punkt.
"Wir können uns bis heute nicht erklären, was wir falsch gemacht haben könnten", wundert sich ein gefeuerter Händler. Er machte 2 Mio. € Umsatz im Jahr über die Handelsplattform. "Die Kündigungen auf dem Marktplatz von Otto haben epische Ausmaße angenommen, da kann von Einzelfällen keine Rede mehr sein", kritisiert Lars Maritzen, Rechtsanwalt und unabhängiger Mediator für die "Otto-Plattform" gegenüber dem "Handelsblatt".
"Otto nennt in vielen Kündigungen noch nicht mal Gründe und zieht sich auf die Vertragsfreiheit zurück." Dabei gebe es zahlreiche Händler, die vom Verkauf über "Otto.de" abhängig seien. "Otto missbraucht hier seine relative Marktmacht", kritisiert Anwalt Maritzen. Die Händler sind danach auf Gedeih und Verderb von "Otto" abhängig. Ein Vorwurf, den "Otto" gern immer wieder "Amazon" vorwirft, um sich selbst in ein besseres Licht zu rücken.
Das wahre Gesicht zeigt "Otto" nur hinter den Kulissen. Nachdem der konservative, aber links-grün agierende Familienkonzern die Rücknahme von Kündigungen mehrerer Händler kategorisch abgelehnte, musste Rechtsanwalt Maritzen Klage gegen den bereits in der Vergangenheit immer wieder ausfällig agierenden Handelsriesen einreichen.
In bester "Otto"-Tradition dementierte die Pressestelle unterm Strich die medialen Berichte von massenweisen Abwanderungen und Kündigungen: „Wir haben heute mehr Händler auf dem Marktplatz als vor einem Jahr“, so ein angestellter Firmensprecher. Zudem hätten sich die Marktplatz-Umsätze im Vergleich zum Vorjahr um 20 Prozent erhöht.
"Die Konkurrenz von Amazon und neuen Wettbewerbern wie Temu und Shein tut Otto richtig weh", bringt E-Commerce-Experte Steier das Chaos in Hamburg-Bramfeld auf den Punkt. "Nun wollen sie auf Kosten der Marktplatzhändler ihre eigenen Umsätze retten", so der Experte im Handelsblatt. "Es liegt nahe, dass Otto sein eigenes Handelsgeschäft durch die Kündigung von Handelspartnern stärken will", bestätigt auch Anwalt Maritzen.
Obendrein kritisieren Händler wiederholt die misslungene Öffnung des Portals "Otto.de" zum Marktplatz. "Die technische Kompetenz entspricht in etwa dem Gründungsjahr der Firma", spottet ein leitender Manager eines technischen Dienstleisters über den 75 Jahre alten Distanzhändler aus dem Katalogzeitalter. Die Kommunikation sei zudem "absolut arrogant" und entspreche in keiner Form einer Partnerschaft, so der Dienstleister zum "Holtzbrinck"-Wirtschaftsmedium.
"Otto" hatte im Geschäftsjahr 2023/2024 mit Umsätzen aus eigenem Handel, Provisionen seiner Marktplatz-Händler und Gebühren für Services weltweit insgesamt 4,2 Mrd. € umgesetzt - und damit noch einmal 8 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verloren. Die Handelssparte von "Otto" gilt mittlerweile als Krisenfall im Konzern, sodass Unternehmensberater neue Konzepte für "Otto" entwickeln sollten.
Der Handels-, Logistik- und Finanzkonzern "Otto" ist im abgelaufenen Geschäftsjahr 2023/2024 noch weiter in die roten Zahlen gerutscht. So stieg der Fehlbetrag trotz 2.500 entlassener und abgebauter Mitarbeiter von -413 Mio. € auf -426 Mio. €. Hauptgrund für die noch schlechteren Jahreszahlen ist vor allem der massiv eingebrochene Gesamtumsatz des Konzerns von 16,19 Mrd. € in 22/23 auf nur noch 14,96 Mrd. € in 23/24 - und damit um eine weitere Mrd. € weniger.
Zum Vergleich: Der in Bramfeld verhasste Konkurrent "Amazon" schaffte mit seiner deutschen Niederlassung im vergangenen Geschäftsjahr einen GMV inkl. der Provisionen seiner Marktplatzpartner in Deutschland von 51,98 Mrd. €. Dabei macht das eigene Geschäft ohne Partner in 2023 insgesamt 37,6 Mrd. € aus.
Damit ist "Amazon" in Deutschland inkl. Marktplatz-Händler insgesamt rd. 8-mal umsatzstärker, als der Hamburger "Otto-Versand". Beim direkten Vergleich der Eigenumsätze ohne Partner liegt das Verhältnis der Erzrivalen mittlerweile bei 1:9.
-
EDEKA-Konzernlenker versuchen sich nach missratener Anti-AfD-Hetze herauszuwinden.
 |
Hier wurde die Anti-AfD-Hetzanzeige entwickelt und veröffentlicht.
(Foto: Ajepbah, CC BY-SA 3.0) |
Hamburg, 25.09.2024: Der Vorstandsvorsitzende des "EDEKA"-Handelskonzerns - Markus Mosa - und der Aufsichtsratsvorsitzende des Genossenschaftsverbundes mit 3.400 selbständigen Einzelhändlern - Uwe Kohler - haben in der "Lebensmittel-Zeitung" Abbitte für die missratene Anti-AfD-Anzeige vor den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen geleistet. Zugleich bekräftigt der größte Lebensmittler die Kernaussagen aus der von den regionalen Genossenschaften, ostdeutschen Kaufleuten und Kunden massiv kritisierten Hetz-Kampagne "Warum bei Edeka Blau nicht zur Wahl steht".
Aufsichtsratschef Uwe Kohler, mit 16 "EDEKA"-Standorten in der Region Süd-West einer der großen regionalen Kaufleute, sagte der "Lebensmittel-Zeitung": "Wir haben einen festen Wertekanon, stehen zu unseren Mitarbeitern mit Migrationshintergrund, zu allen Kunden, zu unseren Lieferanten aus dem In- und Ausland. Wir stehen für die freiheitliche, demokratische Grundordnung ein. Aber wir wollen auch niemanden in seinem Denken und Handeln bevormunden."
Genau für diese Bevormundung, bestimmte Parteien - konkret die AfD - gefälligst nicht zu wählen - wurde die im Alleingang handelnde Konzern-Zentrale in Hamburg von Kunden in die Kritik gestellt. In einem Social-Media-Post heißt es in "EDEKA"-Look-and-Feel mit Unterschrift "Deine Kundschaft" an die Hamburger Zentrale:
"Deine Marketing-Abteilung hat es Dir vielleicht anders vermittelt, aber als Kunde erwarte ich von Dir nicht, dass Du mir
- ärztliche Hinweise gibst, wie ich gesünder leben kann
- wirtschaftliche Ratschläge erteilst, wie ich besser haushalte
- soziale Tipps gibst, wie ich mich in der Gesellschaft zu verhalten habe, oder
- politische Belehrungen erteilst, was und wen ich wählen soll."
Die "Lebensmittel-Zeitung" bestätigte, dass der Alleingang von Vorstandschef Markus Mosa, seinem Vorstand und Politik-Chef Rolf Lange bei den sieben regionalen Genossenschaften hart aufgeschlagen ist und es seitens der Großhandelsbetriebe und ihrer Kaufleute massive Kritik für die Überrumpelung hagelte. Hauptkritikpunkt: Die Hamburger Zentrale agierte ohne jegliche Abstimmung bzw. Vorankündigung.
"EDEKA"-Boss Markus Mosa versuchte sich nun, herauszureden: "Die Zentrale hat das entschieden und umgesetzt. Weil wir der Überzeugung sind, dass wir als Marktführer Haltung zeigen müssen. Ziel war es, zu einer gesellschaftlichen Diskussion anzuregen. Es tut uns leid, wenn das bei vielen Menschen anders angekommen ist. Wir werden das intern aufarbeiten und daraus lernen."
Mit der Bekräftigung einer politischen "Haltung" bestätigt der "EDEKA-Konzern" seine Nähe zu den linken Regierungsparteien in Berlin zugunsten von Millionensubventionen unter dem Vorwand von Klimaschutz und Energieeinsparungen. Diese "Haltung" hatte der Handelsriese bereits in der Corona-Pandemie unter Beweis gestellt, als er unverhohlen in ganzseitigen Anzeigen für die Impfkampagne der Bundesregierung warb.
Mit der Kritik an seiner Anti-AfD-Hetzanzeige wurde der "EDEKA"-Konzern von kritischen Beobachtern mit seiner eigenen NS-Vergangenheit konfrontiert. So schalteten die Kaufleute die gesamte Organisation noch vor der Machtergreifung von 1933 auf Nazi-Kurs gleich, wählten NSDAP-Funktionäre an ihre Spitze, verkauften in den Filialen "Arierpässe" und warben in der offiziellen Mitgliederzeitung mit Anzeigen für die Wahl von Adolf Hitler.
"Während der Zeit des Nationalsozialismus gab es im Edeka-Verbund bedauerlicherweise nicht nur Gegner der Nazi-Gesinnung, sondern auch Mitläufer und aktive Unterstützer. Dies ist eine historische Tatsache, die wir bedauern. Wir leiten daraus aber auch die moralische Verpflichtung ab, einen aktiven Beitrag dafür zu leisten, dass sich Geschichte nicht wiederholt“, spielte Unternehmenssprecherin Miriam Heimberg die Gleichschaltung der Genossenschaft gegen jüdische Kaufleute herunter, zitiert "Focus".
-
Auch Tagesthemen-Moderator Zamperoni mit unrühmlichem Ausfall bei Anti-AfD-Hetzshow "Die 100".
 |
"Die 100" - mit drei Moderatoren: zwei davon ausfällig oder einseitig.
(Foto: Alexander Herzig, NDR) |
Hamburg, 23.09.2024: Die Anti-Afd-Hetzshow "Die 100" des NDR für die ARD hat nicht nur mind. sieben Politiker der linken Parteien SPD, Grüne, Linkspartei und Die Partei sowie mind. vier Laien-Schauspieler als unabhängige Bürger verkauft, Tagesthemen- und Show-Moderator Ingo Zamperoni ist bei der Aufnahme der Sendung offenbar schroff abweisend mit Kritikern der jetzigen Regierungspolitik umgesprungen.
Unter dem Titel "Ist die AfD eigentlich ein Problem für die Demokratie?“ ging Zamperomi den 20-jährigen Teilnehmer Niklas Kuhlmann an. Der Teilnehmer mit der Nr. 80 sagte laut "NIUS" in der Sendung: „Ich finde, dass die AfD durchaus lächerliche Positionen vertritt, das macht den Diskurs aber nicht kaputt, denn der ist ohnehin lächerlich. Der Diskurs findet in einem sehr engen Rahmen statt. Es wird einem alle vier Jahre Wahlfreiheit vorgegaukelt. Aber nach dem Abgeben der Stimme hat man keinen Einfluss mehr darauf, was Politiker machen. Sobald jemand im Amt ist, muss man ihn vier Jahre aushalten.“
Den jungen Teilnehmer mit der klaren Position entgegnete Zamperoni politisch wertend: „Sie haben offensichtlich ein grundlegendes Problem mit der Demokratie“. Der Moderator wandte sich ohne eine Möglichkeit der Reaktion zu seinem Statement einfach ab. Laut "NIUS" war der junge Teilnehmer verstört über die Methode der Journalisten in der alten Lokhalle in Göttingen. Die Szene wurde in der ausgestrahlten Sendung herausgeschnitten, laut NDR aus Zeitgründen.
Zuvor war bereits der linke Klimaaktivist und Co-Moderator Tobias Krell in die Kritik geraten: In der Sendung hetzte er mit linker Propaganda, die AfD stelle alle Muslime unter einen Generalverdacht und wolle "vielleicht Millionen Menschen entfernen". Damit wiederholte der vom NDR bezahlte Moderator unreflektiert die - gerichtlich festgestellt - erfundene Behauptung des regierungsfinanzierten Berliner Polit-Kollektivs "Correctiv".
Der linke WDR-Moderator Georg Restle ("WDR Monitor") spielte die offensichtlichen Manipulationsvorwürfe von NDR, WDR und Produktionsfirma als "zufällige Fehler der ARD" herunter. Zugleich holte er die Keule vorsätzlich platzierter "Verschwörungsmythen" gegen den parteipolitisch einseitigen und angeschlagenen öffentlich-rechtlichen Rundfunk heraus. Die Tatsache reihenweise beteiligter Linkspolitiker vergaß Restle im Rahmen der Verpflichtung zur Objektivität zu erwähnen.
Das ARD-Format "Die 100" ist für den Deutschen Fernsehpreis 2024 in der Kategorie "Bestes Infotainment"-Format nominiert. Begründung der Juroren: Der Moderator Ingo Zamperoni treffe stets den richtigen Ton und sorge dafür, „dass die Atmosphäre stets fair und sachlich bleibt. Darüber hinaus punktet das Format durch gute journalistische Vorbereitung“. Offenbar haben die Verantwortlichen des Fernsehpreises von ARD, ZDF, RTL und P7S1 den herausgeschnittenen Angriff gegen einen kritischen Teilnehmer und die erneut wiederholten Lügen über vermeintliche Deportationen nicht gesehen.
-
Kölner Staatsanswaltschaft beschlagnahmt Handy von Ex-SPD-Strippenzieher Kahrs - Bürgermeister Tschentscher im Visir.
 |
Tschentscher hat offenbar einen besonders fürsorglichen Blick für die Warburg-Bank.
Foto: SPD Hamburg |
Hamburg, 20.09.2024: Laut Medienberichten hat die Staatsanwaltschaft Köln das Handy des Hamburger Ex-SPD-Strippenziehers Johannes Kahrs beschlagnahmen lassen. Kahrs diente beim Steuerraub der Hamburger "Warburg-Bank" als Mittler zwischen der Privatbank und dem damaligen SPD-Bürgermeister Olaf Scholz sowie seinem Finanzsenator Peter Tschentscher.
Norbert Hackbusch, Abgeordneter der Linkspartei in der Hamburgischen Bürgerschaft, erklärte: „Auch nach dem Weggang der Staatsanwältin Frau Brorhilker bleibt die Staatsanwaltschaft in Köln hartnäckig bei ihren Ermittlungen rund um die kriminellen Cum-Ex-Aktivitäten der Warburg-Bank. Und das ist gut so, denn ganz entgegen den Beteuerungen der Ausschussmehrheit von SPD und Grünen sind jede Menge Fragen weiter offen."
Das Mitglied des Cum Ex-Untersuchungsausschusses weiter: "Nun wurde Herrn Kahrs nach einer aufwendigen Observation von der Polizei das Handy abgenommen – im NDR-Hamburg Journal sagte der "Stern"-Enthüllungsjournalist Oliver Schröm am Mittwoch, dass es bei dieser Aktion vor allem auch um Kahrs‘ Kommunikation mit Peter Tschentscher geht.
Die Linksfraktion im Parlament habe schon im Zwischenbericht des Untersuchungsausschusses darauf hingewiesen, dass gerade die Rolle von Peter Tschentscher in diesem Betrugsfall noch zu bewerten sein wird. Denn der war damals nicht nur als Senator für die Finanzbehörde verantwortlich, sondern wehrte sich später auch noch besonders vehement gegen die Aufklärung der Affäre.
Hackbusch zusammenfassend: "Nun warten wir ab, was die Ermittler*innen auf dem Handy finden – und hoffen, so auch endlich Antworten auf unsere Fragen zu den Aktivitäten von Olaf Scholz und Peter Tschentscher in dieser Affäre zu bekommen.“ Das "Hamburger Tagesjournal" verzichtete in seiner Donnerstags-Ausgabe darauf hinzuweisen, dass die Staatsanwaltschaft das Handy des SPD-Funktionärs Kahrs beschlagnahmte.
Das Interview mit Oliver Schröhm kann auf den Seiten des NDR angesehen werden. (Foto: SPD Hamburg) -
NDR-Produktion "Die 100" manipuliert mit getarnten Parteifunktionären und Laien-Schauspielern.
 |
Online-Faktenchecker haben die Gästeliste durchforstet.
(Grafik: Kolja Barghoorn, X) |
Hamburg, 20.09.2024: Der Norddeutsche Rundfunk hat wie der WDR mit der von ihnen produzierten und am Montag d. W. (16.09.24) aus einer alten Lokhalle in Göttingen gesendeten Anti-AfD-Polit-Show "Die 100" die Zuschauer der ARD ersichtlich vorsätzlich manipuliert. Das geht aus aktuellen Recherchen u. a. von Online-Faktencheckern sowie Journalisten u. a. von "Berliner Zeitung" und "NIUS" hervor. Danach sind mind. sieben Politiker vor allem von SPD, Grünen, Linkspartei und Die Partei als vermeintlich unabhängige Bürger und AfD-Kritiker vor der Kamera eingesetzt worden.
Im Rahmen der Manipulation - produziert von der Düsseldorfer Firma "Ansager und Schnipselmann“ - wurde u. a. der für ARD und ZDF tätige Laien-Schauspieler Michael Schuhmacher aus Kaiserslautern den Zuschauern als harmloser Bürokaufmann verkauft, der während der Sendung vermeintlich seine Meinung in eine kritische AfD-Position wechselte und prompt dazu befragt wurde. Aus seiner Vermittlungsagentur kamen sogar zwei Schauspieler, insgesamt mind. vier Komparsen in der gescriptet daherkommenden ARD-Skandalsendung zu Wort.
Co-Moderator Tobias Krell wurde in Online-Recherchen als aktiver, linker Klimaaktivist enttarnt. In der Sendung hetzte er mit linker Propaganda, die AfD stelle alle Muslime unter einen Generalverdacht und wolle "vielleicht Millionen Menschen entfernen". Damit wiederholte der vom NDR bezahlte Moderator unreflektiert die - gerichtlich festgestellt - gelogene Behauptung des regierungsfinanzierten Berliner Kollektivs "Correctiv".
Die Agitatoren hatten nach einem privaten Treffen konservativer und rechts der Mitte beheimateter Politiker im November '23 im Potsdamer "Landhaus Adlon" über vermeintlich geplante "Deportationen" von Ausländern berichtet und rot-grüne Massendemonstrationen zugunsten der linken Ampel-Regierung ausgelöst.
Die offenbar geplante Manipulation des von GEZ-Gebühren aus Hamburg, SH, MV, Niedersachsen und NRW bezahlten Anti-AfD-Hetz-Formats überzeugte allerdings nicht alle gecasteten Teilnehmer in der Lokhalle. "Es fragt kein Mensch, was wir Einheimischen für Angst haben“, so eine 84-jährige ehemalige Bürokauffrau aus Limburg, die nach eigenen Worten aus Protest gegen die aktuelle Politik von Scholz, Baerbock, Faeser & Co. die AfD wählte.
Der FDP-Abgeordnete Gerald Ulrich fordert jetzt in der Konsequenz: "Die Verantwortlichen müssen im eigenen Interesse Transparenz schaffen, wie es zur Auswahl kam. Wenn es Zweifel an der Zusammenstellung der Teilnehmer gibt, erreicht die Sendung genau das Gegenteil von der eigentlichen Absicht. Sie stärkt nämlich die AfD."
Der verantwortliche NDR spielt auch eine Woche nach dem Manipulations-Skandal weitgehend "toter Käfer". Der Sender erklärte gegenüber Kollegen-Medien, dass sich jeder als Teilnehmer des Formats bewerben konnte und die 100 Protagonisten rein zufällig ausgewählt worden seien. Die für den Deutschen Fernsehpreis als "Bestes Infotainment"-Format nominierte und als linke Hetze enttarnte Show soll im Oktober d. J. mit einer weiteren Folge fortgesetzt werden.
Eine Zusammenfassung zu den Manipulationen ist in der "Berliner Zeitung" erschienen. -
Gebrauchte Handys verdienen ein zweites Leben. Warnung vor unseriösem Recommerce-Anbieter Back Market.
 |
Alte Handy-Geräte sind oft zu gut, um entsorgt zu werden.
(Foto: Gabriel Freytez, Pexels) |
Hannover, 19.09.2024: Unter dem Motto "Altes Handy? Zeit für ein Comeback!“ rufen die Verbraucherzentralen in Deutschland dazu auf, Smartphones länger zu nutzen und abgelegte Handys weiterzuverkaufen, zu spenden oder fachgerecht zu entsorgen. Die Informationskampagne ist Teil der "Deutschen Aktionstage Nachhaltigkeit“ und läuft bis zum 8. Oktober 2024.
Mehr als 50 % der Deutschen besitzen ein Smartphone, das höchstens 12 Monate alt ist. Werden alte Handys durch neue ersetzt, legen laut einer Umfrage der Verbraucherzentralen 40 % der Verbraucher diese in eine Schublade, weil sie noch einmal gebraucht werden könnten. Hochrechnungen zufolge lagern rund 210 Millionen ausrangierte Mobiltelefone in deutschen Haushalten.
Die abgelegten Alltagshelfer besitzen ein wertvolles Innenleben: Viele der verbauten Materialien, davon gut 50 Metalle, werden unter Einsatz von umwelt- und gesundheitsschädlichen Chemikalien gewonnen. Hinzu kommen die energieintensive Produktion und der oft weite Transport der Geräte aus chinesischen Fabriken nach Europa und Deutschland.
Steht tatsächlich eine Neuanschaffung an, sollten noch funktionsfähige Altgeräte möglichst weiterverwendet werden und nicht ungenutzt zu Hause herumliegen. Sie lassen sich beispielsweise auf Secondhand-Plattformen oder direkt über Kleinanzeigenportale online verkaufen, auch eine Weitergabe an die Handy-Sammlungen gemeinnütziger Organisationen ist möglich.
HANSEVALLEY empfiehlt, die durchschnittlichen Verkaufspreise für gebrauchte Handys über in Kürze endende "Ebay"-Aktionen zu ermitteln. Bei hochwertigen Geräten z. B. von "Apple" kann der Verkauf über einen Anbieter wie "Rebuy" interessant sein, wenn das Gerät gepflegt ist. Dabei ist zu beachten, dass Ankäufer tagesaktuelle, unterschiedliche Ankaufspreise bieten und mit Aktionsgutscheinen noch zusätzlich der eine oder andere Euro eingenommen werden kann.
HANSEVALLEY warnt aus äußerst negativen Erfahrungen vor dem derzeit aggressiv in Deutschland werbenden Recommerce-Anbieter "Back Market" aus Frankreich. Dieser spielt bei Problemen mit gekauften Geräten gern "toter Käfer", schiebt die Verantwortung auf Verkäufer der Plattform ab und versucht, Kunden zu übervorteilen. Im konkreten Fall musste ein Redakteur den französischen Gesellschafter des Wiederaufbereiters einschalten, um den Fall zu klären. Die HANSEVALLEY-Warnung: Hände weg von "Back Market".
Sind weder Verkauf noch Spende der geeignete Weg, sind Mobiltelefone fachgerecht als Elektroschrott zu entsorgen. Für die Abgabe zum Recycling kommen nicht nur Wertstoffhöfe und der Fachhandel infrage, auch Supermärkte, Discounter und Drogeriemärkte um die Ecke können Anlaufstellen sein, wenn diese mehrmals im Jahr Elektro- und Elektronikgeräte anbieten.
Im Rahmen der "Deutschen Aktionstage Nachhaltigkeit“ zeigen die Verbraucherzentralen Wege für einen nachhaltigen Konsum in Sachen Smartphone auf:. Hier gibt es Online-Vorträge der Verbraucherzentrale in Hannover:
„Doch nicht nur Verbraucherinnen und Verbraucher, auch Unternehmen müssen ihrer Verantwortung gerecht werden. Sie sollten nachhaltigen Konsum fördern, anstatt mit gezielten Anreizen den Kauf neuer Smartphones immer weiter zu forcieren“, fordert die Hannoveraner Verbraucherberaterin Kathrin Bartsch.
Die ständige Einführung verbesserter Funktionen wie längere Akkulaufzeiten, schnellere Prozessoren oder neue Displaytechnologien machen den Umstieg auf ein neues Gerät für viele Menschen attraktiv. Tauschprogramme, bei denen für alte Handys Prämien gezahlt werden, um aktuelle Modelle zu vermarkten, schaffen einen zusätzlichen Konsumdruck.
Auslaufende Softwareupdates führen dazu, dass selbst funktionsfähige Handys aus Sicherheitsgründen früher abgestoßen werden als eigentlich nötig. Erst ab 2025 müssen Hersteller Verbraucherinnen und Verbrauchern beim Kauf eines neuen Smartphones mindestens fünf Jahre funktionale Updates und Sicherheitsaktualisierungen garantieren.
-
Intel-Chipfabrik ist nicht gecancelt - die 10 Milliarden gehen jetzt nur in Habecks grüne Fantasieprojekte.
 |
Das Intel-Luftschloß der Bundesregierung ist in heiße Luft aufgegangen.
(Grafik: Intel Corp.) |
Santa Clara/Berlin, 18.09.2024: Der US-Chiphersteller "Intel" hat am Montag nach Börsenschluss mitgeteilt, die mit rd. 10 Mrd. € Subventionen geplanten Chipfabriken in Magdeburg in den kommenden zwei Jahren nicht zu bauen. Von den 30 Mrd. € Baukosten wollte die linke Ampel-Regierung in Berlin 10 Mrd. € übernehmen.
Ab ca. 2027 sollte die Produktion von Halbleitern an dem ostdeutschen Standort starten, bis zu 3.000 Arbeitsplätze in der strukturschwachen Region entstehen. Die Berliner Politik missbrauchte das nun gescheiterte Leuchtturm-Projekt immer wieder als Beispiel für eine vermeintlich erfolgreiche rot-grüne Wirtschaftspolitik.
Das renommierte Münchener Ifo-Institut bewertete die Milliarden-Subventionierung für den Standort Magdeburg von Anfang an als "fragwürdig". Medien spekulieren jetzt, ob die horrenden Strompreise in Deutschland aufgrund der Energiepolitik des Habeck-Ministeriums auch ein Grund dafür sind, dass der in wirtschaftliche Schieflage geratene Technologie-Konzern das Magdeburger Projekt fallen lässt.
Unterdessen betreiben die politisch Verantwortlichen in Magdeburg ein "Pfeifen im Walde": „Intel hält, wenn auch mit einer zeitlichen Verzögerung, weiter an dem Projekt fest. Das ist für uns alle eine wichtige Nachricht“, so Sachsen-Anhalts CDU-Wirtschaftsminister Sven Schulze „Intel, die Bundesregierung als auch wir als Landesregierung stehen weiter zu dem Projekt."
Die Linkspartei im Bundestag findet klare Worte zur missratenen Ansiedlung: "Die Ampel lässt sich von einem US-Konzern vorführen. Trotz zahlreicher Warnungen hat die Bundesregierung den US-Amerikanern fast 10 Milliarden versprochen, obwohl klar war, dass Intel seit Jahren Milliardenverluste einfährt. Mit dem Rückzug Intels stürzt das Kartenhaus der Bundesregierung zusammen."
Die AfD geht noch weiter: "Fördergelder sind keine nachhaltige Strategie, um Deutschland als Produktionsstandort wieder attraktiv zu machen. Stattdessen müssen endlich die Rahmenbedingungen verbessert werden. Aus Sicht der AfD-Bundestagsfraktion heißt das: günstige Energiepreise, niedrigere Steuern und Abgaben, Investitionen in die Infrastruktur sowie in exzellente Bildung und Forschung."
Die frei werdenden Milliarden sollten im Osten bleiben und in eine neue Industriestiftung fließen, die dafür sorgt, dass wirtschaftlich sinnvolle Projekte unterstützt werden, etwa in Forschung und Entwicklung von Solarenergie, Windkraft und Batterien, so die Linke. In dieser Stiftung dürften nicht nur Wirtschaftsführer entscheiden, sondern auch Arbeitnehmervertreter und Wissenschaftler.
Nun ist ein heftiger Streit um die Verwendung der geplanten 10 Mrd. € entbrannt. "Alle nicht für Intel benötigten Mittel müssen zur Reduzierung offener Finanzfragen im Bundeshaushalt reserviert werden", schrieb FDP-Finanzminister Christian Lindner nach der Ankündigung des Konzerns auf "X". "Alles andere wäre keine verantwortungsbewusste Politik", so der FDP-Vorsitzende.
Der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck erhob seinerseits den Anspruch, die Gelder in den bereits einmal für verfassungswidrig erklärten "Klima- und Transformationsfonds" zu stecken: „Wir werden jetzt gemeinsam beraten, wie wir mit nicht genutzten Mitteln sinnvoll und sorgsam umgehen und sie zum Wohle des Landes einsetzen.“
Der Digitalverband Bitkom warnte Finanz- und Wirtschaftsministerium vor einem Verschwinden der Milliarden-Beiträge in Haushaltspositionen. Hauptgeschäftsführer Bernd Rohleder: „Deutschland muss zum Zentrum der europäischen Chip-Industrie werden und sich auch weltweit in der Spitzengruppe positionieren. Dieses Ziel dürfen wir trotz der aktuellen Entscheidung Intels zum Bau einer Chipfabrik in Magdeburg nicht aus den Augen verlieren."
Aufgrund des entfachten Streits um die bereitgestellten 10 Mrd. € Subventionen könnte "Intel" den Bau mit Begründung unsicherer Unterstützung der Bundesregierung ganz absagen. Anfang August d. J. hatte der u. a. bei KI-Chips massiv hinterher hinkende US-Konzern den Abbau von weltweit rd. 15.000 Mitarbeitern bzw. 15 % der Beschäftigten angekündigt.
Neben der Streichung der Magdeburger Chip-Produktion hat Intel auch den Bau einer Chipfabrik im polnischen Breslau ausgesetzt.
-
EDEKA schaltete Anti-AfD-Hetzanzeigen für Millionensubventionen des Habeck-Ministeriums.
 |
Die AfD zerlegte die missratene EDEKA-Hetzkampagne.
Quelle: X |
Hamburg, 16.09.2024: Die Anti-AfD-Hetzkampagne der "EDEKA"-Zentrale direkt vor den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen ist nach Berichten der konservativen Wochenzeitung "Junge Freiheit" aufgrund knallharter wirtschaftlicher Interessen geschaltet worden. Grund: Die Konzernzentrale und eine Reihe ihrer insgesamt sieben Genossenschaften haben allein in den vergangenen fünf Jahren rd. 8,7 Mio. € staatlicher Subventionen der linken Ampelregierung und der zuvor abgewählten großen Koalition kassiert.
Mit den ganzseitigen Warnungen vor einer Wahl der AfD in den bundesweiten Tageszeitungen "FAZ" und "Zeit" wollte sich Deutschlands größter Lebensmittel-Konzern offenbar die weitere Gunst des Wirtschaftsministeriums unter dem grünen Kinderbuchautor Robert Habeck sowie der Grünen und der SPD sichern. In den vergangenen Jahren kassierte "EDEKA" Millionen-Beträge für "Energie- und Ressourceneffizienz" und die "Förderung von "Elektrofahrzeugen".
Der Zusammenhang wurde von der AfD-Fraktion im Bundestag aufgedeckt. Sie stellte an die Bundesregierung nach der von "EDEKA"-Kaufleuten und Kunden in Ostdeutschland z. T. massiv kritisierten, öffentlich zurückgewiesenen und mit Boykott beantworteten Hetze eine Anfrage, inwiefern der Hamburger Konzern von der Bundesregierung staatliche Fördergelder kassiert - und damit "linientreu" die in den ostdeutschen Ländern z. T. bis in die Einstelligkeit abgewählten Bonner Parteien promotet.
Unter dem Titel "Warum Blau nicht zur Wahl steht" warnte der bereits in der Nazi-Zeit für seine gleichgeschaltete Hitler-Treue bekannte Lebensmittel-Gigant vor der "Bedrohung" durch eine Wahl der AfD und warb mit der mittlerweile berühmt-berüchtigt gewordenen Argumentation von "Vielfalt" indirekt für die Wahl von SPD, Grünen oder CDU, von denen die "EDEKA" bis heute mit Millionensubventionen profitiert.
Die verkorkste Anti-AfD-Hetze war ein unabgestimmter Alleingang der Hamburger Aktiengesellschaft unter Vorstandschef Markus Mosa sowie seiner Marketing- und PR-Abteilung unter Politik-Chef Rolf Lange. Dieser arbeitete zuvor 15 Jahre für den links-woke-agierenden "Beiersdorf"-Konzern (u. a. "Nivea" in "Progressive-Pride"-Regenbogen-Farben). Laut Medienberichten informierte die Konzernzentrale die sieben Regionalgenossenschaften erst am Tag des Erscheinens über die Schaltung der missratenen Parteinahme.
Weder die sieben Genossenschaften - für Ostdeutschland "Nord", "Minden" und "Nordbayern-Sachsen-Thüringen" - noch ihre insgesamt 3.400 selbständigen Kaufleute wurden vorab informiert und konnten daher die nicht in ihrem Interesse liegende Parteilichkeit zurückweisen. Intern ist die Hamburger Zentrale wohl massiv ins Kreuzfeuer der Kritik seitens der mächtigen Regionalgenossenschaften geraten.
Eine Reihe von "EDEKA"-Händlern u. a. aus Sachsen-Anhalt erklärten abgestimmt in sozialen Medien, sich von der Kampagne der Hamburger Zentrale ausdrücklich zu distanzieren, als Lebensmittelhändler keinerlei Politik zu betreiben und jeden Kunden gleich zu bedienen. Zudem verbaten sich ostdeutsche Kunden in Social Media Posts, von "EDEKA" belehrt zu werden, wie sie sich gesünder ernähren sollten, mit ihrem Haushaltsgeld besser auskommen und wen sie wählen dürfen und wen nicht.
Die "EDEKA" war bereits während der Corona-Pandemie durch Regierungstreue negativ aufgefallen. Die politisch agierende Zentrale schaltete Anzeigen in Tageszeitungen für die Impfkampagne der Bundesregierung. Offenbar ist es Politik der "EDEKA", sich durch demonstrierte Nähe zur politischen Macht wirtschaftliche Vorteile zu sichern. Der voreilige Nazi-Gehorsam und die Gleichschaltung der gesamten Organisation unter NS-Führung sollte ab 1923 jüdische Kaufleute als Konkurrenten ausschalten, berichtete eine kritische "Phoenix"-Geschichtsdokumentation. Vorstandschef Mosa ist u. a. Mitglied in der umstrittenen, linken "Deutschlandstiftung Integration" und im parteinahen "Wirtschaftsrat der CDU".
Redaktioneller Hinweis: Wahlen in Deutschland sind bislang gleich, geheim und frei, d. h., es steht jedem Wähler frei, jede zugelassene Partei zu wählen. Die Argumentation, eine rechte Partei gefährde die von SPD und Grünen propagierte "Vielfalt" in Deutschland, ist für die Angehörigen der ermordeten Opfer von islamistischen Messerattacken - zuletzt u. a. in Solingen, Wolmerstedt, Mannheim und Brokstedt ein Schlag ins Gesicht. Als Mitglied der freien - nicht der öffentlich-rechtlichen - Presse bilden wir uns eine eigene Meinung - und veröffentlichen diese gemäß des Hanse Digital Codex. -
 |
Zähne in 2 Minuten repariert - Cashback nach 5 Minuten nicht mehr möglich.
(Screenshot: HANSEVALLEY) |
-
Bewerberportal-Studie von Softgarden bringt Unprofessionalität von Stellenausschreibungen und Personalabteilungen ans Tageslicht.
 |
Vor dieser Studie sollten sich Personalabteilungen zurecht fürchten.
Screenshot: HANSEVALLEY |
Berlin, 10.09.2024: Trotz Fachkräftemangel weisen Recruitingprozesse und genutzte Medien von Personalabteilungen gravierende Mängel auf. Die Konsequenz: Jobsuchende, die Bewerbungsverfahren in negativer Erinnerung behalten, teilen ihre Erfahrungen mit anderen und schädigen massiv den Ruf der unprofessionell auftretenden Arbeitgeber. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Untersuchung des Berliner Recruiting-Portal-Anbieters "Softgarden".
Gut 70 % der Befragten Bewerber sind aktuell auf dem Arbeitsmarkt aktiv, weil sie sich beruflich verbessern möchten. Der Anteil der Jobverbesserer ist damit seit Jahresbeginn noch einmal um drei Prozentpunkte gestiegen. Das bedeutet: Arbeitgeber müssen Jobsuchende mit Marke, Medien und Prozessen davon überzeugen, dass sie eine bessere Alternative bieten. Das gelingt ihnen aktuell jedoch nur selten.
Mit dem Bewerbungsprozess macht nur eine Minderheit der Bewerbenden von 45,2 % uneingeschränkt positive Erfahrungen. Es mangelt vor allem an transparent gelieferten Informationen (nur 42,3 % erhalten diese in zufriedenstellender Form) und an der Nachvollziehbarkeit (49,6 %). Lediglich 43,8 % geben an, dass ihnen im Prozess ein uneingeschränkt klares Bild vom Unternehmen als Arbeitgeber vermittelt wurde.
Als Beispiele kann HANSEVALLEY z. B. von verschwurbelten Ausschreibungstexten bei "Beiersdorf" in Hamburg, von unklaren Rahmenbedingungen und "toter Käfer"-Aktion der Personalabteilung bei der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG Bau), aber auch von offenen und fairen Prozessen und Abstimmungen bei der Personalbeschaffungstochter der Sparkassen - "S-Personalberatung" - berichten. Tech-Startups und Jungunternehmen, wie "Bolt" und "Uber" halten es für überhaupt nicht nötig, sich zurückzumelden.
Je negativer die Erfahrungen im Bewerbungsprozess, desto größer ist die Neigung, diese mit anderen zu teilen. Während nur 43,5 % der Bewerbenden mit eindeutig positiver Sicht auf das Bewerbungsverfahren ihre Erlebnisse teilen, sind es bei denjenigen mit negativem Erlebnis 57,1 %. Während positive Erfahrungen in der Bewerbung bei nur 4,5 % eine Bewertung auf "Kununu" & Co. auslösen, sind es bei negativen Erfahrungen 15,8 %.
Schon bei den Stellenanzeigen gibt es viel zu optimieren: 52,0 % der Befragten haben schon einmal von einer Bewerbung abgesehen, weil die Annonce zu ungenau, zu hochtrabend oder widersprüchlich formuliert war. Ein Teilnehmer berichtet über „Rechtschreibfehler und falsche Versprechungen“, ein anderer schreibt: „Es kam mir vor, als hätte die Stellenanzeige ein Achtklässler geschrieben.“
36,3 % der Bewerber berichten, dass der Text in der Stellenanzeige nicht zur späteren Jobrealität gepasst habe und im Text die „Dinge schöngeredet“ wurden. Bei den Jobtiteln werden simple Tätigkeiten zudem oft durch vermeintlich hippe englischsprachige Bezeichnungen hochgejazzt. Dabei ziehen 62,5 % die schlichte deutschsprachige Bezeichnung „Empfangsmitarbeiter (m/w/d)" dem „Receptionist (m/w/d)“ als Jobtitel vor.
Aus Sicht der Bewerber kommen Karriereseiten nicht schnell genug auf den Punkt: 78,2 % ziehen kompakte Karriereseiten mit Zahlen und Fakten umfangreichen Informationsangeboten mit vielen Unterseiten vor. Das Mitarbeiter-Testimonial fällt mit 37,7 % im Vergleich zu unbearbeiteten Statements aus Arbeitgeberbewertungen (62,3 %) mittlerweile deutlich ab. Hier zeigen Unternehmen und ihre Personalabteilungen, was sie nicht können.
HANSEVALLEY erfuhr von Fach- und Führungskräften, dass diese bei Ausschreibungen über bestimmte Portale, wie z. B. dem US-Recruiting-Service "Workday", die Finger von einer Bewerbung lassen. Grund: "Workday" verlangt wiederholt eine zeitfressende händische Eingabe von Karrierestufen, die andere Portale aus dem Lebenslauf automatisiert auslesen.
Für die "Softgarden"-Studie wurden 5.177 Bewerber von Mai bis Juli '24 befragt. Das Whitepaper "Marke und Medien 2024“ zur Studie ist auf der Website von "Softgarden" erhältlich: softgarden.com/de/marke-und-medien-2024. -
Spiegel fällt Redaktions-Vize "IM Amann" und ihre versuchte Corona-Mail-Spitzelei auf die Füsse.
 |
Wer den Schaden verursacht, muss sich über die Kritik nicht wundern: "IM Amann".
Foto Melanie Amann, X |
Hamburg/Berlin, 09.09.2024: Das Nachrichten-Magazin "Spiegel" hat einen neuen, handfesten Skandal im Haus. Nach den 2018 entdeckten Märchen-Geschichten mit erfundenen Fakten und fiktiven Geschichten des vermeintlichen "Spiegel"-Star-Redakteurs Claas Relotios und den wiederholten Machtkämffen um die Sessel der Chefredaktion in diesem Jahr macht die stellvertredende links-außen stehende Vize-Chefredakteurin Melanie Amann unappetitlich von sich reden.
Die in Berlin arbeitende Juristin aus Siegburg bei Bonn wollte in der Corona-Pandemie unliebsame, ehemalige Mitarbeiter ausspionieren lassen. Der "Spiegel" bestätigt gegenüber dem Nachrichten-Portal "NIUS" die Vorwürfe gegen die gern einseitig links ausholende Polit-Journalistin. Während der Pandemie unterstützte sie als Mitglied der Chefredaktion einen strammen Corona-Regierungskurs - mit der Wissenschaftsredaktion als "Heilige Inquisition der Spanischen Grippe", so Insider.
Der entscheidende Vorwurf: Im Jahr 2020 soll Amann gegen eine ehemalige "Spiegel"-Mitarbeiterin Überwachungsmethoden gefordert haben, so "NIUS". Die redaktionelle Mitarbeiterin - so der fadenscheinige Grund für den Angriff auf das vertrauliche Postfach der Kollegin - soll eine kritische Corona-Story unerlaubt vorab in die Öffentlichkeit, vor allem an den bekannten Virologen Klaus Ströhr. gebracht haben.
Amann passten - so die Ausswertung von E-Mails der umstrittenen Journalistin - die kritischen Hinweise des Virologen nicht in ihr stramm regierungsfreundliches Weltbild. Und so soll sie den Ombudsmann den E-Mail-Account aufgefordert haben, nachdem die Journalistin bereits das Unternehmen an der Ericuswieder Spitze verlassen hatte. "NIUS" berichtet, Amann agitierte massiv gegen die Ex-Kollegin und wollte um jeden Preis die Korrespondenz durchleuchten lassen.
Der "Spiegel" erklärte gegenüber "NIUS", dass man das Durchleuchten des dienstlichen Postfachs der Ex-Kollegin zwar geprüft, dann aber die Finger davon gelassen habe. Die Chefredaktion bewertete eine Bespitzelung des Postfachs schließlich als unverhältnismäßig. Eine Reihe von Kollegen im Hamburger Verlagshaus bezeichnen die heutige Vize-Chefin als "IM Amann". Sie selbst spielte auf Anfrage gegenüber "NIUS" "toter Käfer".
-
Mehr als 400 vertrauliche Sozialhilfe-Dokumente im Datenmüll des Bremer Sozialamts aufgetaucht.
 |
Im Sozialamt der Wesermetropole ist Datenschutz ein Fremdwort.
(Foto: SK Bremen) |
Bremen, 03.09.2024: Das Amt für Soziale Dienste in Bremen hat bei der Überprüfung von Datenmüll-Behältern 432 Dokumente und Schriftstücke aufgefunden, die nach den Grundsätzen der Aktenführung nicht entsorgt hätten werden dürfen. Das geht aus einem Bericht hervor, den Sozialsenatorin Claudia Schilling am vergangenen Donnerstag der Deputation für Soziales, Jugend und Integration vorlegt hat. Bei einem Großteil der Unterlagen geht das Amt nach vorläufiger Sichtung davon aus, dass keine Nachteile für Leistungsempfänger von Sozialleistungen entstanden sind. Unter anderem geht es um 144 Briefe, die ans Amt zurückgekommen sind, weil sie nicht zugestellt werden konnten.
Als Konsequenz stellt das Amt künftig mit einem Falleingangsmanagement sicher, dass alle Anträge zentral in der Software erfasst und verbindlich einer Person in der Sachbearbeitung zugewiesen werden. Außerdem wird das Personal aufgestockt und ein Unternehmen beauftragt, die Strukturen und Prozesse zu beleuchten und Handlungsempfehlungen für weitere Verbesserungen zu entwickeln. "Damit holen wir den externen Blick und die Perspektive von außen ein", so Senatorin Schilling.
Anlass für Sichtung der Datenmüll-Container im Amt für Soziale Dienste war der Verdacht von Betrug bzw. Untreue gegen zwei Beschäftigte. Die Amtsleitung wollte sicherstellen, dass Unterlagen, die im Zusammenhang mit den strafrechtlichen Vorwürfen von Bedeutung sein könnten, nicht im Datenmüll entsorgt worden sind. Stattdessen haben sich Unterlagen aus den Fallbeständen zweier Beschäftigter gefunden, die nicht im Zusammenhang mit den Betrugsvorwürfen standen.
219 der aufgefundenen 432 Fälle betreffen Unterlagen zu Zahlungen, die von der Computer-Software automatisch erzeugt werden, sobald Änderungen eingepflegt oder Zahlungen veranlasst werden. Ein Teil davon hätte den Leistungsempfängern zugestellt, ein anderer Teil zu den Akten genommen werden müssen. In den Unterlagen haben sich auch 14 Anträge auf Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz, UVG befunden. Zwölf davon sind gestellt worden von Bürgergeld-Bedarfsgemeinschaften. In diesen Fällen dient eine UVG-Leistung ausschließlich zur internen Verrechnung zwischen zwei Behörden – Jobcenter und Amt für Soziale Dienste.
Aufgrund des Aktenfundes im Datenmüll hat die Amtsleitung bereits Anfang August d. J. sämtliche 95 Datenmülltonnen in allen sechs Sozialzentren und den beiden zentralen Fachdiensten unangekündigt kontrollieren lassen. Dabei sind nach jetzigem Stand keine weiteren Unterlagen aufgefunden worden, die zu verzögerten oder ausgebliebenen Zahlungen an Leistungsempfänger geführt haben. Die Auswertung im Detail ist noch nicht abgeschlossen, das Ergebnis soll der Deputation für Soziales, Jugend und Integration im September vorgelegt werden.
Als Konsequenz aus dem Vorfall wird ab dieser Woche ein eigenes Falleingangsmanagement sicherstellen, dass sämtliche Anträge elektronisch erfasst und in der Sachbearbeitung zugewiesen werden. Außerdem wird der Fachdienst mit sechs Personen personell verstärkt, sodass er personell besser aufgestellt ist als vor den Vorfällen. In der zentralen Fachstelle UVG arbeiten derzeit 53 Beschäftigte auf rechnerisch 47,74 Stellen. Weitere Stellen sind ausgeschrieben.
-
Hamburger Kripo kutschiert Beweis-Daten quer durch die Stadt - BKA-Cloud in der Grote-Behörde unerwünscht.
 |
Außen "hui", innen Kreidetafeln zur Cybercrime-Bekämpfung.
(Foto: Staro1, Lizenz: CC-BY-SA-3.0) |
Hamburg, 02.09.2024: Die Bekämpfung der steigenden Internet-Kriminalität an Alster und Elbe droht an Personalnot und überalterter Computer-Technik zu scheitern. Danach setzt das Landeskriminalamt der Hamburger Polizei z. T. Uralt-Rechner und Festplatten ein, die durch die halbe Stadt gefahren werden. Obendrein kommen Probleme mit Facebook und anderen Netzwerken, die es den Fahndern schwer machen, Straftaten im Internet aufzuspüren und dingfest zu machen.
Um Internet-Straftaten auswerten und erfolgreich zu einer Anklage zu kommen, müssen Terrabytes an Daten ausgewertet werden - z. B. von sichergestellten Festplatten, USB-Sticks, Handys und mobilen Datenträgern, wie SD-Karten. Das Problem: Hamburg nutzt keine sicheren Cloud-Speicher für die Rohdaten, wie sie vom BKA den Landespolizeien bereitgestellt werden. Die Hamburger Polizei prüft die Möglichkeiten noch. Doch das Angebot läuft Mitte kommenden Jahres aus.
Nicht genug, dass die Hamburger Polizei moderne Cloud-Systeme des BKA nicht nutzen darf. Die Sicherung eines Datensatzes z. B. von einem beschlagnahmten Handy dauert bis zu 18 Monate. Grund: Jeder Datensatz muss erst kopiert werden und anschließend mit dem Gutachten eines Fachmanns festgestellt werden, dass die beschlagnahmten Daten mit der angefertigten Kopie identisch sind. Erst nach der forensischen Datensicherung kann und darf ausgewertet werden.
Zur Auswertung der kopierten und damit gesicherten Daten kann aber nur auf Stand-alone-Rechnern ohne Internet-Zugang durchgeführt werden. Und die sind in verschiedenen Kommissariaten im Hamburger Stadtgebiet verteilt, berichtet die "Hamburger Morgenpost" in Ihrer Aufmachergeschichte. Und so müssen die Datenträger wie zur Zeit von Pferdefuhrwerken durch die halbe Stadt kutschiert werden, um überhaupt ausgewertet werden zu können.
Jan Reinicke, Landesvorsitzender des Bundes Deutscher Kriminalbeamter, lässt an der Grote-Behörde und der mangelhaften Ausstattung der Kripo kein gutes Haar. Begründung: Die Rechner sind überaltert, ebenso wie die darauf laufenden Betriebssysteme. Heißt im Klartext: hochauflösende Videos oder Fotoserien brauchen ewig, bis sie auf den Steinzeit-Rechnern überhaupt gesichtet werden können. Bis 2021 lief auf den Rechnern sogar noch das Steinzeit-Betriebssystem Windows 7.
Die Crux: Zwar legt die Polizei hohe Priorität auf Fälle mit Untersuchungshäftlingen. Dennoch schaffen es die Beamten immer wieder nicht, die Fristen einzuhalten, um alle Beweise auszuwerten und der Staatsanwaltschaft die notwendigen Mittel für eine Anklage zu liefern. Folge des Personalmangels und der Steinzeit-Technik: Immer wieder müssen Verbrecher aus der U-Haft entlassen werden, weil es die Polizei nicht schafft.
Kripo-Vertreter Reinicke fordert, vom Shuttle-Verkehr von Beweisdaten per Polizeitransporter endlich wegzukommen. Wie in anderen Bundesländern soll die Innenbehörde endlich das BKA-Angebot einer hochsicheren Polizeicloud in Anspruch nehmen. Der Polizeivertreter auf den Punkt: "Aber die Hamburger Kriminalpolizei malt bekanntlich, was die IT-Ausstattung angeht, in vielerlei Hinsicht nach wie vor auf Höhlenwände." So können Straftaten unterm Strich nicht aufgeklärt werden.
Im vergangenen Jahr wurden in der Freien und Hansestadt rd. 3.400 Fälle von Internet-Kriminalität festgestellt. Mit 2.800 waren die meisten Verbrechen Vermögens- und Fälschungsdelikte, um sich auf Kosten anderer zu bereichern. Ebenfalls immer brisanter: die 1.580 Fälle von Waren- und Kreditbetrug und 477 bekanntgewordene Fälle von Spionage.
-
EDEKA schießt sich mit Anti-AfD-Kampagne ins Knie - Nazivergangenheit gegen jüdische Kaufleute in Social Media diskutiert.
 |
Die Anti-AfD-Propaganda wird von EDEKA-Händlern zurückgewiesen.
Grafik: Facebook |
Hamburg, 02.09.2024: Die Konzern-Zentrale des Lebensmittel-Filialisten "EDEKA" hat sich mit ihrer Anti-AfD-Kampagne in Tageszeitungen wie "FAZ" und "Zeit" vollständig blamiert. Nach Veröffentlichung der links-woken Polit-Propaganda unter dem Titel "Warum bei Edeka Blau nicht zur Wahl steht" sind zahlreiche "EDEKA"-Kaufleute, insbesondere aus Ostdeutschland, auf die Barrikaden gegangen und haben einen Shitstorm über "EDEKA" hereinbrechen lassen. Betroffen ist vor allem Sachsen-Anhalt und die zuständige "EDEKA"-Genossenschaft in Hannover-Minden.
In einem
abgestimmten Social Media Post machen die selbständigen Eigentümer der "EDEKA"-Filialen seit Freitag (30.08.24) klar: "
Aus gegebenem Anlass möchte ich hiermit signalisieren, dass wir bei allen politischen Themen keine Stellung beziehen! Wir sind ein Supermarkt, den ich als selbständiger Einzelhändler verantworte und wo jeder Mensch einkaufen kann.“ Eine Recherche der konservativen Wochenzeitung "Junge Freiheit" ergab, dass u. a. Kaufleute in Aschersleben, Halberstadt und Zerbst auf Distanz zur Polit-Propaganda verbreitenden Holding in Hamburg gehen.
Allein der Post des "EDEKA-Centers Becker" in Zerbst brachte in kurzer Zeit mehr als 2.500 Likes, aber auch 2.200 Kommentare. So griffen politisch-korrekte, links-woke User den Kaufmann an, versuchten ihn in einer "Nazi-Ecke" zu stellen und drohten mit Boykott. Andere Leser bekräftigten die Neutralitätsbekundung und betonten, dass die im Netz entbrannte Kritik an "EDEKA" die Konzern-Zentrale in Hamburg betreffe, und nicht die einzelnen Kaufleute vor Ort. Andere Nutzer unterstützen die klare Absage an die Polit-Kampagne der Hamburger Marketing- und PR-Abteilung.
 |
EDEKA-Kunden verpassen dem Lebensmittel-Riesen eine "Abreibung".
Quelle: "X"
|
Die Distanzierung der Händler zeigt: Der mit dem rot-grünen Senat in Hamburg kollaborierende "EDEKA"-Konzern hat die verwirrende Anzeige mit einem Vergleich der AfD mit vermeintlich ungenießbarem blauen Obst und Gemüse ohne jegliche Rückendeckung der sieben regionalen Genossenschaften (z. B. Nord und Minden) und ohne jegliche Abstimmung mit seinen über 3.400 selbständigen Kaufleuten geschaltet.
Das bürgerliche Nachrichten-Portal "NIUS" wunderte sich über die politische Propaganda des Lebensmittel-Konzerns - insbesondere angesichts zahlreicher Messerattacken auf Kunden und Sicherheitsmitarbeiter. Zitat "NIUS": "2017 stach der Asylbewerber aus Gaza, Ahmad A., in Hamburg in einem EDEKA-Laden mit einer 20 Zentimeter langen Klinge auf Personen ein, die dort einkauften. Er schrie dabei „Allahu Akbar“. Ein 50-Jähriger starb. Im August 2023 stürmten zwei Männer mit einer Machete in einen Edeka in Berlin-Kreuzberg und gingen auf den Sicherheitsdienst los. Und in zahlreichen Märkten, etwa in Ortrand, Essen, Senftenberg oder Burgwedel, kam es ebenfalls zu Gewalttaten, die unter anderem von Migranten verübt wurden."
Das Agentur-Branchenmagazin "W&V" nannte die Anzeigen-Kampagne gegen die AfD anlässlich der gestrigen Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen und der bevorstehenden Wahl in Brandenburg "kreativ eine Meisterleistung, kommunikativ eine Katastrophe". Eine unkontrollierbare kommunikative Katastrophe droht der "EDEKA" jetzt durch eine Dokumentation des öffentlich-rechtlichen Ereignis-Kanals "Phoenix". Grund: "EDEKA" unterwarf sich den Nazis noch vor der Machtergreifung 1933 - um mit Unterstützung von Hitler jüdische Kaufleute als Konkurrenten loszuwerden.
So empfahl der Genossenschaftsvorstand seinen Mitgliedern, sich den nationalsozialistischen "Kampfbünden" anzuschließen, wählten die "EDEKA"-Kaufleute einen NS-Partei-Funktionär an ihre Spitze, schaltete der Verbund die gesamte Organisation auf Nazi-Kurs gleich, wurde in der zentralen Mitgliederzeitung NS-Propaganda unter der Überschrift "
Deine Stimme für den Führer" veröffentlicht und verkaufte "EDEKA" in ihren Filialen den "Arierpass" - kartoniert oder in Leder eingefasst. Der Beitrag kann u. a.
hier auf "X" geschaut werden.
Weder die "EDEKA-Zentrale" in Hamburg noch die drei in Ostdeutschland zuständigen Regionalgenossenschaften "Nord" (für MV), "Minden" (für Berlin, Brandenburg und Sachsen-Anhalt) und "Nordbayern-Sachsen-Thüringen" haben bis heute Stellung bezogen zur missratenen Anti-AfD-Propaganda oder ihrer eigenen nationalsozialistischen Vergangenheit. Offenbar stehen die "EDEKA"-Manager flächendeckend zu ihrem Angriff auf Wähler anderer Parteien, als CDU, CSU. FDP, SPD oder Grüne.
Was die Kunden der "EDEKA" in der demnächst einen neuen Brandenburger Landtag wählenden Region Lausitz über die Umerziehungsversuche der Hamburger Konzernzentrale denken, berichtet das bürgerliche Nachrichtenportal "NIUS" in einer Umfrage vor Ort. Redaktioneller Hinweis: Wahlen in Deutschland sind bislang gleich, geheim und frei, d. h., es steht jedem Wähler frei, jede zugelassene Partei zu wählen. Die Argumentation, eine rechte Partei gefährde die von SPD und Grünen propagierte "Vielfalt" in Deutschland, ist für die Angehörigen der ermordeten Opfer von islamistischen Messerattacken - zuletzt u. a. in Solingen, Wolmerstedt, Mannheim und Brokstedt ein Schlag ins Gesicht. Als Mitglied der freien - nicht der öffentlich-rechtlichen - Presse bilden wir uns eine eigene Meinung - und veröffentlichen diese gemäß des Hanse Digital Codex. -
Hamburger EDEKA-Konzern hetzt mit verwirrenden Obst- und Gemüse-Botschaften gegen bevorstehende AfD-Wahl in den ostdeutschen Ländern.
 |
Mit verwirrenden Obst- und Gemüsenvergleichen hetzt EDEKA gegen die AfD.
Grafik: EDEKA |
Hamburg, 30.08.2024: Deutschlands größter Lebensmittel-Filialist, der Hamburger "EDEKA Verbund" (u. a. Budni Service, Edeka, Edeka Aktiv-Markt, Marktkauf, Netto Marken-Discount und Neukauf) hat sich - wie zuvor der Hamburger Versandhändler "Otto" (u. a. About You, Baur, Bonprix, Heine, Franconia, Lascana, Limango, Manufactum, Otto.de, Schwab, Sheego und Witt) und der Hamburger Körperpflege-Hersteller "Beiersdorf" (u. a. Eucerin, Florena, Hansaplast, Hidrofugal, Labello, La Prairie, Nivea, Tesa und 8x4) aktiv in die Politik eingemischt - hier in den Wahlkampf in den ostdeutschen Bundesländern und die Ablehnung breiter Kreise der Bevölkerung gegenüber der aktuellen, tödlichen Migrationspolitik mit Parolen gegen die zugelassene Rechtspartei AfD versucht, wegzureden.
Während der in den roten Zahlen steckende, überalterte Versandhändler "Otto" im Rahmen des "Christopher Street Days" am 3. August d. J. in Hamburg mit einem politisch-korrekten, links-woken "Progressive Pride"-beklebten Truck "Rechts in die Queere" kommen wollte, macht sich der konservative, als Genossenschaftsverbund organisierte "EDEKA"-Konzern mit seinen 3.400 selbständigen Kaufleuten und rd. 410.000 Beschäftigten mit einer "Anti-Blau"-Kampagne und an den Haaren herbeigezogenen Vergleichen zu blauem Obst und Gemüse in der nationalen Presse lächerlich: "Die Blauen" sind schon heute die größte Bedrohung einer vielfältigen Gesellschaft.“
Mit der Kernbotschaft „Wer genau hinsieht, sieht eine Farbe nicht: Blau. Und das ist kein Zufall. Denn blaue Lebensmittel sind ein Warnhinweis der Natur, der uns sagt: „Achtung! Ich könnte unverträglich sein!“ Damit will der selbst mit blauem Logo bekannte "EDEKA"-Konzern in ganzseitigen Anzeigen großer Tageszeitungen, wie "FAZ" und "Zeit" Flagge zeigen und gegen die Wahl der AfD aktuell in Sachsen, Thüringen und Brandenburg politisch zweifelhaft Stimmung machen. "EDEKA" wörtlich: „Lasst uns also zu den Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg im September die Warnhinweise richtig lesen – und für ein verträgliches Miteinander sorgen.“
Das bürgerliche Nachrichten-Protal "NIUS" wundert sich über die politische Propaganda des Lebensmittel-Konzerns - insbesondere angesichts zahlreicher Messerattacken auf Kunden und Sicherheitsmitarbeiter von "EDEKA"-Filialen in ganz Deutschland. Zitat "NIUS": "2017 stach der Asylbewerber aus Gaza, Ahmad A., in Hamburg in einem EDEKA-Laden mit einer 20 Zentimeter langen Klinge auf Personen ein, die dort einkauften. Er schrie dabei „Allahu Akbar“. Ein 50-Jähriger starb. Im August 2023 stürmten zwei Männer mit einer Machete in einen Edeka in Berlin-Kreuzberg und gingen auf den Sicherheitsdienst los. Und in zahlreichen Märkten, etwa in Ortrand, Essen, Senftenberg oder Burgwedel, kam es ebenfalls zu Gewalttaten, die unter anderem von Migranten verübt wurden."
Redaktionelle Anmerkung: Wahlen in Deutschland sind bislang gleich, geheim und frei, d. h., es steht jedem Wähler frei, jede zugelassene Partei zu wählen. Die Argumentation, eine rechte Partei gefährde die von SPD und Grünen propagierte "Vielfalt" in Deutschland, ist für die Angehörigen der ermordeten Opfer von islamistischen Messerattacken - zuletzt u. a. in Solingen, Wolmirstedt, Mannheim und Brokstedt ein Schlag ins Gesicht. Als Mitglied der freien - nicht der öffentlich-rechtlichen - Presse bilden wir uns eine eigene Meinung - und veröffentlichen diese gemäß des Hanse Digital Codex. Islamistische Attentate in Verantwortung von Bundeskanzlerin Angela Merkel, CDU (Auszug):
- 2016: Ansbach - Weinlokal/Altstadt: Bombenanschlag, 15 Schwer-/Verletzte, Der Täter: Syrer, 22, illegaler Asylbewerber, ausreisepflichtig
- 2016: Berlin - Weihnachtsmarkt/Gedächtniskirche: LKW-Anschlag, 13 Tote, 67 Schwer-/Verletzte: Der Mörder: Tunesier, 23, illegaler Asylbewerber, ausreisepflichtig
- 2017: Würzburg - Regionalzug: Axt- & Messerattacke, 5 Schwer-/Verletzte, Der Täter: Pakistaner, 17, illegaler Asylbewerber mit falscher Identität
- 2021: Würzburg - Altstadt: Messerattacke, 3 Tote, 5 Schwer-/Verletzte, Der Täter: Somalier, 32, abgelehnter Asylbewerber, in psychiatrischer Behandlung
Islamistische Attentate in Verantwortung von Bundeskanzler Olaf Scholz, SPD (Auszug):- 2023: Brokstedt - Regionalzug: Messerattacke, 2 Tote, 3 Schwer-/Verletzte, Der Mörder: staatenloser Palestinenser, 33, mit psychischen Problemen, drogenabhängig
- 2024: Mannheim - Marktplatz: Messerattacke, 1 toter Polizist, 5 Schwer-/Verletzte, Der Mörder: Afgane, 25, abgelehnter Asylbewerber, mit Deutscher verheiratet
- 2024: Wolmirstedt - private Gartenparty, 1+1 Toter, 3 Schwer-/Verletzte. Der Mörder: Afgane, 27, geistig gestört, kein religiöses Motiv erkennbar
- 2024: Solingen - Stadtfest/Marktplatz: Messerattacke, 3 Tote, 8 Schwer-/Verletzte, Der Mörder: Syrer, 26, abgelehnter Asylbewerber, ausreisepflichtig, untergetaucht
Wir stehen mit Redaktionsmitgliedern aus Ostdeutschland, mit Redaktionsmitgliedern aus der Gay-Community und unabhängigen Journalisten ohne politische Wahlempfehlung an der Seite jedes einzelnen Opfers - und nicht an der Seite opportunistischer Unternehmen, ihrer Kommunikations- und Marketing-Abteilungen, um durch "Gratis-Mut" und Lippenbekenntnisse eigene Vorteile durch die Politik zu sichern. Wir sagen heute: Falsch verstandene Vielfalt tötet Leben.-
Zehntausende HVV-Zeitkartenkunden warten seit mehr als einem Jahr auf ihren QR-Code für das Deutschlandticket in der Switch-App.
 |
Pleiten, Pech und Pannen. Der HVV mit seinem digitalen Vollausfall Switch.
(Foto: HVV) |
Hamburg, 30.08.2024: Das "Deutschlandticket" des Hamburger Verkehrsverbundes HVV ist in der Kritik. Mit Einführung des "D-Tickets" zum 1. Mai 2023 bot der HVV allen Nutzern der bisherigen, teureren HVV-Zeitkarten an, diese automatisch in das günstige, einheitliche und bundesweite "Deutschlandticket" umzuwandeln. Von den bundesweit rd. 11 Millionen "D-Tickets" hat der älteste deutsche Verkehrsverbund über 1 Mio. Stück ausgegeben - davon allein rd. 267.000 "Job-Tickets" von 4.800 Unternehmen in Hamburg und der Metropolregion.
Das Problem: Die bisherigen HVV-Zeitkarten sollten als digitales "Deutschlandticket" automatisch als digitale Version in die von Politik, Hochbahn und HVV hochgejubelte "Switch-App" integriert werden. "Kreiszeitung.de" fand heraus, dass HVV-Kunden auch 16 Monate nach der Umstellung immer noch nicht ihren QR-Code zum Aktivieren des digitalen "Deutschlandtickets" in der als modern promoteten App bekommen haben. Bis Ende September '23 wurde die "Switch-App" allein 1 Mio. mal für Android und iOS heruntergeladen.
Während langjährige HVV-Zeitkarten-Nutzer durch die Umstellung auf die "HVV Switch"-App einen Nachteil haben, bekommen Neukunden, die das "Deutschlandticket" über die "Switch"-App bestellt haben, automatisch digital bereitgestellt. Das offizielle Statement dazu lautet: „Es klingt absurd, aber der schnellste Weg an ein Digital-Ticket zu kommen, ist, das bisherige Abo zu kündigen – und ein neues über die Switch-App abzuschließen“, erklärt HVV-Sprecher Rainer Vohl.
Technisch hat es der HVV und die hinter der "Switch-App" stehende Hochbahn AG bis heute nicht geschafft, zehntausende umgestellter Abos der Bestandskunden als digitales Ticket in die App zu bekommen. Der HVV hat bis heute gut 200.000 Abonnenten angeschrieben, damit diese das "alte Abo" per QR-Code als "D-Ticket" in der App nutzen zu können. Mehrere 10.000 Nutzer wurden gar nicht angeschrieben, schreibt "24hamburg.de".
Der verantwortliche HVV erklärt seinen Bankrott bei der Umstellung seiner Zeitkarten-Nutzer auf das "Deutschlandticket". „Das Team, das sich um die Aussendung der Codes kümmert, ist derzeit damit befasst, das kostenlose HVV Deutschlandticket für Schüler mit Wohnort Hamburg, das ab nächsten Monat gilt, auf die Beine zu stellen“, gibt Sprecher Rainer Vohl unumwunden zu. Hintergrund: Zunächst sollen die 140.000 Schüler der Hansestadt ihren QR-Code für das kostenlose Deutschlandticket mit Start 1. September '24 bekommen.
Für die digitalen Services von HVV und Technikpartner Hochbahn ist das praktisch ein Offenbarungseid, denn: Laut Vohl können und werden die oft jahrelang viel Geld zahlenden HVV-Zeitkarten-Kunden noch Monate auf ihren QR-Code zur Umstellung auf die "Switch-App" warten. Der Sprecher versucht, mit der taggenauen Abrechnung des "D-Tickets" seitens des HVV die technische Vollpleite kleinzureden.
Ein ausführlicher Beitrag zum Thema ist auf "24hamburg.de" nachzulesen. -
Tagesschau beim NDR behauptet trotz gerichtlichen Verbots, dass beim rechten Potsdam-Treffen Deportationen diskutiert wurden.
 |
Schöner Schein - gerichtlich untersagte Falschbehauptungen: die Tagesschau.
Grafik: ARD |
Hamburg/Köln, 29.08.2024: Die "ARD Tagesschau" - produziert von der Redaktion "ARD aktuell" beim NDR in Hamburg-Lockstedt - verbreitet trotz gerichtlichen Verbots offenbar weiter die Behauptung, bei dem Treffen konservativer und rechter Politiker sowie Interessierter im "Landhaus Adlon" in Potsdam-Neufahrland am Lehnitzsee sei über die Ausweisung von Bewohnern diskutiert worden.
Der von den Hamburger Fernseh-Journalisten befragte Rechtsexperte Ulrich Karpenstein aus der Berliner Kanzlei Redeker, Sellner, Dahrs arbeitet dabei als "Experte" für die ARD. Die Fachzeitschrift "Juve" listet Karpenstein seit 2013 als „führenden Berater im Verfassungs- und Wirtschaftsverwaltungsrecht“. Karpenstein bestätigte der Redaktion von "tagesschau.de" die angeblichen Pläne als "ganz klar verfasssungswidrig" und "das setze einen Staatsstreich voraus". "ARD aktuell" verbreitete die vom Oberlandesgericht Hamburg am 23. Juli d. J. per einstweiliger Verfügung untersagte Aussage als "Unwahrheit" einfach weiter.
Trotz der klaren Ansage des Hamburger Gerichts behauptet "ARD aktuell", es sei bei der - von der staatlich finanzierten und als gemeinnützig eingestuften Polit-Redaktion "Correctiv" - veröffentlichen Story Ende November 2023 im Potsdamer Landhotel um die Ausweisung von Einwohnern gegangen. Der gegen die dreisten Lügen von "Correctiv" und "Tagesschau" klagende Verfassungsrechtler Ulrich Vossgerau und persönlicher Beobachter des Treffens in Potsdam hat nun Programmbeschwerde gegen den NDR eingelegt.
Die vermeintlich professionellen Berichterstatter bei "ARD aktuell" in Hamburg-Lockstedt haben nach einem der "Jungen Freiheit" vorliegenden Beweis über Monate die unwahren Behauptungen zu möglichen Deportationen weiter verbreitet. Der Fall wird von der renommierten Kölner Medienkanzlei Höcker vertreten. Sie hatte Vossgerau bereits gegen den NDR und seine unwahre Berichterstattung vor dem OLG Hamburg erfolgreich vertreten.
Eine weitergehende Einordnung zum Thema ist auf den Seiten der Medienkanzlei Höcker nachzulesen. -
Pöbelnder Versandhändler will mit Kampf gegen Rechts schwule Interessen vertreten dürfen.
 |
Mit "Kampf gegen Rechts" vergrault sich "Otto" bürgerliche Kunden.
(Foto: Otto.de) |
Hamburg, 22.08.2024: Der letzte verbleibende deutsche Großversender - "Otto" - macht erneut von sich negative Schlagzeilen. Der in den roten Zahlen steckende Distanzhändler aus dem Katalogzeitalter hat auf dem diesjährigen "Christopher Street Day" an seinem Stammsitz Hamburg politische Propaganda mit den Rechten für Schwule vermischt und damit den links-woken Kurs sowohl des rot-grünen Senats als auch anderer Familienunternehmen an der Alster, wie "Beiersdorf", weiter bekräftigt.
Mit saufenden, nakten CSD-"Fans & Friends" auf dem Firmentruck demonstrierte der eigentlich konservative Familienkonzern in politisch-korrekter "Progressive-Pride"-Beklebung, "Rechts in die Queere kommen" zu wollen. Das bereits im März vergangenen Jahres mit seiner "Unisex-Toilette" im Gästebereich der Konzernzentrale in Hamburg-Bramfeld aufgefallene Versandhaus vergrault sich damit immer weiter bürgerliche Kunden, die von linker und "woker" Klientel-Politik nichts wissen wollen. „Bei Otto beschäftigt sich ein ganzes Team mit dem Thema Diversity & Inclusion, das maßgeblich an Publikationen wie dem Transidentity Guide oder dem Diversion & Inclusive-Report beteiligt ist“, verkündet das Unternehmen stolz, dass im Kundendienst auch schon mal Käufer anpöbelt und Journalisten mit Strafanzeigen überzieht, um ein Klima der Abschreckung zu schaffen, wie HANSEVALLEY-Chefredakteur Thomas Keup selbst erleben musste.
Das Social-Media-Team von "Otto" machte 2021 von sich reden, erinnert das bürgerliche Nachrichten-Portal "Nius". Ein Twitter-User schrieb angesichts eines schon damals von Otto benutzten "Gender-Sternchens": „Wer gendert, kriegt keine Bestellung. So einfach ist das und Amazon freut sich.“ Von "Otto" kam die arrogante Antwort: „Stimmt, so einfach ist das: Wir gendern. Und du musst nicht bei uns bestellen“. Eine ähnliche Antwort bekam unser Chefredakteur auf den Hinweis, nach einem Versandchaos mit der Konzerngesellschaft "Hermes" das nächste Mal lieber bei "Amazon" zu bestellen (HANSEVALLEY berichtete). Der Handels-, Logistik- und Finanzkonzern "Otto" ist im abgelaufenen Geschäftsjahr 2023/2024 mit Stichtag 29.02.2024 weiter in die roten Zahlen gerutscht. So stieg der Fehlbetrag trotz 2.500 entlassener und anderweitig abgebauter Mitarbeiter von -413 Mio. € auf -426 Mio. €. Hauptgrund für die noch schlechteren Jahreszahlen ist vor allem der massiv eingebrochene Gesamtumsatz des Konzerns von 16,19 Mrd. € in 22/23 auf nur noch 14,96 Mrd. € in 23/24 - und damit um eine weitere Mrd. € weniger.
Unternehmensberater von "Boston Consultants" sollen den angeschlagenen, als teuer, langsam und kundenfeindlich verrufenen Handelsriesen wieder flott machen. Ob eine Me-too-Strategie mit Billigartikeln aus Asien a lá "Aliepress", "Shein" oder "Temu" die Hamburger Händlerdynastie aus den roten Zahlen bringt - oder ob zwangsweises Gendern neue, junge Kundengruppen wie die "GenZ" zu "Otto" bringen, darf angesichts ausgefeilter Strategien von Wettbewerbern, wie "Amazon" oder "Galaxus" mehr als bezweifelt werden.
Wokeness und DEI-Propaganda weltweit auf dem Rückzug
In den USA sehen Kunden wie Mitarbeiter bekannter Unternehmen die aufgezwungene und nur vermeintlich menschenfreundliche Unternehmenspolitik rund um Gleichberechtigung immer kritischer: So wehrten sich Mitarbeiter bei "Disney" gegen die zwangsweise "Wokeness". Auch beim Dessous-Hersteller "Victoria Secret's" schlug die progressive Vermarktung hart auf: Nach dicken Modells, Lesben, Behinderten und Transfrauen in der Werbung brachen die Umsatzzahlen um 2 Mrd. US-Dollar im Jahr 2021 ein.
Beim britischen Lebens- und Waschmittel-Hersteller "Unilever" hat man das Thema "Wokeness" ebenfalls beerdigt. Shampoo und Speiseeis bekommen bei diesem Hersteller keine Regenbogenfahne mehr zwangsweise aufgedruckt. Der deutsche CEO von "Harley Davidson" bekam es direkt mit seiner Kundschaft zu tun: Nach protestierenden Bikern mit einbrechenden Umsätzen und Gewinnen wurden "Initiativen zur Förderung von Vielfalt, Gleichberechtigung und Integration" kurzerhand wieder eingestampft.
Unternehmen, wie "Google", "Microsoft" und die Facebook"-Mutter "Meta" haben ihre Teams für "Vielfalt, Gleichberechtigung und Integration" ("DEI") bereits zusammengestrichen oder komplett gefeuert. Nach rd. vier Jahren "DEI-Propaganda" in den USA mit eigenen Beauftragten, hauptamtlichen Teams sowie Marketing- und Personal-Etats stellen die Tech-Giganten fest, dass die Minderheiten-Programme effektiv nichts bringen oder maßgeblich verändern.
Nach der Ermordung des Afroamerikaners George Floyd durch den später verurteilten Polizisten Derek Chauvin in Minneapolis im Jahr 2020 und darauf folgenden Unruhen haben u. a. Technologieunternehmen, darunter auch "Microsoft", ihre Bemühungen um vermeintliche Vielfalt in ihrer Belegschaft verstärkt. Der Software-Riese erklärte z. B., die Zahl der Schwarzen und afroamerikanischen Führungskräfte bis 2025 verdoppeln zu wollen. Ob das Ziel erreicht wurde, ist nicht bekannt.
-
Hamburger Universität und rot-grüner Senat verpulvern 65.000,- € für Kolonialismus-App, die niemand haben will.
 |
Koloniale Orte sind für die nicht ganz so ehrbaren Pfeffersäcke eher kein Thema.
Foto: Uni Hamburg |
Hamburg, 21.08.2024: Die Android- und iOS-App "Koloniale Orte" der staatlichen Universität der Freien und Hansestadt entwickelt sich zum teuren Rohrkrepierer. Die insgesamt drei kuratierten Rundgänge zum kolonialen Erbe der Hamburger Kaufleute und Seefahrer vor dem Hintergrund des Sklavernhandel locken allerdings so gut wie niemanden hinter dem Ofen vor.
Die mit knapp 65.000,- € aus Steuergeldern der Wissenschaftsbehörde finanzierte Polit-App wurde gerade einmal 9.100 aus den App-Stores heruntergeladen - unabhängig von einer tatsächlichen Nutzung. 7.200 mal wurde die "Totgenburt" der staatlichen Hochschule aus dem "Apple App Store geladen, nur gut 1.800 mal aus dem "Google Play Store" für "Android".
Die Entwicklung der offensichtlich überflüssigen App schlug allein mit rd. 59.000,- € zu buchen. Dazu kommen rd. 6.000,- € für die Aktualisierung und Pflege, erfuhr der Hamburger AfD-Abgeordnete Alexander Wolf von der zuständigen Wissenschaftsbehörde der grünen Bürgermeisterin Katharina Fegebank. Rechnet man die Kosten für Entwicklung und Aktualisierung gegen die Downloads hoch, kostet die App für jeden User happige 7.10 € - und das nur in deutscher Sprache.
Die App wurde von einschlägigen Polit-Studenten der UHH aus der Forschungsstelle „Hamburgs (post-)koloniales Erbe“ erarbeitet. Die zuständige Behörde redet sich die App mit ihren einschlägigen "Rundgängen" auch gegenüber dem Bürgerschaftsabgeordneten schön: "Die App bietet damit einen niedrigschwelligen Zugang zur Kolonialgeschichte und zeigt, welchen Beitrag die Geschichtswissenschaft für eine moderne Stadt leisten kann."
Die Touren basieren laut Angaben der Universität Hamburg auf dem wissenschaftlichen Sammelband „Hamburg: Deutschlands Tor zur kolonialen Welt“, den die Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank und der Kultursenator Dr. Carsten Brosda am 16. September 2022 in Berlin vorstellten. Dafür kassierten die Macher einen "Druckkostenzuschuss" von knapp 15.600,- €. Bis heute ist der Geschichts-Wälzer gerade einmal 1.350 mal über den Ladestisch gegangen - für stolze 32,- €.
Der AfD-Fraktionsvizechef und kulturpolitische Sprecher Alexander Wolf erklärte: „Die fleißigen Steuerzahler zahlen die Zeche für ein linkes Ideologieprojekt. Der Aufwand steht in keinem Verhältnis zu den Nutzerzahlen. Der Senat sitzt in seinem roten Elfenbeinturm und ist weit weg von der Lebenswirklichkeit der Bürger.“
Die Kolonialismus-App wurde im Apple App Store ganz fünf Mal bewertet - dafür aber mit jeweils auffäligen fünf Sternen, offenbar von profitierenden Mitarbeitern des Kolonialismus-Projekts der Hoschule. Die Fakten zur Geldverschwendung des links-grünen Vorzeigeprojekts gibt es in der Antwort der Wissenschaftsschaftbehörde. Weitere Informationen zur Kolonialismus-App der Uni Hamburg gibt es auf den Projektseiten. -
Links-woke Produktionsfirma von Radio Bremen erneut wegen politischer Manipulation in der Kritik.
 |
So brachte Bremedia die BpB in Schwierigkeiten.
(Screenshot: Tiktok) |
Bremen, 19.08.2024: Die öffentlich-rechtliche Fernseh-, Hörfunk- und Onlineproduktions-gesellschaft "Bremedia" hat fast 53.000,- € Steuergelder für die Produktion von insgesamt neun journalistisch angreifbaren und politisch z. T. linkslastigen Kurzvideos ("Reels") für die - in einem eigenen "Tiktok"-Kanal namens "Politik raus aus den Stadien" - im Auftrag der politisch neutral zu agierenden Bundeszentrale für politische Bildung kassiert. "Bremedia" ist einen 100%-Tochter von Radio Bremen und übernimmt für den Sender und externe Kunden wie die Bundeszentrale Medienformat-Entwicklung ("Ideen formen"), Produktion ("Geschichten realisieren"), und die Bremer "Tatort"-Produktionen.
Die Fakten zum politischen Missbrauch von Steuergeldern gehen aus einer Anfrage der AfD-Fraktion im Bundestag hervor, nachdem in dem Kurzvideo "2006 – ein Sommermärchen für den Nationalismus?“ die ersichtlich manipulative Reporterin die schwarz-rot-goldenen Fanmeilen der Fussball-WM in Deutschland aus dem Jahr 2006 mit den zehn Jahre später in Dresden populären "Pegida"-Demonstrationen im Namen der Bundeszentrale unreflektiert und damit vorsätzlich manipulativ verglich. Der Skandal wurde Anfang Juli d. J. von der konservativen Wochenzeitung "Junge Freiheit" ans Tageslicht gebracht.
Den Vergleich hatte die von "Bremedia" angeheuerte Jungmoderatorin allerdings auch nur aus zweiter Hand abgekupfert: Das Bundesinnenministerium erklärte in seiner Stellungnahme gegenüber den Abgeordneten der AfD im Bundestag kleinlaut: "In dem Video wurde die umstrittene These des Politikwissenschaftlers Clemens Heni aufgegriffen, „[o]hne 2006 wäre es nicht in diesem Ausmaß zu Pegida gekommen, und ohne Pegida gäbe es keine AfD in dieser Form.“ (Frankfurter Rundschau vom 4. September 2019 www.fr.de/kultur/sommermaerchen-bereite te-boden-11002689.html). Das Aufgreifen dieser These im Rahmen der von großer Freude, Gastfreundschaft, Vielfalt, Zusammenhalt und Sportsgeist geprägten EURO 2024 war ein Fehler."
Nutzer der Nachrichtenplattform "X" (vormals "Twitter") gingen mit dem Manipulationsversuch im Namen der Bundeszentrale BpB aus dem Haus "Bremedia" hart ins Gericht. Die "Junge Freiheit" zitiert: „Die WM 2006 schuld am Aufstieg von Pegida, AfD und Co. ist so ungefähr der dümmste Take, den ich in diesem Jahr überhaupt gehört habe“, hieß es in einem Kommentar. Ein anderer Nutzer spottete: „Ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, wie mich das Traumtor von Philipp Lahm im Eröffnungsspiel gegen Costa Rica radikalisiert hat!“
Nach erheblichen Protesten u. a. in sozialen Medien erklärte die Bundeszentrale für politische Bildung, das massiv kritisierte Video aus dem Netz zu nehmen. Um den Fall nicht weiter eskalieren zu lassen, wurden zudem auch die acht weiteren Videos und der gesamte Themen-Kanal zu Fussball und Politik auf "Tiktok" offiziell gelöscht. Die Bundeszentrale erklärte öffentlich zu der manipulativen Produktion von "Bremedia": "Das Video entspricht inhaltlich und in der Umsetzung nicht den Qualitätsansprüchen der Bundeszentrale für politische Bildung."
Die weiteren nun zur intensiven Prüfung stehenden Polit-Videos von "Bremedia" für die Bundeszentrale drehen sich u. a. um "Queerness" im Fußball nach dem Skandal um die von der "FIFA" auf Druck von Katar verbotene Regenbogen-Binde bei der Fussball-WM 2022, die gelebte Feindschaft zwischen Fussballclubs und ihren Lokal-Derbys sowie eine "feministische" Geschichte zur Entwicklung des Frauenfussballs in Deutschland und beim DFB.
Die Serie wurde für junge Leute zwischen 16 und 29 Jahren produziert, die ihre Informationen und Diskussionsgrundlagen nicht mehr bei "Tagesschau" oder "Heute Journal" konsumieren. Das Innenministerium erläuterte in seiner Antwort: "Durch die Verbindung von Fußball und Politik beziehungsweise einer politischen Perspektive auf sportliche Großereignisse sollte das Interesse für politische Themen gesteigert werden."
Das von der umstrittenen SPD-Politikerin Faeser geleitete Haus erklärte weiter: "Zum anderen sollte durch die Ausspielung des Formats in sozialen Medien und die Begleitung des Formats durch ein intensives Community Management im Rahmen des BpB-Kanals die Befähigung und Bereitschaft zur aktiven Beteiligung an Diskussionen gestärkt werden." Ob dies als Reaktion auf die zahlreichen Jungwähler für AfD und CDU bei den Europawahlen passierte, ist offen.
Die aufgrund ihrer Linkslastigkeit angreifbare Produktionsfirma "Bremedia" ist mit rd. 300 Mitarbeitern auch für die Internet-Auftritte aller Radio Bremen-Sender, einschließlich der Online-Ausgabe der bremischen Nachrichtensendung "Butten un Binnen" und des jungen Internet-Formats "Bremen Next" verantwortlich. Das Jugendformat war im April d. J. in die Schlagzeilen geraten, nachdem eine "Bremedia"-Reporterin in Zusammenarbeit mit dem gegen Israel hetzenden Verein "Muslim Empowerment Bremen“ eine Umfrage unter jungen Muslimen machte, Palästinener-Werbung am Reverse trug und die Umfrage für "Bremen Next" auf Instagram veröffentlichte. In dem eindeutig als Palästinenser-Propaganda erkennbaren Social-Media-Video (Wassermelone in Palästinenserfarben als Sympathiebekundung der "Bremedia"-Reporterin) musste Radio Bremen zurückrudern: „Diesen Hintergrundcheck hätte die Redaktion leisten sollen und es ist ein Versäumnis, es nicht getan zu haben. Inzwischen hat "Muslim Empowerment Bremen‘ diese (israelfeindlichen) Äußerungen bei ‚TikTok‘ bereits entfernt. Aktuell distanzieren sich die beteiligten Frauen auch in ihren Social-Media-Accounts deutlich von diesen Äußerungen.“
Die Bremer Produktionsfirma agiert mit ihren Reportern und Moderatoren offensichtlich generell im politisch links-woken Milieu, wie ihre eindeutigen Aussagen zur Förderung einer "LGBTQ"-Politik bestätigen. Damit ist offen, wann der nächste Ausfall von "Bremedia" und seiner redaktionellen Mitarbeiter Schlagzeilen macht und Kunden, wie die Bundeszentrale, und den Gesellschafter Radio Bremen in Bedrängnis bringen.
Die gesamte Geschichte zur Entgleisung von "Bremedia" im Auftrag der Bundeszentrale für politische Bildung kann in der "Jungen Freiheit" nachgelesen werden. Die Entschuldigung des Bundesinnenministeriums zur Entgleisung der "Bremedia"-Produktion für den Rechtsruck-Vorwurf der Fussball-WM 2006 in Deutschland gibt es hier. -
Digitale Gewalt in Deutschland vor allem gegen Jugendliche und junge Erwachsene.
Hamburg, 13.08.2024: Junge Erwachsene zwischen 18 und 27 Jahren sowie Arbeitnehmer zwischen 28 und 42 Jahren sind mit 29,6 % bzw. 26,2 % als Opfer von digitaler Gewalt in Deutschland auf häufigsten direkt betroffen. Mit 63,1 % beobachten junge Menschen zudem besonders oft digitale Ausfälle gegen andere, gefolgt von Jugendlichen zwischen 14 und 17 Jahren, die mit 54,5 % ebenfalls mehrheitlich digitale Gewaltw beobachten müssen. Das sind zentrale Ergebenisse eine Befragung von rd. 3.400 Jugendlichen und Erwachsenen im Oktober und November vergangenen Jahres.
Die Hilfsorganisation "HateAid" hat dabei jegliche Form von hasserfüllten Nachrichten, wie beleidigenden Kommentaren, Anfeindungen, massiven Shitstorms und sexualisierten Übergriffen abgefragt. Dabei erleben junge Erwachsene als Hauptbetroffenengruppe vor allem Beleidigungen im Internet, gefolgt von hasserfüllten Nachrichten und Herabsetzungen, Verbreitung von Lügen, Cybermobbing und Bedrohungen. Auch sexuelle Übergriffe gehören zu den häufigen Straftaten - u. a. in sozialen Netzwerken, wie "TikTok".
Die vornehmlich jungen Betroffenen reagieren direkt und pragmatisch, um sich aus der digitalen Gewaltspirale zu lösen: Im ersten und häufigsten Schritt werden die Täter geblockt, um ihre Nachrichten nicht weiter an den Mann oder die Frau bringen zu können. Nachrichten und Kommentare auf sozialen Netzwerken, wie "Facebook", "Instagram", "Tiktok" und "YouTube" werden zu 87 % auch gemeldet, allerdings leben die Social Networks von Aufregern, die Interesse wecken und Nutzer- wie Klickzahlen in die Höhe schnellen lassen.
Eine weiteres Mittel zur Gegenwehr ist das Erhöhen der Privatsphäreeinstellungen, um potenzielle Täter auszusperren. Interessant: Auch die Konfrontation mit dem sich digital anonym fühlenden Täter wird von vielen jungen Erwachsenen praktiziert. Allerdings unternehmen auch fast genauso viele einfach gar nichts. Erschreckend: Eine Mehrheit von über 60 % lässt sich von digitalen Angriffen einschüchtern, formuliert eigene Beiträge vorsichtiger oder postet weniger.
Das Hanse Digital Magazin HANSEVALLEY und Chefredakteur Thomas Keup wurden über zwei Tage selbst Opfer eines Shitstorms des Hamburger SPD-Funktionärs Nico Lumma auf Facebook, geliked von mehr als 160 vornehmlich Hamburger Facebook-Nutzern - einschließlich leitenden Mitarbeitern der Hamburger Medienbehörde, der Nachrichtenagentur DPA und den Gründerinnen des Hamburger Startupnetzwerks "Hamburg Startups".
Das Bundesamt für Justiz stellte als Aufsichtsbehörde für das Netzdurchleitungsgesetz in Deutschland fest: Lumma, bis heute umstrittener Startup-Förderer des "Next Media Acceleratos - NMA", hat sich mit seinen hasserfüllten Äußerungen selbst strafbar gemacht - ebenso wie seine vornehmlich SPD-nahen Beteiligten. Die ganze Geschichte ist im Hanse Digital Codex HANSECODEX nachzulesen. #WehretDenAnfängen -
Weil wir Hamburg sind: Tourismus-Boss schikaniert Mitarbeiter der städtischen Tourismus-Agentur.

Hamburg, 06.08.2024: Der Betreiber des offiziellen Städtereise-Portals "Hamburg Tourismus", der On- und Offline-Kampagne "Weil wir Hamburg sind" und der offiziellen Social-Media-Kanäle "Hamburg Ahoi" steht in der Kritik, seine Mitarbeiter mit psychischem Druck, persönlicher Ausgrenzung und offenem Misstrauen zu schikanieren. Laut Recherchen der Wochenzeitung "Die Zeit" ist der Geschäftsführer der stadteigenen Tourismus-Vermarktung "Hamburg Tourismus" - Michael Otremba - mit den schweren Vorwürfen von mind. acht aktuellen und früheren Mitarbeitern der städtischen Vermarktungsgesellschaft konfrontiert.
Das offensichtlich "katastrophale Arbeitsklima" ist durch mind. vier Anfragen des FDP-Bürgerschaftsabgeordneten Sami Musa an die Öffentlichkeit gekommen. Dabei stehen die für die Tourismus-Agentur verantwortlichen Politiker, SPD-Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard und ihr SPD-Staatsrat und Aufsichtsrat der Tourismus GmbH - Andreas Rieckhoff - direkt in der politischen Verantwortung. Laut FDP-Abgeordnetem sollen die beiden führenden SPD'ler bewusst wegsehen, was in der Tourismus GmbH passiert.
Erst Mitte Juni d. J. rief Staatsrat Rieckhoff eine außerordentliche Sitzung des Aufsichtsrates ein, um die schweren Vorwürfe gegen den Hamburger Tourismus-Chef zu diskutieren. Dabei sollte Otremba seinen umstrittenen Führungsstil erklären. Im Mittelpunkt stand u. a. ein Workshop in den Diensträumen an der Wexsstraße mit rd. 12 Mitarbeitern der Congress-Organisation HCB. Mitarbeiter fühlten sich dabei durch herabwürdigende Äußerungen Otremba's persönlich angegriffen und gedemütigt. Brisant: Otremba soll trotz weinender Kollegen weiter verbal Mitarbeiter angegriffen haben.
Die "toxische Kultur" in der offiziellen Tourismus-Gesellschaft wird von einigen Mitarbeitern als "Klima der Angst" zugespitzt. Mitarbeitern würden plötzlich und unerwartet Aufgaben entzogen werden. Otremba soll Mitarbeiter außerdem im Homeoffice mit Kontrollanrufen überwacht haben. In dem städtischen Unternehmen herrsche aufgrund des Geschäftsführers ein häufiger Personalwechsel. Das städtische Unternehmen fungiert als Tourismus-Agentur mit insgesamt rd. 100 Mitarbeitern.
Der gebürtige Marketing-Mann aus Eckernförde bestreitet die von der "Zeit" nach den Abgeordneten-Anfragen veröffentlichten Missstände in dem städtischen Unternehmen. Er sieht sich als Opfer einer Kampagne gegen ihn. Eine Reihe der betroffenen Mitarbeiter haben ihrerseits eidesstattliche Erklärungen abgegeben, und damit ihre Kritik einer gerichtlichen Beurteilung unterworfen. Statt auf die Kritik einzugehen, spricht Otremba gegenüber der "Zeit" von "Change-Prozessen" in der GmbH.
Auf Linkedin schreibt er im Zusammenhang mit seinem Arbeitsstil von "Leadership Excellence", verkauft sich selbst als "CEO" und "Speaker" mit vermeintlichem Wissen und Können zu "digitalen Strategien". Der Senat spielt seinerseits "toter Käfer": Der Fall sei der zuständigen Wirtschaftsbehörde nicht bekannt, aber wenn es Hinweise auf Schikane und Mobbing geben sollte, würden diese sehr ernst genommen, erklärte die SPD-Behörde gegenüber dem Abgeordneten Musa. Betroffene Mitarbeiter hatten sich direkt an den Volksvertreter gewandt, um Hilfe zu bekommen.
Die Pressestelle der Tourismus-Agentur präsentierte als direkte Reaktion eine Mitarbeiterbefragung eines vermeintlich "unabhängigen Instituts". Danach soll die Belegschaft mit dem Betriebsklima mit einer Note "gut" zufrieden sein. Für den verantwortlichen Geschäftsführer und direkt Vorgesetzten gab es eine - wie im Sozialismus vergleichbare - Bestnote von 1,0. Eine frühere Assistentin von Otremba berichtete hingegen von einem rüden Rausschmiss mit gesperrtem E-Mail-Account und IT-Zugang. Die Mitarbeiterin war 20 Jahre bei "Hamburg Tourismus", bis der in der Kritik stehende Geschäftsführer sie vor die Tür setzte.
Gegenüber der "Zeit" nahm die SPD-Wirtschaftsbehörde den aufgrund seines offensichtlich arbeitnehmerfeindlichen Verhaltens angeschlagenen Tourismus-Geschäftsführer symbolisch in Schutz: "Es ist dem Aufsichtsrat ein Anliegen, der Geschäftsführung das Vertrauen auszusprechen." Der Vertrag mit Otremba läuft offiziell noch bis 2027. Ob der ersichtlich rüde auftretende Tourismus-Boss mit seinem Verhalten Hamburg zu einer europaweit führenden Kongress-Metropole - vergleichbar mit Barcelona - machen kann, darf bezweifelt werden.
Die 2002 gegründete und in die Schlagzeilen geratene Tourismus-Agentur verzeichnete im vergangenen Jahr offiziell 15,9 Mio. Übernachtungen. Dafür erhielt das Unternehmen unter dem umstrittenen 53-jährigen Geschäftsführer im Jahr 2022 einen Etat vom rot-grünen Senat der Hansestadt i. H. v. 12,9 Mio. €. Rd. 100 Mitarbeiter sollen touristische Übernachtungen mit Vermarktungsangeboten fördern sowie Kongresse in die Stadt holen. "Hamburg Tourismus" ist als landeseigenes Unternehmen der SPD-Wirtschaftsbehörde von SPD-Chefin Melanie Leonhard unterstellt.
-
Datenschützer werfen Hamburger Datenschutzbehörde Pfeffersack-Machenschaften zu Lasten von Spiegel Online-Lesern vor.
 |
Der Spiegel zwingt Leser derzeit zu personalisierter Werbung oder Zwangsabo.
(Grafik: Noyb) |
Hamburg, 05.08.2024: Erneut gibt es handfesten Ärger um die Bevorzugung Hamburger Organisationen durch die Senatsbehörden der rot-grün regierten Hansestadt: Am Donnerstag vergangener Woche (25.06.2024) hat die Datenschutzorganisation Noyb den Hamburgischen Datenschutzbeauftragten vor dem Verwaltungsgericht verklagt. Laut Noyb ist die Datenschutzbehörde für den "Spiegel" als Anwalt und Richter einseitig tätig geworden. Und dies mit einer unrechtmäßigen Rechtsberatung für 6.140,- € Verwaltungsgebühren.
Noyb wurde in einem Beschwerdeverfahren gegen den "Spiegel" weder persönlich angehört noch wurden die Schreiben der Organisation beantwortet. Eine Kommunikationspolitik, die auch die Redaktion von HANSEVALLEY als nicht-hamburgisches Unternehmen aus eigenem Erleben kennenlernen musste. Gegenüber Hamburger Unternehmen stehen die Datenschützer hingegen in Kaffeeterminen offenbar beratend hilfreich zur Seite. Unabhängige Entscheidungen sind damit praktisch nicht möglich.
Noyb – das Europäische Zentrum für digitale Rechte - mit Sitz in Wien hatte den für "Spiegel" in Hamburg zuständigen Datenschutzbeauftragten 2021 wegen des zweifelhaften Banners zur zwangsweisen Einwilligung in Cookies oder alternativ dem Abschluss eines kostenpflichten Online-Abos ("Pay or OK") angerufen. Für die Datenschützer war und ist dies ein klarer Verstoß gegen die DSG-VO und damit den Datenschutz von Verbrauchern. Deshalb gibt es jetzt die juristische Klärung gegen die umstrittene, Pfeffersack-freundliche Entscheidung der SPD-geführten Behörde.
Max Schrems, Vorstandsvorsitzender von Noyb, erklärte anlässlich der Klage: “Der Einsatz von ’‘Pay or OK’ zieht eine Einwilligungsrate von 99,9 % nach sich. Eine so hohe Fake-Zustimmung hat nicht mal die DDR zusammengebracht. Von einer freiwilligen Einwilligung kann hier keine Rede sein. Es scheint nur, als wolle die Hamburger Behörde von solchen Zahlen nichts wissen.”
Die Europäische Kommission hatte bereits am 1. Juli d. J. die "Facebook"-Mutter "Meta" abgemahnt, mit "Pay or OK" gegen den europäischen Digital Markets Act zu verstoßen. Im Falle von Zuwiderhandlungen drohen "Meta" bis zu zehn Prozent auf den Jahresumsatz als Strafe. 2023 hatte der "Meta"-Konzern weltweit umgerechnet gut 125 Mrd. € Umsatz erzielt.
Der europäische Datenschutz-Ausschuss EDSA hatte im März d. J. festgestellt, dass "Pay-or-Consent"-Modelle, wie beim "Spiegel" oder bei "Facebook", auf großen Online-Plattformen nicht rechtmäßig sind.
Bei "Pay or OK" haben die Nutzer weder die Möglichkeit, Werbung zuzulassen, die weniger personalisierte Daten verwenden, noch können sie frei über die Nutzung ihrer personenbezogenen Daten bestimmen, so die europäischen Wettbewerbshüter. Auf dieser Grundlage geht nun die EU-Kommission gegen "Meta", aber auch gegen "Apple" vor.
„Damit es eine freie Wahl für den Nutzer und eine gültige Wahl für den Nutzer gibt […], muss der Verbraucher in der Lage sein, eine alternative Version des Dienstes zu wählen, die auf nicht personalisierter Werbung basiert“, erklärte ein EU-Beamter in einem Briefing Ende Juni d. J. die wegweisende Entscheidung für Nutzer von "Facebook" und gegen die Werbepolitik von "Meta".
Die endgültige Entscheidung im "Meta"-Fall wird im März kommenden Jahres getroffen. Noyb erwartet aufgrund der neuen europäischen Datenschutz-Politik eine Korrektur der einseitigen Entscheidung der regionalen Datenschutzbehörde zugunsten eines Hamburger Verlagshauses.
Eine weitergehende Pressemitteilung der Datenschutzorganisation ist auf den Seiten von Noyb nachzulesen. Ein ausführlicher Beitrag zum Thema ist u. a. im Magazin "Euraktiv" zu finden. -
Otto-Konzern-Schmuddelkind EOS-Inkasso will von Unschuldigen Telekom-Schulden eintreiben.
 |
EOS-Zentrale in Hamburg: Außen "hui", innen manchmal ganz schön "schmuddelig".
Foto. HANSEVALLEY |
Hannover/Hamburg, 02.08.2024: Der umstrittene und bereits mehrfach in die Kritik geratene Geldeintreiber des finanziell in Schieflage befindlichen "Otto-Konzerns" - der Hamburger Inkassodienst "EOS" - ist erneut negativ in den Schlagzeilen: Die Verbraucherzentrale Niedersachsen erreichen aktuell Anfragen zu einem Inkassoschreiben von "EOS Deutscher Inkasso-Dienst".
Die Hilfesuchenden sollen laut der Mahnungen endlich ausstehende Forderungen der "Telekom Deutschland " zahlen. Es geht um Summen von bis zu 4.500,- €. Dabei wird auf ein rechtskräftiges Urteil verwiesen. Das Problem: Das Aktenzeichen fehlt, Betroffene können die Forderungen nicht zuordnen. Nicht ausgeschlossen, dass "EOS" unrechtmäßig Geld eintreiben will, dass ihnen gar nicht zusteht.
„In dieser Sache haben wir Sie längere Zeit nicht angeschrieben. Haben sich Ihre finanziellen Verhältnisse in der Zwischenzeit erholt, dass Sie jetzt in der Lage sind, diese Forderung zu zahlen?“, heißt es in dem vermeintlich freundlichen Anschreiben der professionellen Geldeintreiber aus Hamburg St. Georg.
„Ratsuchende sind über diese Formulierung irritiert, da ihnen der Inkassodienst gänzlich unbekannt ist“, erklärt Kathrin Bartsch, Rechtsexpertin der Verbraucherzentrale Niedersachsen. Auch die angeblich ausstehende Forderung der "Deutschen Telekom" können sie nicht einordnen.
Inklusive Verzugszinsen und Vollstreckungskosten geht es in den vorliegenden Fällen um fragwürdige Summen von rund 500,- € bis 4.500,- €, die die "Otto-Versandhaus"-Tochter kassieren will. „Unserer Einschätzung nach ist das Schreiben echt. Merkwürdig ist jedoch, dass ein rechtskräftiges Urteil erwähnt wird, das Aktenzeichen in dem Vordruck aber nicht eingetragen ist“, sagt Bartsch. Damit lasse sich der Vorgang nicht nachvollziehen.
Betroffene sollten das schriftlich geforderte Lastschriftmandat nicht unterschreiben, sondern "EOS" zunächst schriftlich auffordern, das Aktenzeichen des Urteils zu nennen und eine Kopie des rechtskräftigen Titels zu übermitteln, rät die Verbraucherschützerin. Am besten werde dafür ein Einschreiben geschickt und eine Frist von zwei Wochen gesetzt.
Zudem sei es sinnvoll, bei Auskunfteien eine kostenlose Datenkopie anzufordern. „So lässt sich klären, ob tatsächlich ein Urteil eingetragen ist“, erklärt die Rechtsexpertin. Weitere Informationen und die Adressen der Auskunfteien unter
"EOS" war zuletzt im Juni vergangenen Jahres in die Schlagzeilen geraten: Der Inkasso-Dienst wollte vor dem Bundesgerichtshof durchsetzen, entgegen einer aktuellen Entscheidung des Hanseatischen Oberlandesgerichts weiterhin zusätzliche Gebühren von säumigen Schuldnern kassieren zu dürfen. Dabei geht es um Forderungen der "EOS Investment GmbH", die als sogenanntes "Konzerninkasso" durch die Schwester "EOS Deutscher Inkasso-Dienst" eingetrieben werden.
Neben 15 "Otto-Versandhaus"-Fällen hatten sich weitere 680 Verbraucher für eine Musterfeststellungsklage beim Bundesamt für Justiz in die Klageliste eintragen lassen, da die mehrfach erhobenen Gebühren bei verschiedenen Inkasso-Diensten gang und gäbe sind. Der Konzern-Geschäftsbericht der "Otto Group" bezeichnete den Ausgang der Klage selbst als "erhebliches Geschäftsrisiko".
Die in Hamburg beheimate "EOS-Gruppe" ist ein Inkasso-Dienstleister mit mehreren Tochtergesellschaften. "EOS" gehört vollständig zum Hamburger Handelskonzern "Otto Group". Im Geschäftsjahr 2023/2024 erwirtschaftete "EOS" einen Umsatz von mehr als 1 Mrd. €. Die Tochtergesellschaften aus St. Georg bringen fast 7 % des Umsatzes des "Otto-Konzerns" ein und sind im Familienkonglomerat die "goldene Kuh".
"EOS" treibt Schulden der Versandhaus-Kunden von "Otto", "Baur" & Co. ein. Außerdem kauft "EOS" Forderungen von Kreditkarten-Gesellschaften wie "Barclaycard" und Mobilfunk-Schulden u. a. der "Deutschen Telekom" auf. Zudem übernimmt "EOS" faule Immobilien zum Ausschlachten. Im Geschäftsjahr 2023/2024 kaufte die "EOS-Gruppe" faule Kredite über 615 Mio. € auf, im Jahr zuvor sogar über 1,1 Mrd. €.
Seit Jahren verdient "EOS" bei säumigen Schuldnern das Geld, das anschließend in der teuren Handelssparte versenkt wird, bewertet die Tageszeitung "Welt" das Geschäft der Hamburger. Während der Familienkonzern sich offiziell als sozial und fortschrittlich darstellt, verdient er einen beachtlichen Teil seiner Gewinne durch das Eintreiben von Schulden u. a. seiner E-Commerce-Kunden.
Ohne die Inkasso-Sparte würde die "Otto Group" mit ihren E-Commerce-Shops und der Logistik-Sparte "Hermes" finanziell noch schwächer dastehen.
-
Hamburger Nachrichtenagentur DPA stellt mit Steuer-Millionen der Bundesregierung ihre Unabhängigkeit in Frage.
 |
Geschäftsführer und Chedredakteur der DPA haben mit den Steuermillionen gut lachen.
Michael Kappeler |
Berlin/Hamburg, 03.07.2024: Die Bundesregierung hat seit 2021 über eine Million Euro Steuergelder an die in Hamburg ansässige Deutsche Presse-Agentur vergeben. Bis März 2025 sollen weitere 240.000,- € dazu kommen. Das Geld der politisch linken Scholz-Regierung fließt in verschiedene Projekte, darunter ein Schulungsprogramm zu Künstlicher Intelligenz und eine Machbarkeitsstudie für einen internationalen „Democracy Newsroom“.
Der schleswig-holsteinische FDP-Bundestagsabgeordnete Wolfgang Kubicki kritisiert die von der "Bild"-Zeitung aufgedeckten Zahlungen als rechtlich bedenklich und sieht darin eine mögliche Wettbewerbsverzerrung. Die Bundesregierung verteidigt die Förderungen und betont, dass keine journalistischen Inhalte beeinflusst würden.
„Ich halte eine staatliche Projektförderung für eine private Nachrichtenagentur, die mit anderen in Konkurrenz steht, mindestens für rechtlich erklärungsbedürftig. Eigentlich dürfte eine solche singuläre finanzielle Unterstützung an verfassungsrechtliche Grenzen stoßen, da die Gefahr besteht, dass die Bundesregierung zugunsten eines Unternehmens die Gleichbehandlung im publizistischen Wettbewerb unterläuft“, sagte Wolfgang Kubicki.
Die wegen antisemitischer Ausfälle bei Veranstaltungen in der Kritik stehenden Medienbeauftragte der Bundesregierung, Claudia Roth, ließ mitteilen, dass die "DPA" lediglich Projektträger sei und die Unabhängigkeit der Presse gewahrt bleibe. Eine Prüfung nach Artikel 107 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union stelle sicher, dass der Wettbewerb nicht verfälscht werde.
Weitere Projekte in Zusammenarbeit mit der "DPA" umfassen Maßnahmen gegen vermeintliche "Desinformation, Fakes und Manipulation" - unterstützt vom Bundesinnenministerium, mit einer Fördersumme von bis zu einer Million Euro im „Jahr der Nachricht“.
Damit steht die als Genossenschaft von gut 170 Verlagshäusern und Rundfunksendern in der Kritik, nicht mehr unabhängig berichten zu können oder zu wollen. Nötig hat die "DPA" die staatlichen Fördergelder nicht: Der Konzernumsatz der Gruppe stieg trotz eines schwierigen Umfeldes des Medienmarktes auf 165,9 Mio. €. Mit 104,3 Mio. € gelang auch der Kerngesellschaft "DPA GmbH" mit dem eigentlichen Nachrichtengeschaft ein Umsatzwachstum.
Die "DPA" ist ein Quasi-Monopolist als deutsche Nachrichtenagentur. Sie gilt vor allem in der politischen Berichterstattung auf Bundes- und Länderebene als tonangebend. Die Redaktionen der rd. 170 Gesellschafter beziehen über Nachrichtenticker, Landes- und Themendienste, Audiobeiträge sowie einen umfassenden Fotodienst einen Großteil des Rohmaterials für ihre laufende Berichterstattung.
Die Agentur stellt ihren Kunden auch fertige und anpassbare Online-Ticker bereit, ohne dass Zeitungen oder Online-Medien selbst recherchieren oder auswählen müssen. Die Nachrichtenagentur wurde vor 75 Jahren gegründet, hat ihren Firmensitz in Hamburg und arbeitet mit einem zentralen Newsroom in der Axel-Springer-Passage in Berlin. (Foto: Michael Kappeler)
Diese Nachricht wurde mit Unterstützung von ChatGPT 4o geschrieben und durch einen Nachrichtenredakteur redigiert und veröffentlicht.
-
Commerzbank und Sparkassen haben Wechsel von Konto und Karten auf neues iPhone nicht im Griff.
 |
Außen "hui", innen "pfui": Die Coba hat ihren Apple Pay-Service nicht im Griff.
(Foto: Julia Schwager) |
Berlin/Frankfurt, 28.06.2024: Deutsche Banken und Sparkassen haben den Wechsel ihrer Banking-Apps und in Apple Pay bereitgestellter Kreditkarten von einem iPhone auf ein neues iPhone nicht im Griff. Das hat ein HANSEVALLEY-Redakteur mit der Commerzbank und der Berliner Landesbank/Berliner Sparkasse hautnah negativ erleben müssen.
Bei der Frankfurter Commerzbank konnte die bereits bestehende virtuelle Debit-Karte trotz aufwendiger, bürokratischer Re-Aktivierung von Banking-App und PushTAN-App nicht im neuen Apple Wallet aktiviert werden. Drei Telefon-Gespräche mit Kundendienst und technischem Support über insg. rd. 45 Minuten brachten trotz Abgleich aller Möglichkeiten keine Lösung.
Eine Eskalation des Themas beim Beschwerdemanagement förderte zutage, dass der Fall mind. sieben Tage Bearbeitungszeit bedeutet. Eine kritische Nachfrage bei der Nachwuchs-PR-Mitarbeiterin für "Digital Banking" der "Coba" erbrachte als Antwort, die notwendigen Schritte in der Anleitung auf der Homepage verbessern zu wollen. Von Problemlösung auch hier keine Spur.
Der Commerzbank ist die Reduzierung Ihres Personalstamms in Kundendienst und Technik im Interesse "hervorragender" Geschäftsergebnisse sowie Hochglanzfotos mit dem französischen Wahl-Verlierer Emmanuel Macron offensichtlich wichtiger, als überalterte und unausgereifte Geschäftsabläufe im Interesse ihrer Kunden in Ordnung zu bringen.
Bei der Berliner Sparkasse ist die Reaktivierung der S-TAN-App ohne Unterstützung des Kundendienstes unmöglich. Hier ist - wie bei der Commerzbank - die alte Installation der TAN-App auf dem bisherigen Gerät zwingend erforderlich, um wieder das Online-Banking nutzen und die Kreditkarte der Sparkasse in Apple Pay zu reaktivieren. Alternativ muss sich der Kunde bei der S-Finanzgruppe für die TAN-App per Post einen neuen QR-Code zuschicken lassen.
Bei beiden deutschen Geldinstituten ist der persönliche Support rund um die Uhr - und damit auch Abends und an den Wochenenden - möglich. Während die Supporterinnen der Commerzbank grundsätzlich freundlich, professionell und hilfsbereit waren, pöbelte der Sparkassen-Supporter bei der Bitte um interne Eskalation zur Verbesserung der schriftlichen Hinweise offen rum: "Dafür bin ich nicht zuständig. Dafür ist meine Gehaltsklasse zu gering."
Bei Commerzbank und Sparkasse sind die Schritte zur Reaktivierung von Banking- und TAN-App sowie vorhandener Kreditkarten kompliziert, verschachtelt und für den Normalverbraucher nicht nachvollziehbar. Dies reicht bei der Commerzbank bis zu technischem Versagen bei der Reaktivierung der virtuellen Debit-Karte. Dagegen sind internationale Online-, Mobile- und Challenger-Banken wesentlich kundenfreundlicher.
Der Redakteur reaktivierte Banking-Apps von ING aus den Niederlanden, Openbank/Santander aus Spanien und Revolut aus Litauen/Großbritannien innerhalb weniger Minuten mithilfe bestehender Logindaten, Secure-Codes per SMS und einem Foto-Ident. Damit haben sich ausschließlich internationale Banken auf die junge Zielgruppe der Generation Z eingestellt.
Bis zur Veröffentlichung der HANSENEWS schaffte es die Commerzbank trotz Eskalation über das Beschwerdemanagement und interner Beschwerde über die Pressestelle nicht, das bestehende Problem mit ihren virtuellen Debit-Karten in Apple Pay zu lösen. HANSEVALLEY rät nach der weitreichenden Erfahrung mit der Re-Aktivierung von Banking- und TAN-Apps sowie bestehender Karten in Apple Pay von der Nutzung von Commerzbank- und Sparkassen-Konten und -Karten dringend ab.
Ein weitgehend reibungsloser Wechsel von Apps für Konto und Karten von einem iPhone auf ein neues iPhone ist nach Erfahrungen der Redaktion nur bei internationalen Online- und Direktbanken mit einfacheren Sicherheitsprozessen möglich. Ein Test mit der Berliner Challengerbank "N26" lehnt HANSEVALLEY ab, da die Bank für ein kundenfeindliches Verhalten im Kontext zahlreicher Betrugsfälle und fehlender Mitwirkung bei der Klärung bekannt ist.
-
Startup-Standort Hamburg bei Unicorns und Fintechs weit abgeschlagen.
 |
Bei milliardenschweren Einhörnern ist Hamburg abgeschlagen.
Grafik: Statista |
Hamburg, 25.06.2024: Die Freie und Hansestadt an der Elbe ist weder ein führender Startup-Standort mit einem Unicorn, noch erfolgreich beim Aufbau und der Skalierung von Fintech-Geschäftsmodellen, wie z. B. Neobanken oder Smartphone-Brokern. Das belegen aktuell veröffentlichte Statistiken des Hamburger Datenportals "Statista" auf Grundlage von Erhebungen sowohl von "Statista Consumer Insights" als auch durch "CB Insights".
So ist die auf einem nach wie vor schwachen dritten Platz im bundesdeutschen Vergleich u. a. mit Berlin und München abgeschlagene Hansestadt mit keinem einzigen Scaleup mit Milliarden-Bewertung unter den Top Ten zu finden. Die Auswertung von "CB Insights" mit Stand März 2024 zeigt die Startup-Hauptstadt Berlin mit vier Scaleups im Ranking vorn - angeführt vom bundesweiten Einhorn Nr. 2, der Neobank "N26" mit einem Börsenwert von rd. 9,2 Mrd. €.
Daneben entwickelt sich auch die Technologie-Hauptstadt München in Sachen Unicorns äußerst erfolgreich. Die bayerische Landeshauptstadt kommt allein auf drei milliardenschwere Einhörner, angeführt vom Software-Unternehmen für Prozess-Entwicklung "Celonis" mit einer Bewertung von 13,0 Mrd. €. Bekanntestes Einhorn aus München ist das an Platz Nr. 7 gerankte Mobilitätsunternehmen "Flix SE" mit "FlixBus", "FlixTrain" und dem US-Ableger "Grayhound".
Ein Millionen-Euro teures Startup-Portal der Hamburger Wirtschaftsbehörde ohne Fokussierung, ein vermeintliches Investoren-Netzwerk, dass sich nur um Frauen kümmert und eine von Wirtschafts- und Wissenschaftsbehörde seit Jahren subventionierte, erfolglose Hochschul-Gründer-Initiative aus Harburg - trotz Millionen-schwerer Ausgaben des rot-grünen Hamburger Senats in hochgejubelte Vorzeigeprojekte bekannter Subventionsgänger lag die Freie und Hansestadt auch im vergangenen Jahr in maßgeblichen Indikatoren weit abgeschlagen hinter den führenden Startup- und Technologiemetropolen Berlin und München.
 |
Fintech bieten auch 2024 große Chancen - nur nicht in Hamburg.
Grafik: Statista |
Die ehemals starke Nr. 2 unter den deutschen Finanzplätzen ist auch bei neuen, skalierbaren Fintech-Geschäftsmodellen weit abgeschlagen. So übernimmt im "Statista"-Ranking unter 17 ausgewerteten Fintechs erneut die Berliner Challenger-Bank "N26" mit einem Bekanntheitsgrad von 41 % unter der deutschen Bevölkerung die Führung, gefolgt vom zypriotischen Krypto-Anlage-Portal "eToro" (31 % Bekanntheit), der Berliner Kapitalanlage-App "Trade Republic" (31 % Bekanntheit), der litauisch-britischen Neobank "Revolut" mit 30 % Bekanntheit und der erst vor Kurzem gestarteten Münchener Online-Bank "C24" des Preisvergleichs-Portals "Check24" (24 % Bekanntheit). Die hoch gejubelte Hamburger und wegen zweifelhafter Werbeaussagen kritisierte Öko-Bank "Tomorrow" kommt auf gerade einmal 16 % Bekanntheit.
Die Finanzbehörde der Freien und Hansestadt und der Branchenverein "Finanzplatz Hamburg" bei der Handelskammer haben in einer Mitteilung jüngst den Fintech-Standort mit mehr als 100 Unternehmen an Alster und Elbe angegeben. Als Grund für die vermeintlich positive Entwicklung wird u. a. das seit 2022 laufende, städtische Förderprogramm "InnoFinTech" der staatlichen Förderbank "IFB" ins Feld geführt. 20 der gelisteten "Fintechs" hätten Geld aus dem öffentlichen Fördertopf bekommen.
Tatsächlich hat der Finanzplatz an der Elbe in den vergangenen Jahren massiv an Bedeutung verloren, da Banken in erhebliche Schieflage geraten sind (z. B. "HSH Nordbank"/"HCB", "M. M. Warburg", "Varengold") oder Startups fusionierten oder vom Markt verschwanden (z. B. "Deposit Solutions"/"Raisin"). Laut HANSEVALLEY-Rhein/Main-Korrespondentin wird der "Finanzplatz Hamburg" am Bankenstandort Frankfurt praktisch nicht wahrgenommen.
Die Listung des sogenannten "Fintech-Monitors" führt mit Stand März 2024 auch Firmen auf, die in anderen Städten beheimatet sind, außerhalb Hamburgs entwickeln und vermarkten, den größten Teil ihres Geschäfts außerhalb Hamburgs erzielen oder zu etablierten, teils Finanz-fernen Branchen gehören.
Die veröffentlichten Ergebnisse des "Deutschen Startup Monitors 2023" zur Entwicklung der Startup-Szene an Alster und Elbe zeigen: Die scharfe Kritik der jährlich befragten Gründer sorgt in der verantwortlichen Politik von Wirtschafts-, Wissenschafts- und Medienbehörde für keinerlei Veränderungen: So sagen 55 % der Vertreter von 120 in Hamburg befragten Startups, dass Sie das nächste Mal nicht mehr in Hamburg gründen wollen. Dabei ist für 95 % eine weitere, neue Gründung sehr wohl ein Thema.
Nur noch 21 % der Entrepreneure in der Hansestadt sind mit der Kapitalbeschaffung zufrieden, bundesweit sind es bereits schwache 33 %. Damit ist die Unzufriedenheit in Bezug auf Finanzierungsmöglichkeiten noch einmal um vier Prozentpunkte gestiegen. Heißt im Umkehrschluss: Vier von fünf Startups bzw. 219 von 278 Gründer kritisieren 2023 die Finanzierungssituation rund um die Alster als schwach oder inakzeptabel. Die verantwortliche Förderbank feiert mit ihrem "Investoren-Netzwerk" währenddessen Frauen-Förder-Gipfel auf Instagram.
Das erste und bislang einzige Hamburger Startup mit einer milliardenschweren Bewertung war die "Otto"-Konzern-Gründung "About You" im Rahmen der Beteiligung durch den dänischen Bekleidungsunternehmer Anders Holch Povlsen. Der Gründer und Hauptgesellschafter der "Heartland"-Gruppe - zu der über "Bestseller" u. a. die Modemarken "Jack & Jones" und "Vera Moda" gehören - beteiligte sich mittels Kapitalerhöhung i. H. v. insgesamt 300 Mio. € mit knapp 20 % an der heutigen "About You SE". Vier Jahre nach dem Börsengang wird "About You" an der Börse nur noch als "Pennystock" mit Kursen um 3,30 € pro Aktie gehandelt.
Ursprünglich war das erste und einzige erfolgreiche Scaleup aus Hamburg der Vorgänger des Business-Netzwerks "Xing", das im Jahr 2003 gegründete "Open BC". Die Idee des Gründers Lars Hinrichs war es, das Modell der in Hamburg äußerst präsenten Business-Clubs ins Internet zu bringen. Nach drei Jahren wurde "Open BC" 2006 in "Xing" umbenannt. Heute ist die Holding "New Work SE" das Dach von "Xing". Im vergangenen Jahr erzielte das Marketing-Unternehmen mit gut 22 Mio. Mitgliedern in der DACH-Region einen Konzernumsatz von rd. 306 Mio. € und konnte einen Gewinn von rd. 37 Mio. € ausweisen.
-
Otto-Tochter About You hübscht Bilanz auf und macht mit Bekleidung weiter rote Zahlen.
 |
Der About You-Vorstand: Selbstdarstellung: groß. Rechenkünste: eher gering.
Foto: About You |
Hamburg, 25.06.2024: Der Hamburger Bekleidungshändler "About You" des wankenden Handelskonzerns "Otto" und des umstrittenen Hamburger E-Commerce-Experten Tarek Müller hat im vergangenen Geschäftsjahr mit dem Verkauf vornehmlich junger Bekleidung weiterhin rote Zahlen geschrieben. Das geht aus einer Bilanzanalyse des Wirtschaftsmagazins "Wirtschaftswoche" hervor. Der erstmals positiv ausgewiesene Cashflow i. H. 3,2 Mio. €, verglichen mit einem Minus von 137 Mio. € im Vorjahreszeitrum, konnte nur testiert werden, weil "About You" legal an seiner Bilanz drehte.
Die Verbesserung ist zum Teil auf die Aktivierung von Entwicklungskosten für die firmeneigene E-Commerce-Software "Scayle" zurückzuführen, die als Investitionen gelten und mit 35 Mio. € als Vermögenswert des Unternehmens auf der Habenseite gebucht werden durften. Dabei hat die mittlerweile als eigenständige GmbH von "Scayle" der übergeordneten Aktiengesellschaft "About You SE" im vergangenen Jahr ohnehin bereits 118,9 Mio. € Umsatz gebracht - und damit 9,7 % des Gesamtumsatzes.
Der Konzern-Umsatz inkl. "Scayle"-Millionen stieg insgesamt auch nur leicht auf 1,935 Mrd. €. Außerdem blieb der Umsatz in der wichtigen DACH-Region offiziell nahezu unverändert bei 916,7 Mio. €. Somit stagniert bei "About You" das Inlandsgeschäft aufgrund der Inflation mittlerweile im zweiten Jahr. Zieht man beim Umsatz sowohl die aktivieren 35 Mio. € Vermögenswerte für die Entwicklung und Nutzung der Shopping-Software "Scayle" als auch deren Umsätze bei Fremdkunden ab, wäre "About You" weiter tief in den roten Zahlen.
Das die "About You"-Zahlen rettende Shop-System mit externen Nutzern, wie "Baby-Walz", "Babymarkt", "Deichmann", "Depot", "Fielmann", "Marc O' Polo", "Mister Spex" und "S. Oliver" besteht im Kern aus einem Shop-, Order- und Produkt-Management, Checkout-Services sowie diversen Marketing-Tools. Im vergangenen Jahr expandierte "Scayle" vor allem in die Benelux-Länder, nach UK und in die Nordics. In diesem Jahr soll die Shopping-Plattform nach Nord-Amerika gebracht werden.
"About You", gegründet vor zehn Jahren und von der "Otto"-Handelsgruppe hochgezogen, hat nach dem Börsengang im Juni 2021 einen steilen Abstieg des Aktienkurses um rd. 85 % erlebt. Trotz des hohen Eigenkapitals nach dem Börsengang sind die Rücklagen aufgrund anhaltender Verluste stark geschrumpft. Ende Februar '22 betrug das Eigenkapital noch rund 583 Mio. €, während es Ende Februar '24 nur noch etwa 267 Mio. € betrug. Die kurzfristig verfügbaren Finanzmittel fielen im selben Zeitraum von 496 Mio. € auf 164 Mio. €.
Damit hat "About You" in den vergangenen gut 2,5 Jahren als europäische Aktiengesellschaft "SE" mit einem aktuellen Kurs als "Pennystock" i. H. v. rd. 3,30 € (Stand: 23.06.24) mehr als 45 % seines Eigenkapitals aufgrund der roten Zahlen verbraucht. Ebenso dramatisch sieht es bei den kurzfristigen Finanzmitteln aus: Hier verbrannten die Hamburger 33 % der Mittel vor allem wegen der jährlich gemachten Schulden.
Das Tarek Müller & Co. kein glückliches Händchen im skalierbaren E-Commerce haben, zeigen auch die Beteiligung an Vermarktungsgesellschaften mit Model Lena Gerke und Modemacher Guido Maria Kretschmer: Nach der Analyse der "Wiwo"-Redaktion verbrannten die Gemeinschaftsunternehmen allein im vergangenen Jahr 23 Mio. €, die als Kredite in den Büchern stehen. Allein die Firma von Lena Gerke machte in den vergangenen zwei Jahren rd. 27 Mio. € Miese. Nicht besser sieht es bei Guido Maria Kretschmer aus: Er verbrannte in den vergangenen zwei Jahren 13 Mio. € - bei lediglich 7 Mio. € Umsatz.
Zudem hat "About You" ein Kreditfinanzierungsproblem: Die Darlehen der beiden jungen Mode-Beteiligungen mit Laufzeiten von bis zu 11 Jahren sind mit lediglich 5 % Zinsen angesetzt. Die Großaktionäre haben dem Modelabel selbst eine Kreditlinie von 100 Mio. € bereitgestellt - allerdings zu Risiko-Zinsen i. H. v. 12 %. Bislang haben die Modeverkäufer die Kreditlinie noch nicht in Anspruch genommen. Die Frage bleibt, wann das Eigenkapital so weit verbrannt worden ist, dass Müller & Co. Kredite aufnehmen müssen.
Profitabel ist "About You" vor allem für den Mutterkonzern "Otto": Im vergangenen Geschäftsjahr haben die jungen Modeverkäufer für Fulfillment (Lagerhaltung) sowie den Versand bei den "Otto"-Gesellschaften "Hermes"- und "Baur-Hermes"-Fulfillment sowie bei "Hermes Germany" 223 Mio. € abgeliefert. Auch der dänische Großgesellschafter Anders Holch Povlsen verdient kräftig mit: 2023/2024 kaufte "About You" allein bei den ihm gehörenden "Bestseller"-Firmen, wie "Jack & Jones" und "Vera Moda" Ware für 207 Mio. € ein - überproportional viel im Vergleich zum Umsatz des Modehändlers.
"About You" gehört zu knapp 44 % dem Hamburger Mischkonzern "Otto" und der Unternehmerfamilie mit Michael und Benjamin Otto. Weiterer Groß-Aktionär ist mit knapp 20 % Anders Holch Povlsen, CEO der dänischen "Bestseller-Group", in Deutschland u. a. bekannt mit den Modemarken "Vera Moda" und "Jack & Jones". Polvsen hält auch Anteile am "About You"-Konkurrenten "Zalando" (rd. 10 %).
Die vollständigen "About You"-Zahlen sind auf der Unternehmensseite nachzulesen. (Foto: About You) Diese Nachricht wurde mit Unterstützung von ChatGPT 4O geschrieben und durch einen Nachrichtenredakteur redigiert und veröffentlicht.
-
Handelskammer-Studie fordert vom Senat neue Cluster-Strategie für Hamburgs Wirtschaft.
 |
Die Handelskammer - Profiteur und Kritiker der Senats-Clusterpolitik
Foto: HK Hamburg |
Hamburg, 24.06.224: Die örtliche Handelskammer hat zusammen mit der Vereinigung der Unternehmerverbände - UVNord - sowie mit dem Industrieverband Hamburg eine Studie zur Neuausrichtung der Innovations- und Clusterpolitik für die Freie und Hansestadt Hamburg vorgestellt. Diese wurde von der "VDI/VDE Innovation + Technik GmbH" mit einem Expertenteam, durch Abgleich öffentlicher Studien, Dokumente und Publikationen sowie im Vergleich mit den vier internationalen Clusterregionen Oslo, Marseille, Rotterdam und Seattle aufgrund ähnlicher Wirtschaftsstrukturen wie Hamburg erstellt.
Die Studie betont, dass Hamburgs Wirtschaft eine umfassende und koordinierte Clusterstrategie benötigt, um Innovations- und Transformationsprozesse erfolgreich umsetzen zu knnen. Bislang werden die offiziell acht Hamburger Wirtschaftscluster von der Finanzbehörde, der Wirtschaftsbehörde, der Medien- und Kulturbehörde und der Gesundheitsbehörde weitgehend unkoordiniert untereinander betrieben. Eine Gesamtstrategie oder Koordination gibt es unter Rot-Grün nicht. Dabei ist die Wirtschaftsbehörde BWI mit vier Clustern der größte Geldgeber der Hamburger Fördereinrichtungen.
Laut Studienleiter Gerd Meier zu Köcker haben bestehende Cluster wie "Hamburg Aviation", "Life Science Nord" oder die "Logistik Initiative" zwar in der Vergangenheit zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts beigetragen, stoßen jedoch angesichts der aktuellen Transformationsherausforderungen an ihre inhaltlichen Grenzen. Notwendig seien eine fundierte Evaluation und eine verbesserte Koordination.
Best Practices aus Städten wie Rotterdam, Seattle oder Marseille zeigten, dass die Integration der Clusterpolitik in ein leistungsfähiges städtisches Innovationsökosystem entscheidend sei. An der Elbe versteht der Senat seinerseits die Cluster als politische Vereine, mit denen er Druck auf die Wirtschaft und ihre Verbände ausüben kann, so Handelskammer-Präses Prof. Norbert Aust bereits auf der Jahresversammlung Eines Ehrbaren Kaufmanns Ende vergangenen Jahres.
Die Handelskammer Hamburg profitiert als Gesellschafter seit Gründung des lokalen Cluster-Netzwerks "Gesundheitswirtschaft Hamburg" (Ende Januar d. J. eingestellt) und bei "Finanzplatz Hamburg" mit einer Anschubfinanzierung von allein 1,3 Mio. € selbst finanziell und personell von der rot-grünen Cluster-Politik des Senats. Bis heute hat die Handelskammer und ihr Präses Norbert Aust den Widerspruch nicht aufgeklärt.
UVNord-Präsident Dr. Philipp Murmann hob hervor, dass Cluster keine „Closed Shops“ sein dürften. Die Zusammenarbeit mit Hochschulen und Startups als wichtige Innovations- und Transformationstreiber sei entscheidend. Zudem müssten Cluster regelmäßig an Zukunftsfeldern ausgerichtet werden. Eine zu starke politische Einflussnahme sollte vermieden werden, um notwendige Agilität nicht zu gefährden.
Hubert Grimm, Hauptgeschäftsführer des Industrieverbands Hamburg, betonte, dass innovative Formate wie Reallabore oder eine H2-Strategie künftig in die Clusterpolitik integriert werden sollten. Derzeit fehle ein übergreifendes Gesamtkonzept, an dem nun gemeinsam gearbeitet werde. Die Studie empfiehlt folgende Maßnahmen zur Veränderung der Hamburger Clusterpolitik:
- Erarbeitung einer ganzheitlichen Strategie mit regelmäßiger Evaluation und Wirkungsmessung
- Überprüfung des aktuellen Clusterportfolios auf Basis transparenter Kriterien
- Neugestaltung der Koordination zwischen Verwaltung/Politik und Clustern über Behördenressorts hinweg
- Verbesserung der Zusammenarbeit und Aufgabenteilung zwischen Clustern und weiteren Innovationstreibern
- Einbindung der Cluster in neue Innovationsorte und -formate wie Living Labs, Reallabore oder Innovation Districts
- Gezielte Förderung wichtiger Zukunftsfelder und engere Verzahnung zwischen Clustern und Wissenschaft
Die Untersuchung der Benchmarkregionen wie "Aix Marseille Provence" und Rotterdam zeige, dass eine strukturierte und koordinierte Clusterpolitik positive Auswirkungen auf die wirtschaftliche Wertschöpfung und Wettbewerbsfähigkeit haben kann. Beispielsweise hat die Region Marseille Provence eine Roadmap entwickelt, die Handlungsfelder für die Entwicklung des regionalen Innovationsökosystems definiert. In Rotterdam tragen verschiedene Innovationspartner mit einer gemeinsamen Stadtmarke zur internationalen Profilierung der Stadt bei.
Für die Studie wurden Forschungs- und Unternehmensdaten in den vier zuvor definierten Zukunftsfeldern "Smart Production", "Green & Smart Mobility", "Life Science" und "Green Economy" sowie in relevanten Anwendungsfeldern analysiert. Zu den digitalen Themen gehören u. a. "Erneuerbare Energien & Smart Grids", "Elektromobilität", "Future Public Mobility", "Autonomes Fahren", "Care Technology & Medtech Innovations", "Industrierobotik" und "Smart Factories".
Diese Nachricht wurde mit Unterstützung von ChatGPT 4O geschrieben und durch einen Nachrichtenredakteur redigiert und veröffentlicht.
-
Wankender Online-Riese Otto verschreckt Marktplatz-Händler mit verdreifachten Gebühren.
 |
Otto Marktplatz-Händler fühlen sich verschaukelt und verkauft.
Foto: Otto.de |
Hamburg, 24.06.2024: Ab August d. J. erhöht "Otto.de" die monatliche Grundgebühr für seine Händler auf dem hauseigenen Online-Marktplatz von 39,90 € auf 99,90 €. Auch die Provisionen steigen deutlich, was in den Händlerforen für massive Kritik sorgt. Beispiele: Der Verkauf von Werkzeugen kostet Händler auf "Otto.de" künftig 13 % statt bislang 10 % Provision. Für Technik-Zubehör wird die Provision sogar mehr als verdoppelt. Hier greift der Familienkonzern künftig 15 % statt bislang 7 % ab.
Der Hamburger Online-Riese begründet den Schritt mit einer "strategischen Neuausrichtung, die stärker auf Qualität und Nachhaltigkeit bei den verkauften Produkten" abzielt. So sollen Händler abgeschreckt werden, günstige, vermeintlich minderwertige oder unerwünschte Produkte anzubieten, wie ein Statement der "Otto"-Pressestelle offenlegt. HANSEVALLEY hat in den vergangenen Monaten mehrfach die Austauschbarkeit mit "Aliexpress" und "Temu" ebenso, wie mit "Amazon" und "Ebay" aufgrund billiger Chinaware kritisiert, die z. T. auf "Otto.de" sogar überteuert angeboten wird.
Der Geschäftsbereich "Otto Market" machte schon im Februar und März d. J. negativ von sich reden. So wurde reihenweise Marktplatz-Händlern überraschend gekündigt, ohne eine qualifizierte Begründung. In einem auf "Wortfilter" veröffentlichten Schreiben heißt es lediglich, dass "eine Vielzahl von Kriterien betrachtet und abgewogen wurden". Zugleich wirbt Otto auf seiner Händlerseite mit dem Argument, "einen der fairsten Online-Marktplätze Deutschlands im E-Commerce für Ihre Handelsziele" anzubieten. Händler kritisieren die Gebühren-Erhöhung und kündigen teilweise ihren Rückzug vom "Otto"-Marktplatz an. Grund: Deutschlands größter Marktplatz "Amazon Marketplace" nimmt lediglich 39,- € Grundgebühr im Monat, der amerikanische Marktplatz-Anbieter "Ebay" nur 40,- €, ebenso wie der führende deutsche Mode-Marktplatz "Zalando". Der jüngste Wettbewerber "Galaxus" aus der Schweiz nimmt sogar keinen einzigen Cent monatlicher Kosten.
Damit sind alle maßgeblichen Marktplätze für Deutschland spätestens ab August d. J. günstiger, als der - in Händlerkreisen als konservativ, langsam und teuer bewertete - Hamburger Online-Anbieter "Otto.de", pointiert das Fachmagazin "Neuhandeln.de" in seiner Berichterstattung. "Otto" möchte mit der massiven Gebühren-Erhöhung "selektiver bei der Partnerauswahl" werden. Dabei haben die Bramstedter bislang ohnehin nur deutsche und europäische Marktplatz-Händler zugelassen. Die chinesische Konkurrenz, wie auf "Amazon.de" und "Ebay.de", ist bei "Otto" ohnehin ausgesperrt.
Laut "Otto"-Chef Alexander Birken entfallen mittlerweile ein Drittel der Plattform-Umsätze auf, das erst im Sommer 2020 während der Corona-Pandemie automatisiert angebotene, Marktplatzgeschäft. Ohne das mittlerweile stabile Drittanbieter-Geschäft würden die Umsätze der "Otto"-Handelssparte noch schwächer ausfallen, als sie im vergangenen Geschäftsjahr waren. So erwirtschafte der Konzern mit den Marktplätzen auf "Otto.de" und "About You" Umsätze von insgesamt 2,3 Mrd. € brutto (GMV).
Während der Familienkonzern über steigende Gebühren und Provisionen anscheinend versucht, sein im vergangenen Jahr erneut um 8 % eingebrochenes Handelsgeschäft auszugleichen, mehren sich zugleich Qualitäts- und Retourenprobleme bei "Otto". So liegen die Retourenquoten bei den Hamburgern offenbar deutlich über denen anderer Marktplätze. "Otto" selbst fordert die Händler dreist auf, durch "detaillierte Produktinformationen und innovative Beratungsmöglichkeiten" Retouren zu reduzieren.
Melanie Welz, Chefin des Tierbedarfshops "Cadouri", äußert gegenüber "Neuhandeln": "Ich bin nicht gewillt, SO eine Grundgebühr zu bezahlen. Somit werde ich mich wahrscheinlich von Otto wieder verabschieden." Weitere Händler berichten über höhere Retourenquoten und planen Preisanpassungen, um die Kosten zu decken, schreibt "Neuhandeln.de".
Während "Amazon" mit seinem Image als sicherer Online-Shop und "Service-Meister" Kunden an sich bindet und "Ebay" über Preis mit "Wow"-Aktionen und Auktionen Preis-Leistungs-Sieger ist, versucht sich "Otto" als nachhaltiger Händler zu verankern. Ob diese Marketing-Strategie angesichts verärgerter Marktplatzhändler aufgeht, darf bezweifelt werden.
Dazu passt auch, dass "Otto" noch vor Abschluss des Geschäftsjahres 2023/2024 kurzerhand seinen Plattform-Chef und langjährigen "Amazon"-Marktplatz-Experten Bodo Kipper nach nur 4 Jahren überraschend feuerte. Das Fachmagazin "Exciting Commerce" nannte den Chefposten für das Plattformgeschäft bei den Hamburgern denn auch einen "Schleudersitz". Den hat nun der Ex-"Zalando"-Manager Boris Ewenstein inne, um die rd. 6.500 Marktplatz-Händler bei Laune zu halten.
Angesichts des massiven internationalen Konkurrenzdrucks u. a. durch das weiter wachsende Geschäft von "Amazon" und neue chinesische Mitspieler wie "Temu" oder "Tiktok"-Shops sollen Unternehmensberater von "Boston Consultants" in einem dreimonatigen Strategieprojekt eine neue Preis-, Marktplatz- und Online-Vermarktungsstrategie für den taumelnden Hamburger Handelsriesen finden, merkt das Fachmagazin "Exciting Commerce" an. Diese Nachricht wurde mit Unterstützung von ChatGPT 4O geschrieben und durch einen Nachrichtenredakteur redigiert und veröffentlicht.
-
Staatliche Hamburger Hochschule HAW lässt Ausschluss von Studentin aus Sylt-Video fallen.
 |
Hinter dieser Tür wird auch einseitige Politik betrieben.
Foto: HANSEVALLEY |
Hamburg: 21.06.2024: Das Ausschlussverfahren gegen eine Hamburger Studentin der HAW wegen Teilnahme an einem "Sylter Saufgelage" mit ausländerfeindlichen Parolen ist abgesagt. Das melden übereinstimmend Hamburger Medien, wie das "Hamburger Abendblatt", der "NDR" und die Tageszeitung "Welt". Die staatliche Fachhochschule hat danach das Exmatrikulationsverfahren abgesagt.
In einer offiziellen Stellungnahme erklärte die senatsnahe Hochschule vom Berliner Tor: "Der Ausschuss hat sich nach sorgfältiger Prüfung gegen die Einleitung eines solchen Verfahrens ausgesprochen. Er hat bei der Entscheidung die Verhältnismäßigkeit abgewogen, da es sich bei einer Exmatrikulation um einen schweren Grundrechtseingriff handelt. Dabei wurden das bis Ende Juli ausgesprochene Hausverbot und die individuelle Studiensituation mit einbezogen".
Die ehemalige Mitarbeiterin der Hamburger Influencerin Milena Karl und vermeintliche "Kamerafrau" des "Sylter Saufgelages" wurde zuvor für zwei Monate mit der Schutzbehauptung, sie und die Hochschule vor befürchteten Übergriffen schützen zu müssen, beurlaubt, berichteten "Hamburger Abendblatt" und "Junge Freiheit".
Der wissenschaftspolitische Sprecher und Parlamentarischer Geschäftsführer der AfD-Fraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft - Krzysztof Walczak - erklärte am Donnerstag (20.06.2024) zur jüngsten Entwicklung: „Im Falle des ‚Sylt-Skandals‘ zeigt sich die moralische Skrupellosigkeit vieler Politiker, Medien aber auch der HAW. Die Studentin hat sich an der HAW nie etwas zuschulden kommen lassen. Anstatt die gebotene Verhältnismäßigkeit zu wahren, brach man eine regelrechte Hexenjagd vom Zaun".
Der konservative Landespolitiker weiter: "Immerhin wird es kein Exmatrikulationsverfahren geben und dennoch: Die Hochschule hat sich nicht mit Ruhm bekleckert – im Gegenteil. Nun am Hausverbot festzuhalten, obwohl es auch dafür keine Grundlage gibt, ist irrsinnig. Wir fordern die sofortige Aufhebung des Hausverbots!“
In einem öffentlich kursierenden - politisch gedenderten - Schreiben kündigte HAW-Präsidentin Ute Lorentz ursprünglich einen Exmatrikulationsausschuss aka "Polit-Tribunal" und damit einen juristisch angreifbaren Rausschmiss an. Auf "Reddit" beschwerte sich zugleich sich ein Vertreter scheinheilig aber öffentlichkeitswirksam, dass die interne Mail (in Zeiten sozialer Medien) nach draußen gedrungen sei.
Ein Video mit ausländerfeindlichen Gesängen betrunkener, neureicher Gäste im Kampener "Pony-Club" hatte eine schwerwiegende Lawine unkontrollierter und gefährlicher Reaktionen und Aktivitäten ausgelöst. Dazu gehörten volksverhetzende Vorverurteilungen und politische Forderungen nach Höchststrafen, bewusster Bruch der Persönlichkeitsrechte mit unverpixelten Gesichtern inkl. Klarnamen und Berufen, Denunzierungen sowie Hetzjagden von SPD- und Links-Politikern in sozialen Netzwerken.
SPD und Grüne in der Hamburgischen Bürgerschaften schwiegen am Donnerstag d. J. zur Absage des "Polit-Tribunals" der HAW Hamburg. HANSEVALLEY bleibt an der Entwicklung um das "Sylt-Video" weiter dran.
-
Weiterer Exodus des Medienstandortes Hamburg: Auto Bild und Computer Bild ziehen komplett nach Berlin.
 |
Das "Axel Springer Quartier" in Hamburg: verkauft und verweist.
Foto: HANSEVALLEY |
Hamburg, 12.06.2024 *Update 1*: Der Abstieg des Medienstandortes Hamburg geht weiter: Die Redaktionen der "Axel Springer"-Titel "Auto Bild" und "Computer Bild" ziehen komplett von Hamburg nach Berlin. Der Medienkonzern gab bekannt, dass die Umzüge bis spätestens Ende des Jahres abgeschlossen sein sollen. Betroffen von der weiteren Verlagerung sind dieses mal 150 Mitarbeiter, die künftig in der Berliner Zentrale in Kreuzberg arbeiten sollen. Beide Titel und Redaktionen bleiben auch in der Hauptstadt eigenständig erhalten.
Die Redaktionen von "Auto Bild" und "Computer Bild" sind in Deutschland führend in ihren jeweiligen Segmenten. "Auto Bild" ist eine der meistgelesenen Autozeitschriften in Europa und berichtet regelmäßig über Neuwagen, Tests und Trends in der Automobilbranche. "Computer Bild" ist eine der größten Computerzeitschriften in Europa und bietet umfassende Berichte und Tests rund um Computer, Smartphones und Unterhaltungselektronik.
Mit dem Umzug soll die Zusammenarbeit aller Verlags-Titel untereinander gestärkt werden. Der Hauptsitz von "Axel Springer" befindet sich bereits seit 2003 in Berlin, wo auch andere wichtige Titel des Unternehmens herausgegeben werden, wie "Bild", "Welt" und wo der gleichnamige Nachrichten-Fernsehsender sitzt. "Bild" und "Welt" zogen bereits 2008 bzw. 2001 von der Alster an die Spree, "Sport Bild" folgte vor rd. 5 Jahren den Tageszeitungen an den Berliner Axel-Springer-Platz.
In Hamburg verbleiben von "Axel Springer" nur noch die bereits geschrumpften Teile von "Bild Hamburg", "Welt Hamburg" sowie die Niederlassungen der in Nürnberg angesiedelten "Immowelt"-Gruppe und der in Düsseldorf beheimateten "Stepstone"-Gruppe und die Hilfsorganisation "Ein Herz für Kinder". Mit dem weiteren Rückzug von "Axel Springer" aus Hamburg verliert der einst führende Medienstandort erneut mehr als 100 Journalisten.
Zuvor waren aufgrund der Hauptstadt-Funktion Berlins neben "Bild" und "Welt" bereits der zentrale Newsroom der Nachrichtenagentur "DPA", die Politik-Redaktion des "Spiegel" und die Online-Redaktion der "Zeit" nach Berlin abgewandert. Zudem wurde 2023 der Zeitschriften-Verlag "Gruner + Jahr" von "Bertelsmann" zerschlagen und profitable Teile wie der "Stern" an den Sitz der deutschen "RTL"-Fernsehgruppe nach Köln verlegt.
Hamburg hat in den vergangenen rd. 20 Jahren so gut wie alle tagesaktuellen Redaktionen verloren. Geblieben sind "ARD-Aktuell" mit "Tagesschau" und "Tagesthemen", die Wochenzeitung "Zeit" sowie die Zeitschriftenverlage "Bauer", "Jahreszeiten-Verlag" und die verbliebenen Teile von "Gruner + Jahr".
Die 2014 durch den SPD-Medienbeamten Jens Unrau neu aufgestellte Förderinitiative "Nextmedia Hamburg", seit 2018 unter dem Dach der städtischen "Kreativgesellschaft", schaffte es in den vergangenen zehn Jahren trotz Millionen schwerer Subventionen nicht, in größerem Umfang neue Geschäftsmodelle für den Medienstandort Hamburg zu etablieren.
-
Schlumpf-Video-Skandal in MV fällt Bildungsminsterium und übereifrigem Rektor auf die Füsse.
 |
| Der übereifrige Rektor aus Ribnitz-Dammgarten hat die Schülerin rechtswidrig verhören lassen.
(Grafik "X"/Twitter, @PolitikNote6) |
Schwerin, 31.05.2024: Der übereifrige Rektor des Richard-Wossidlo-Gymnasiums in Ribnitz-Damgarten - Jan-Dirk Zimmermann - hat mit dem von ihm initiierten Polizeiverhör einer vermeintlich AfD-nahen Gymnasiastin gesetzeswidrig über das Ziel hinaus geschossen. Der SPD-nahe Schulleiter aus Aachen hatte die 16-jährige Loretta B. - eskortiert von drei uniformierten Beamten aus Stralsund - rechtswidrig zu einer Gefährderansprache gezwungen und die erziehungsberechtigte Mutter vorher nicht informiert.
Das hat eine Anfrage des AfD-Abgeordneten im Schweriner Landtag - Enrico Schult - beim zuständigen Bildungsministerium ergeben. Schult wollte wissen, welche vermuteten oder drohenden Straftaten in dem - zunächst gegenüber den Abgeordneten des Landtages geheim gehaltenen - Rundschreiben des Ministeriums vom 22.02.2024 zur Rechtfertigung eines umgehenden Polizeieinsatzes ohne Einbeziehung der Erziehungsberechtigten genannt werden.
Wie die "Junge Freiheit" und andere konservative Medien jetzt berichteten, bezieht sich die Handlungsanweisung in dem benannten Rundschreiben auf Fälle, wie Bombendrohungen, Amokandrohungen, Waffen- und Drogenvorkommnissen und Missbrauch digitaler Medien. In dem unterdessen bekanntgewordenen Schreiben heißt es weiter: „Bei meldepflichtigen Vorfällen ohne Brisanz oder vermuteter Öffentlichkeitswirkung reicht eine Anzeige mittels Vordruck der Meldebögen A und B innerhalb von 24 Stunden.“
Das von der Wismarer Linken-Politikerin Simone Oldenburg geleitete Bildungsministerium erklärte in Beamtendeutsch gegenüber dem AfD-Abgeordneten Schult: „Mit Bezug auf den Sachstand am 27.02.2024 ist eine Meldung per Meldebogen angezeigt.“ Heißt: Der vermeintliche "Nazi-Jäger" Zimmermann hätte die ihm von einer Denunziantin per E-Mail zur Kenntnis gegebenen Schlumpf- und Heimatliebe-Postings von Loretta B. auf "TikTok" einfach in einen dafür vorgesehenen Meldebogen eintragen dürfen.
Der Fall hatte nach Bekanntwerden bundesweit u. a. bei "FAZ, NZZ und Welt" Aufsehen erregt, vor allem, weil der Rektor - wie laut Rundschreiben bei Bombendrohungen, Amokandrohungen, Waffen- und Drogenvorkommnissen vorgesehen - erst mit drei uniformierten Beamten vor der Klasse der verängstigten Schülerin antrat, statt die Mutter zu informieren. Nachträglich bekräftigte der offensichtlich übereifrige "AfD-Jäger" auch gegenüber der Mutter der Betroffenen, dass er laut Dienstanweisung zunächst die Polizei rufen musste.
Die Polizei stellte bereits vor dem Eintreffen der Streife vor Ort fest: Weder das Posten des AfD-Clips mit blauer "Statista"-Deutschlandkarte zu AfD-Wahlergebnissen aus Mai 2022 noch die persönliche Äußerung der Schülerin auf "TikTok" waren strafrechtlich relevant. Dennoch unterzogen die Beamten die Schülerin auf Bitten des Schulleiters einer "Gefährderansprache" - Personen vorbehalten, die die öffentliche Sicherheit gefährden könnten.
Laut feingeschliffener Polizeimeldung ging es später nur darum, "sie vor möglichen Anfeindungen zu schützen, die sich aus ihren Aktivitäten in sozialen Netzwerken ergeben könnten". „Ganz offenbar war der Polizeieinsatz am Ribnitz-Damgartener Wossidlo-Gymnasium Ende Februar unangemessen und stand sogar den internen Regelungen des Bildungsministeriums entgegen“, sagte Enrico Schult gegenüber der "Jungen Freiheit". Der Fall hatte hohe Wellen geschlagen, nachdem Unbekannte ein Transparent mit der Aufschrift "Heimatliebe ist kein Verbrechen" vom Dach der Schule ausrollten.
Der Fall sorgte weitergehend für Schlagzeilen, weil "X"-Chef und Tech-Tycoon Elon Musk auf seinem Nachrichten-Netzwerk nach Bekanntwerden der Veröffentlichung von "Schlumpf-Videos" öffentlich nachfragte: "Ist das alles?" Nach Kritik an dem überzogenen und nun als rechtswidrig bestätigten Vorfall durch den parteilosen Landrat von Vorpommern-Rügen wurde dieser von den Grünen im Kreistag in die Nazi-Ecke gestellt, da er sich nicht gegen die vermeintlich rechtsextremistische Haltung der Schülerin gestellt hätte.
Der ganze Fall kann hier im Hanse Recherche Magazin HANSEINVESTIGATION nachgelesen werden.
-
Hamburger Hochschule HAW plant politisches Tribunal über Studentin aus dem Sylt-Video.
 |
Mit diesem Cover greift der Stern tief in die politsche Trickkiste.
(Screenshot: HANSEVALLEY) |
Hamburg/Berlin, *Update 4 - 11.06.2024*: Ersichtlich volksverhetzende Vorverurteilungen und politische Forderungen nach Höchststrafen, bewusster Bruch der Persönlichkeitsrechte mit - von Medienjuristen bereits kritisierten - unverpixelten Gesichtern inkl. Klarnamen und Berufen in der "Bild"-Zeitung, Denunzierungen und Hetzjagden von SPD- und Links-Politikern in sozialen Netzwerken, Wühlen im vermeintlichen Dreck durch die "TAZ" - bei einem, "der nichts dagen unternahm" und eine Medienhysterie über "Champagner-Nazis" - das unappetitliche "Sylt-Video" betrunkener "Pfingst-Proleten" aus der Kategorie "Rich Kids" mit "Ausländer raus"-Parolen im Kampener "Pony-Club" hat eine schwerwiegende Lawine unkontrollierter und gefährlicher Reaktionen und Aktivitäten ausgelöst.
Erst nach massenweiser Verbreitung des "Sylt-Videos" mit kritisierenswerten "Deutschland den Deutschen"-Parolen zum Party-Hit "L’amour toujours“ von Gigi D'Agostino sowie erfolgreich abgerechneten Champagner-Flaschen verhängte "Pony"-Wirt Tim Becker öffentlichkeitswirksam auf Instagram ein Hausverbot der gern 150,- € Eintritt und auch ansonsten gut zahlenden Kundschaft mit Benz, BMW, Ferrari oder Porsche vor der Tür, versuchte sich mit einem Überwachungsvideo zu 500 vermeintlich unübersichtlich feiernden Partygästen auf der Club-Terrasse zu entschuldigen. Der politisch gedenderte Versuch stellt die Frage in den Raum, wer hier noch mitgrölte und wer vermeintlich unschuldig wegschaute.
Angesichts katastrophaler Wahlprognosen und verloren gehender Wahlen ziehen linke Regierungspolitiker vor allem der SPD mit einem - Zitat "Mopo" - "hochkarätigen Hexenkessel" offen über die "Krakeler von Kampen" her, vorverurteilt SPD-Bundestagsvizepräsidentin Bärbel Bas als Volksvertreterin die "Sylter Schlagerdeppen" übergriffig in der Rolle einer Möchtegern-Staatsanwältin: Teilnehmer sollten zur "Höchststrafe" für ein rechtlich noch nicht einmal angeklagtes Vergehen - wie z. B. einer möglichen Volksverhetzung mit bis zu fünf Jahren - weggesperrt werden. Dabei ist die Parlaments-Präsidentin selbst gerade einmal Bürogehilfin ... SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert begrüßte bei Markus Lanz im ZDF den Verlust der Arbeitsplätze unserer "brüllenden Jung-Bonzen" freudig als Höchststrafe - in bester Gesellschaft mit Ex-CDU-Kandidat Armin Laschet, der das als Scheiterhaufen aller künftig vergleichbaren Vorfälle fordert.
AfD-Chefjägerin Nancy Faeser kippte über die entgleisten "Kaschmir-Kids" gleich einen ganzen Kübel Dreck aus: "Wer Nazi-Parolen wie „Deutschland den Deutschen - Ausländer raus“ grölt, ist eine Schande für Deutschland“. Mit einem "Deutschland den Deutschen"-Verriss als Social-Media-Anzeige kassierte der kleine wahlkämpfende Kevin Kühnert im Netz einen Shitstorm wegen Geschmacklosigkeit. Bei Lanz übernahm er zwar die Verantwortung als SPD-Kampagnenchef, verweigerte jedoch beharrlich und feige wirkend die Antwort, ob er die Social-Media-Kachel vorher kannte oder nicht. Zugleich konnte es der Generalsekretär der 15 Prozent-Partei nicht lassen, einen Dialog über den politischen Umgang miteinander einzufordern. Eine interessant wirkende Doppelzüngigkeit.
Sein SPD-Parteikumpel, der Ludwigsburger Lokal-Politiker und Ministerialreferent im Stuttgarter Verkehrsministerium - Torsten Liebig - war da wesentlich klarer unterwegs, brandmarkte eine junge Teilnehmerin des Sylt-Gelages mehr als grenzwertig mit ungepixeltem Porträtfoto und Klarnamen auf seinem mittlerweile privat gestellten Instagram-Account als - Zitat - "SS-Rottenführerin". Offenbar bekam er aus dem Netz kräftig Gegenwind zu seiner mutmaßlich selbst ausgerufenen Volksverhetzung. Das mit derartig deplatzierten Verunglimpfungen echte Neo-Nazis mit Mordgelüsten und Anschlägen verharmlost werden, scheint dem Schwaben schlichtweg egal zu sein.
Der ehemalige Linkspartei-Bundestagsabgeordnete Niema Movassat ging noch weiter: Er forderte online gleich dazu auf, die unverpixelten Gesichter der "Sylt-Spacken" zu verbreiten, damit sie die "Konsequenzen tragen“, berichtete die "Junge Freiheit". Der Linkspolitiker ruft damit offensichtlich - zumindest indirekt - zu einer Hetzjagd auf die Sylter "Porsche-Prolls" auf - mit gefährlichen Folgen. Der links-agitatorische WDR übernahm denn auch gleich die Recherche der Opfer des digitalen Scheiterhaufens. "Mopo"-Kommentatorin Stefanie Lamprecht bewertet die ersichtlich vorsätzlichen Aufrufe zur Existenzvernichtung zu Recht als "Mittelalter". Dabei ist die ehemalige SPD-Gazette "Hamburger Morgenpost" gern auch mal politisch linientreu.
 |
Griff in die Kloschüssel im SPD-Wahlkampf.
Werbung: SPD Bundesverband |
Auch die Entlassung eines Mitarbeiters der Werbeagentur "Serviceplan" nach seiner Identifikation ist juristisch höchst fragwürdig und jetzt wohl ein Fall für die Gerichte. Nun scheint die senatstreue Hamburger Fachhochschule HAW ihrerseits ein politisches Tribunal an einer ebenfalls als Sylt-Teilnehmerin identifizierten Studentin statuieren zu wollen. So wurde die in Hamburg studierende "Kamerafrau" des "Sylter Saufgelages" zunächst für zwei Monate mit der Schutzbehauptung, sie und die Hochschule vor befürchteten Übergriffen schützen zu müssen, beurlaubt, berichten aufgewachte Medien - von "Hamburger Abendblatt" bis zur "Jungen Freiheit".
Die bereits entlassende Assistentin der Hamburger Influencerin Milena Karl wird nun einem fragwürdigen Ausschlussverfahren unterworfen. In einem öffentlich kursierenden - politisch korrekt gedenderten - Schreiben kündigt HAW-Präsidentin Ute Lorentz einen Exmatrikulationsausschuss aka "Polit-Tribunal" und damit einen juristisch angreifbaren Rausschmiss an. Auf "Reddit" beschwert sich ein Vertreter unterdessen scheinheilig aber öffentlichkeitswirksam, dass die interne Mail (in Zeiten sozialer Medien) nach draußen gedrungen sei. Auch hier scheinen unterschiedliche Maßstäbe in der Bewertung gern Anwendung zu finden.
Unterdessen werden weitere Vorfälle mit vergleichbaren, ausländerablehnenden Gesängen bekannt: Auf einer Schülerparty im privaten Internat "Luisenlund" in Güby bei Schleswig stimmten offenbar acht Schüler auf einer Schülerhausparty ebenfalls den schon aus Kampen bekannten "Alternativ-Text" zu "L’amour Toujours“ von Gigi D’Agostino an. Weitere Schüler standen wohl ohne Reaktion um die Tanzfläche herum, so Medienberichte. Es ist nicht bekannt, ob in dem Internat für spätere Sylt-Saufgelage schon mal "geübt" wird.
Auch auf dem am vergangenen Samstag (25.05.2024) in Hamburg stattgefundenen "Schlagermove" kam es offenbar zu einem ähnlichen Zwischenfall. Nachdem der DJ eines Musiktrucks am späten Samstag-Nachmittag den Partyhit in der Originalversion auf Höhe Pinnasberg im Stadtteil St. Pauli anspielte, skandierte eine Reihe von Teilnehmern die unappetitlichen Verse von Sylt, berichtete u. a. der NDR Hamburg. Selbstredend leistete der Veranstalter für die Entgleisung seiner vermeintlich "feiernen Faschisten" Abitte mit Asche auf seinem Haupt.
Ebenfalls zu Pfingsten soll sich ein weiterer Vorfall bei einem Schützenfest in Löningen im Landkreis Cloppenburg westlich von Oldenburg ereignet haben. Ein Gruppe mit fünf - spekuliert - "Nachwuchs-Nazis" soll hier am Pfingstmontag vergleichbare Proll-Parolen skandiert haben. Beteiligte Mitglieder des örtlichen Schützenvereins erklärten anschließend wohl ihren Austritt, um den Verein zu schützen. In allen norddeutschen Fällen auf Sylt, bei Schleswig, in Hamburg und im Kreis Cloppenburg haben Polizei und Staatsanwaltschaft Ermittlungen eingeleitet - Ausgang ungewiss bis fraglich.
Am vergangenen Sonntag hat es nach Berichten der politisch gern auch mal links-übergriffigen Redaktion von "ARD aktuell" beim Hamburger NDR einen weiteren, nächtlichen Zwischenfall in der Landeshauptstadt Schwerin gegeben. Zudem berichtet die "Tagesschau" von weiteren Pfingstvorfällen in Banzkow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) und bei einer Abi-Feier in Neukalen in MV. Dabei ist nicht bekannt, ob die vermeintlichen "Hobby-Hitler" das Urteil des Bundesverfassungsgerichts kennen: Denn "Ausländer raus" ist rechtlich nicht verboten. Auch wenn sich aktuell nicht nur "Sylter*innen gegen rechts" das wünschen-wollen-würden.
Dafür hat die Münchener Stadtverwaltung den Partyhit "L'Amour Toujours" auf dem kommenden Oktoberfest aus Angst vor Nachahmern gleich ganz verboten. "Das Lied wird nicht gespielt - weder im Zelt noch sonst irgendwo", sagte der für die "Wiesn" zuständige Münchner CSU-Wirtschaftsreferent Clemens Baumgärtner medienwirksam dem Bayerischen Rundfunk. Bei dem an sich unverfänglichen Lied gebe es inzwischen "eine rassistische Konnotation", so die moralisch als korrekt gefühlte Begründung. Unterdessen wetteifern die Veranstalter von Kieler Woche, Holstenköste und Travemünder Woche, wer den harmlosen Hit von 2001 am schnellsten politisch korrekt versenken kann.
Der Chef des deutschen DJ-Verbandes findet klare Worte zu der politischen Scheinheiligkeit in biergeschwängerten Festzelten und auf verschlickten Dorfackern: "Wo sind wir denn, Lieder zu zensieren?“, fragt BVD-Präsident Dirk Wöhler. "Alles Verbotene ist sexy in der Popkultur" pointiert "Welt"-Chefredakteur Ulf Poschardt am Mittwoch d. W. (29.05.24) den Münchener Vorstoß. Damit sorgte der vermeintlich clevere CSU-Gesinnungsbeamte wie seine Event-Kollegen in Schleswig-Holstein und bei der Berliner Fussball-Fanmeile, dass jetzt ganz Deutschland den alten und neuen No. 1-Chart-Breaker bei "iTunes", "YouTube" & Co. mitgrölt. Ein "Schuss ins eigene Knie", könnte man kiechernd feststellen, wenn es nicht so armseelig und peinlich wäre, wie sich politisch links-woke "Vertreter*innen" inkl. CSU selbst zum Vollhorst ihrer Volksfeste machen.
 |
Die digitalen NDR-"Nazijäger" haben mal eine Karte bekannter Zwischenfälle erstellt.
Grafik: Funk |
Ein Kommentator auf "X" stellte mit Smiley fest: Viele der übereifrigen "Demokratieschützer*innen" werden sich angesichts der Popularität von "L’amour toujours“ mit neuem Text noch sehnlichst "Leyla" zurückwünschen ... Offenbar gibt es bei Event-Veranstaltern und Links-Politikern eine nicht unbegründete Furcht, der "politische Partyhit" könnte spätestems nach Sylt zu einem bundesweiten "Knaller" werden (oder schlimmer: bleiben) - und alle Versuche in der "Demokratie-Erziehung" der Ersatz-"Pädagog*innen" Faeser, Paus & Co. zu Nichte machen, wie die Sangeskünste eine Gruppe - Achtung! - türkischer Fußball-Fans in Stuttgart schon mal vormachte. Dabei sind Sylt & Co. eigentlich "kalter Kaffee", denn vergleichbare Vorfälle gab es schon im Oktober vergangenen Jahres in der Dorfdisko der 315-Seelen-Gemeinde Bergholz in MV - und danach bundesweit.
Bereits am 16. Januar dieses Jahres stelisierte der poltisch-korrekte NDR den "rassistischen Ohrwurm" zum "TikTok"-Trend hoch. Am 24. Mai d. J. posaunt dann das gern leicht linkslastige "Stroer"-Boulevard-Portal "T-Online" die Schlagzeile "Rechte Parole und Hitlergruß: Sylt-Urlauber schockieren in Disco“ raus. Und um den Club der regierungstreuen Medien komplett zu machen. ist sich die 20 Uhr-"Tagesschau" nicht zu schade, über 2,5 Minuten "Ermittlungen wegen rassistischer Parolen“ zu vermelden. Dabei gab, gibt und wird es wohl es immer wieder und überall vergleichbare Entgleisungen geben, wie "Funk" vom NDR mit allein 30 Fällen in den vergangenen acht Monaten brav recherchierte.
Es ist fraglich, was die mit dem "Sylt-Video" auf Existenzvernichtung ausgelegten Politpranger, Vorverteilungen und Hetzjagden von SPD-Politikern - wie Parteichef Lars Klingbeil auch nach der Europawahl-Klatsche - mit Slogans der Partei gegen "Hass und Hetze" und "Mut" zur "Mitte" zu tun haben. Vielleicht werden wir dies nie erfahren, wenn nach der versemmelten Europawahl sowie der bevorstehenden Landtags- und Kommunalwahlen "Sozis" und ihre Gesinnungsgenossen bei Grünen und Linkspartei noch ganz andere Probleme haben und mit - dann auch außerparlamentischem - Wundenlecken beschäftigt sind.
SPD-Chefwahlkämpfer Kevin Kühnert erwiderte einen tätlichen Angriff auf eine Grüne Lokalpolitikerin in Dresden bei Markus Lanz mit der Möglichkeit, statt auf unerwünschte Politiker los zu gehen, "sie einfach abzuwählen". Vielleicht war das ja eine richtig gute Idee mit Rahmen des SPD-Projekts "10 Prozent", angesichts fast weiterer 2 % Absturz der SPD auf nur noch 13,9 % - vor allem aufgrund grün-idiologischer und links-woker Gängelungen auf Bundes-, Landes- und Kommunalebene. Oder ahnt Kevin K. etwa schon die zu erwartenden Katastrophen der bevorstehenden Landtagswahlen in Ostdeutschland?
-
Hamburg entgegen kommerzieller Marketing-Studien nicht unter den Top Ten-Regionen Deutschlands.
 |
Die "schönste Stadt der Welt" schafft es nicht mal in die deutschen Top Ten.
(Grafik: IW Consult) |
Hamburg, 24.05.2024: Keine Stadt oder Region Norddeutschlands gehört zu den wirtschaftlich stärksten oder für Arbeitnehmer attraktivsten Standorte Deutschlands. Damit ist auch die Freie und Hansestadt Hamburg - im Gegensatz zu kommerziellen Erhebungen wie des Marketing-Instituts "FDI Intelligence" der "Financial Times"-Firmengruppe - keine führende Region der Bundesrepublik.
Hamburg lässt sich seit mehreren Jahren durch die kommerziellen Marketing-Auswertungen von "FDI Intelligence" im Rahmen des eigenen Standort-Marketings als "Stadt der Zukunft" bewerben - in diesem Jahr als vermeintliche "European City and Region of the Future 2023" in der Kategorie "Großstädte" - in einem Atemzug mit London und Zürich.
Laut britischer Marketing-Auswertung punktet Hamburg danach vor allem mit "Geschäftsfreundlichkeit" und "Konnektivität". Auch in der Unterkategorie "Humankapital und Lebensstil" lag die Stadt vermeintlich vorn. Die englische Marketing-Studie vergleicht 370 europäische Städte und 148 Regionen nach "Wirtschaftspotenzial", "Unternehmensfreundlichkeit", "Konnektivität", "Humankapital" und "Lebensstil" sowie "Kosteneffizienz".
Im Gegenzug dazu weist das "Institut der Deutschen Wirtschaft" mit 55 ausgewerteten Bereichen erwartungsgemäß die Region München mit 59,5 Punkten als stärksten und attraktivsten Standort der Republik aus - vor allem aufgrund der Wirtschaftsstärke der Metropolregion München/Oberbayern. Die bayerische Landeshauptstadt selbst punktet nach Coburg auf einem starken vierten Platz (mit 55,4 Punkten).
Überraschungs-Zweiter in der Regionalauswertung '24 ist unter den beleuchteten 400 deutschen Region die rheinland-pfälzische Landeshauptstadt Mainz - aufgrund der Wirtschaftsstärke durch den Pharmakonzern "Biontech". Dagegen kann Hamburg auch nicht in seinen traditionellen Branchen Maritime Wirtschaft, Logistik und Transport sowie Handel punkten. Mit der Abwanderung der einst starken Medienwirtschaft und der Verlagerung der Internetwirtschaft auf Berlin und München fehlt Hamburg ein Zukunftsfeld.
Hamburg schafft es immerhin unter die Gruppe der starken Regionen im Land mit mind. 52 Punkten - wie 59 andere Städte und Landkreise auch - z. B. die drei südlichen Landkreise der Hauptstadtregion Berlin, zahlreiche Landkreise im Freistaat Bayern sowie eine Reihe von Standorten in Baden-Württemberg und Hessen. Dagegen punktet Hamburg bei der dynamischen Entwicklung nicht besonders hoch - im Gegensatz zur Hauptstadt Berlin.
Im Bereich Wirtschaftsstruktur wirkt sich die gemeindliche Steuerkraft laut "IW Köln" am stärksten auf den Erfolg einer Region aus. Der Indikator geht daher mit 14,9 % in den Gesamtindex ein. Die Lebensqualität einer Region wird hauptsächlich von dem Maß der privaten Überschuldung vor Ort beeinflusst. Aus diesem Grund berücksichtigt das Regionalranking diesen Faktor mit 13,3 %.
Die Beschäftigungsrate von Frauen ist bestimmend für den Themenbereich Arbeitsmarkt und fließt mit 8,2 % in den Gesamtindex ein. Negativ auf den Erfolg einer Region wirken sich hohe Gewerbesteuersätze aus. Diese beeinflussen den Gesamtindexwert zu 7,6 %. Im Gegensatz hierzu wirkt sich eine gute Ärzteversorgung stark positiv auf die Lebensqualität aus und wird mit 7,3 % berücksichtigt.
Das "IW-Regionalranking" verwendet ökonometrische Verfahren, um Schlüsselfaktoren für erfolgreiche regionale Entwicklungen zu identifizieren. Durch das datenbasierte Vorgehen können räumliche Entwicklungen bundesweit verglichen werden. Insgesamt wurden die Indikatoren vor allem auf ihren Einfluss auf den regionalen Erfolg untersucht, wobei die Aspekte Lebensqualität, Wirtschaftsstruktur und Arbeitsmarkt besonders beleuchtet wurden.
Die Kölner Wissenschaftler haben 14 signifikante und den regionalen Erfolg erklärende Indikatoren in den drei Clustern Wirtschaftsstruktur, Arbeitsmarkt und Lebensqualität analysiert, darunter Steuerkraft, Ärztedichte, Anteil hoch qualifizierter Beschäftigter, Kriminalitätsraten, Verschuldung sowie Zu- und Abwanderung.
Weitere Ergebnisse mit den Gewinnern und Verlierern des "IW Regionalrankings 2024" sind auf den Seiten des "IW Köln" nachzulesen. -
Hamburger NDR-Fernsehjournalistin Jabarine macht auf Instagram Palästinenser-Propaganda.
 |
Alena Jabarine benutzt Journalismus für ihre politischen Zwecke.
(Screenshot: X/@Antisemiticblog) |
Hamburg, 13.05.2024: Die Politik-Wissenschaftlerin und Journalistin Alena Jabarine ist als langjährige Mitarbeiterin des NDR erneut negativ wegen einseitiger Stimmungsmache für den palästinensischen Terror der Hamas im Gaza-Streifen aufgefallen. Die Tochter eines Palästinensers aus Israel postete als bekannte NDR-Journalistin eine "Instagram"-Story mit Palästinener-Halstuch und Handykette in Palästinenser-Farben.
Den neuesten Ausfall der auf "Instagram" ersichtlich nicht neutral arbeitenden NDR-Journalistin von "Panorama 3" veröffentlichte "ÖRR Antisemitismus Watch" auf "X" (vormals "Twitter"). Auf Twitter vergleicht sich die gebürtige Hamburgerin auf ihrem Account mit rd. 2.600 Followern im Zusammenhang mit Gewissensfragen zu Flüchtlingen sogar mit Sophie Scholl. Auf "Instagram" und "X" veröffentlicht sie zudem bevorzugt Fotos von Flüchtlingen und einseitige politische Statements und Schuldzuweisungen gegenüber Israel und westlichen Demokratien.
Die Hamburger Politikwissenschaftlerin sieht sich selbst als Aktivistin für die palästinensische Sache. So empfahl sie nach dem islamistischen Pogrom vom 7. Oktober '23, lieber den katarischen Fernsehsender "Al Jazeera" zu schauen, statt deutsche Medien, zitiert "Wikipedia". "Al Jazeera" gilt als israelfeindlich, weshalb die Redaktion in Ost-Jerusalem offiziell geschlossen worden ist.
Vor Alena Jabarine fielen bereits öffentlich-rechtliche ARD-Kolleginnen u. a. von Radio Bremen und SWR wegen antisemitischer Propaganda auf, beispielsweise mit einem Video, mithilfe einer App gezielt Lebensmittel von israelischen Unternehmen oder Beteiligungen wie in der Nazi-Zeit zu boykottieren. Auf dem Festival "Z2X" der Wochenzeitung "Die Zeit" forderte sie bereits Mitte Februar 2018 die Medienbranche mit den Worten "Journalisten, nehmt die Masken ab" auf, ihre Neutralität aufzukündigen.
Alena Jabarine hat neben ihrer deutschen Staatsangehörigkeit auch noch einen israelischen Pass. Auf das Massaker vom 7. Oktober '23 mit fast 1.500 ermordeten Frauen, Kindern und Zivilisten, mehr als 130 bis heute gefangen gehaltenen Geiseln, fast 40 toten Geiseln sowie rd. 15.000 Verletzten geht die Hamburger Aktivistin in ihrer Berichterstattung offensichtlich bewusst nicht ein. (Screenshot: X/@Antisemiticblog) -
Bund und Länder streiten sich um neuen Digitalpakt für die Ausstattung der Schulen.
 |
Zwei glückliche Schülerin lernen Computer spielerisch kennen.
(Foto: "NA IT macht Schule"/Nordakademie) |
Berlin, 08.05.2024: Der Bund und die Länder streiten sich hinter den Kulissen über einen neuen "Digitalpakt 2.0" zur Unterstützung der Schulen in Deutschland. Ein entscheidender Streitpunkt ist der Anschluss an den bisherigen "Digitalpakt 1.0". Dieser läuft jetzt im Mai '24 aus. Danach können die Länder keine weiteren Maßnahmen mit 90 % vom Bund finanzieren lassen können. Entsprechend hoffen die Bildungsminister in den Bundesländern auf eine möglichst lückenlose Fortsetzung, was nicht passieren wird. Aktuell wird mit einem neuen "Digitalpakt" frühestens im kommenden Jahr gerechnet.
Der neue "Digitalpakt 2.0" sieht eine deutliche Verschlechterung der Rahmenbedingungen für die 16 Bundesländer vor. Seit Mai 2019 investierte der Bund mit seiner Basisförderung und 3 Corona-Paketen insgesamt 6,5 Mrd. €. Konnten die Kultusministerien bislang mit nur 10 % ergänzenden Landesmitteln Schulen mit Tablets, Notebooks, digitalen Tafeln und schnellen WLAN-Routern ausstatten, müssen sie künftigen selbst tiefer in die Tasche greifen. Laut aktueller Planungen fordert der Bund künftig die Hälfte der Finanzierung für digitale Bildung von den Ländern. Ab 2030 könnte die Förderung des Bundes ganz wegfallen.
Der Entwurf für den "Digitalpakt 2.0" sieht vor, dass sich die Länder mit dem neuen Förderprogramm vornehmlich um die "leistungsstarke und angemessene technische Infrastruktur” in den Schulen kümmern und die z. T. zutiefst in analogen Lehrmethoden feststeckenden Lehrkräfte in digitalen Lehrmethoden trainiert werden. Jeder Lehrer soll sich im Jahr 30 Stunden zu digitalem Lehren und Lernen weiterbilden. Dazu soll u. a. das Fortbildungsbudget pro Lehrkraft um 40,- € pro Jahr erhöht werden. Zudem verlangt der Entwurf die Einbeziehung neuester Technologien in den Unterricht, wie z. B. Generated AI.
Der Bundesvorsitzende des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE) - Gerhard Brand - sieht in dem aktuell bekannten Entwurf eher einen "Wunschzettel", denn ein praktikables Konzept. Der Interessensvertreter betont die nach wie vor großen Herausforderungen an Deutschlands Schulen, in eine digital-vernetzte Welt zu kommen. Er fordert eine langfristige Unterstützung, um die Digitalisierung an den Schulen wirklich voranzubringen.
Ralf Wintergerst, Präsident des Digitalverbandes Bitkom, begrüßt grundsätzlich den vorgelegten Entwurf des "Digitalpakts 2.0", aber: "Bund und Länder stehen sich im Kompetenzgerangel weiterhin selbst im Weg. Deutschlands Schulen endlich fit für das digitale Zeitalter zu machen, muss jetzt Priorität haben. Dazu gehört vor allem auch, sich auf eine konkrete Summe für den Digitalpakt 2.0 zu einigen."
Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien - Koordinatorin der unionsregierten Länder - sagte der "FAZ": „Auch wenn angesichts des Papiers Zweifel angebracht sind, hoffen wir, dass der Bund ebenfalls die ernsthafte Absicht hat, mit den Ländern zu einer zeitnahen Verständigung zu kommen.“ Die Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft - Maike Finnern - betont: “Der Digitalpakt 2.0 muss endlich kommen. Bund und Länder müssen die Hängepartie beenden. Die Schulen brauchen Planungssicherheit”.
-
Rossmann und Wenko sehen durch chinesischen Billig-Konkurrenten Temu ihre Felle wegschwimmen.
 |
Temu: Als Kunde immer wieder überraschend - als Konkurrent eher schockierend.
Foto: Temu |
Burgwedel/Hilden, 07.05.2024: Einheimische Handelsunternehmen fühlen sich vom zunehmenden Erfolg des chinesischen Marktplatzes "Temu" in Deutschland bedroht. Neueste Kritiker des asiatischen Billig-Händlers sind der Drogeriemarkt-Filialist "Rossmann" aus Burgwedel bei Hannover sowie der Haushaltswaren-Händler "Wenko" aus Hilden in NRW. So gehen Familien-Unternehmer und Firmen-Erben Raoul Rossmann und Niklas Kölner medial auf die im 2. Halbjahr '23 allein von 1/4 aller deutschen Konsumenten ausprobierten Plattform "Temu" frontal los.
"Rossmann"-Chef Raoul Rossmann erklärt gegenüber dem "Handelsblatt": „Es gibt in Deutschland eine Narrenfreiheit für fragwürdige digitale Geschäftsmodelle“, so der jüngere der beiden Söhne von Firmengründer Dirk Rossmann. „Wenn Temu die Regeln nicht einhält, sollte es einfach abgeschaltet werden.“ Pikant: Hinter "Rossmann" steht mit 40 % Gesellschafter-Anteilen der chinesische Mischkonzern "Hutchison Whampoa" mit seiner Tochter "A. S. Watson". "Temu" konkurriert mit "Rossmann" u. a. in den Wachstums-Kategorien Haushalts- und Spielwaren sowie Schönheit und Gesundheit.
Noch einen Zacken schärfer greift der direkt in Konkurrenz stehende Haushaltsartikel-Händler "Wenko" seinen Rivalen "Temu" und dessen Mutterkonzern "Pinduoduo" - "PDD Holdings" an: Niklas Köllner, zusammen mit seinem Bruder Philipp Eigentümer des Haushaltswaren-Vertriebs in dritter Generation, fühlt sich in seinem Geschäft mit Klebehaken, Kleiderbügeln, WC-Sitzen und Abflussstöpseln vom chinesischen Billig-Versender direkt angegriffen:
Mehr als 400 Produkte habe er binnen der letzten Wochen erfolgreich von der "Temu"-Plattform löschen lassen, weil sie die Schutzrechte von "Wenko" verletzt hätten. Journalistisch objektiv nachweisen lässt sich dies nicht. „Diese Produkte tauchen binnen kürzester Zeit wieder unter anderem Namen auf“, berichtet er von seiner Erfahrung in einer aktuellen Pressemeldung. „Das ist wie ein Hase- und Igel-Spiel. Das können wir auf Dauer nicht weiterspielen, deshalb brauchen wir deutlich bessere Kontrollen für alle Importe." Als Schutzargument dient ihm wie Politikern und Verbänden das Argument der Produktsicherheit.
Die deutsche Kritik an "Temu" richtet sich u. a. an vermeintlich manipulativen Verkaufsmethoden auf Online-Portal und Mobile App mit angeblich unseriösen Rabatten, unklaren Lagerbeständen und teilweise unsicheren Produkten, z. B. im Bereich Kinderspielzeug. Eine Sprecherin von "Temu" erwiderte auf die deutsche Kritik zu Preisen und Verfügbarkeit im April d. J.: "Viele unserer Verkäufer sind Hersteller, die traditionell stationäre Geschäfte beliefern." Man verwende deren empfohlene Preise, die auf denen in Geschäften basierten, und hebe auf dieser Basis die Rabatte hervor.
Interessant: Laut Stichprobe des Hanse Digital Magazins HANSEVALLEY verkaufen chinesische wie europäische und deutsche Marktplatz-Händler identische Billig-Artikel z. B. aus dem Sortiment Haushaltswaren auf "Amazon", "Ebay" und "Otto.de". Dieselben Artikel sind auf den chinesischen Plattformen "AliExpress" und "Temu" zu teilweise erheblich niedrigeren Preisen zu haben - inklusive Verzollung in der EU und Lieferung nach Hause mit "DHL" oder "Hermes" innerhalb von 10-14 Tagen.
Laut repräsentativer Umfrage des Hamburger Markt- und Meinungsforschers "Appinio" im Auftrag von "Temu" kauften im 2. Halbjahr '23 von 1.000 befragten Verbrauchern 86,5 % vor allem bei "Amazon" ein, gefolgt von 44,3 % bei "Ebay". Hier liegt der deutsche Online-Händler "Otto" mit 30,2 % auf einem schwachen dritten Platz, direkt verfolgt von überraschenden 26,1 % Einkäufen beim chinesischen Herausforderer "Temu". "Kaufland", "Etsy" und "AliExpress" sind weitgehend abgeschlagen.
Fragt man deutsche Verbraucher, was sie am chinesischen Marktplatz "Temu" besonders schätzen, gibt es klare Ansagen: Mit 82,8 % sehr guter und guter Bewertungen liegt die Produktvielfalt in Kategorien, wie Elektronik, Haus & Garten, Schmuck & Accessoires sowie Schönheit & Gesundheit unangefochten an der Spitze der Beliebtheitsskala, direkt gefolgt von 72,0 % positiver Beurteilung des Preis-Leistungs-Verhältnisses. Auf Platz 3 folgt mit 69,7 % positiver Beurteilungen die Bedienfreundlichkeit der App wie der Website von "Temu".
Perspektivisch sind die Empfehlungen unter "Friends & Family" besonders interessant für Online-Händler: Mit 58,3 % räumt auch hier der Luxemburger Ableger des US-Anbieters "Amazon" ab. Spannend: Mit 27,7 % Nennungen folgt auf Platz 2 bereits der chinesische Billig-Anbieter "Temu", gefolgt von "Ebay" mit 20,9 %. Der Hamburger Marktplatz "Otto.de" ist mit 14,7 % Nennungen abgeschlagen. Die anderen Anbieter folgen mit 10 % Empfehlungsrate oder weniger.
-
91 % der Deutschen wünschen sich freie Berichterstattung fernab rot-grüner Hamburger Anmaßungen.
 |
Der Hamburger SPD-Funkionär griff HANSEVALLEY mit einem illealgen Shitstorn an.
(Foto: Pressefoto: Tom Medici für NMA) |
Berlin, 06.05.2024: Diffamierungen, Beschimpfungen und Bedrohungen – Journalisten werden zunehmend zur Zielscheibe politischer und gesellschaftlicher Auseinandersetzungen. Das musste auch HANSEVALLEY mit Hamburger SPD-Funktionären erleben. Die weit überwiegende Mehrheit der Menschen in Deutschland steht aber klar hinter unabhängiger und freier Berichterstattung und will diese erhalten.
So bezeichnen in einer repräsentativen Befragung des Digitalverbands Bitkom unter 1.002 Internetnutzern ab 16 Jahren 91 % die Pressefreiheit als hohes Gut, das es unbedingt zu schützen gilt. Das teilte der Digitalverband Bitkom anlässlich des internationalen Tags der Pressefreiheit (World Press Freedom Day) am vergangenen Freitag mit.
„Pressefreiheit ist ein hohes Gut und wir müssen sie auch im Netz und in den digitalen Medien schützen und stärken. Attacken auf Journalistinnen und Journalisten sind eine direkte Gefahr nicht nur für die betroffenen Personen, sondern für unsere meinungspluralistische Gesellschaft insgesamt“, sagt Bitkom-Hauptgeschäftsführer Dr. Bernhard Rohleder. „Die Pressefreiheit und die Grundidee des freien Internets sind eng miteinander verbunden.“
86 % der Internetnutzer wünschen sich, dass Debatten im Internet respektvoller geführt werden. 70 % empfinden den Ton in Kommentarspalten bei Nachrichten im Internet oft als zu aggressiv. HANSEVALLEY-Chefredakteur Thomas Keup dazu: "Journalismus ist nicht nur Beobachten, Bewerten und Berichten. Es ist auch Einordnen und Kritisieren, wenn z. B. Parteifunktionäre und ihre Kostgänger unliebsame Meinungen mit Nazivorwürfen versuchen zu stigmatisieren, mit Shitstorms versuchen zu vernichten oder mit Cancel Culture versuchen ausgrenzen. Das sind dann auch rot und grün lackierte Anwandlungen von Diktatur."
-
IHK fordert für Niedersachen mehr Anstrengung vor allem bei der Digitalisierung der Verwaltung.
.jpg) |
Im Vergleich zu den anderen Nordländern ist Niedersachsen überall nur so mittel.
Grafik: Bitkom |
Hannover, 24.04.2024: Das größte norddeutsche Bundesland - Niedersachsen - liegt bei der Digitalisierung im Vergleich der 16 Länder nur auf einem mittelmäßigen 10. Platz. Das Ergebnis des "Bitkom Länderindex 2024" kritisiert die IHK Niedersachsen. Die Hauptgeschäftsführerinnen bemängeln vor allem die Digitalisierung der Verwaltung auf Landes- und Kommunalebene sowie die Ausbildung von IT-Fachkräften im Land.
Während Niedersachsen bei der "Digitalen Infrastruktur“ mit 5G, Breitband- und Glasfaser-Vernetzung mittlerweile einen guten vierten Platz belegt und das Themenfeld "Digitale Gesellschaft“ auf Platz sechs rangiert, bleibt das Land in der Kategorie "Digitale Wirtschaft“ (Platz 11), vor allem jedoch bei "Governance & digitale Verwaltung“ als zwölfter hinter den Erwartungen der niedersächsischen Wirtschaft zurück.
Die IHK Niedersachsen fordert die Landesregierung auf, die Digitalisierung der Verwaltung aktiver zu steuern. Hierfür könnten Tools entwickelt und den Kommunen als Anwendung oder mit einer offenen Schnittstelle zur Verfügung gestellt werden. Dies würde den Prozess einerseits beschleunigen und einen digitalen Flickenteppich unterschiedlicher kommunaler Lösungen verhindern. Zudem könnte ein landesweites Service-Portal geschaffen werden.
Michael Wilkens, IHKN-Sprecher für Digitalisierung, bringt auf den Punkt: „70 Prozent der niedersächsischen Unternehmen bewerten die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung als maximal ausreichend bis mangelhaft. Das ist ein erschreckendes Ergebnis, insbesondere wenn Unternehmen in die Digitalisierung ihrer Prozesse investieren und dann wieder ausgedruckte Formulare bei der Behörde einreichen müssen.“
Wilkens bezieht sich dabei auf die "DIHK-Digitalisierungsumfrage 2023", die Anfang des Jahres veröffentlicht wurde und eine große Unzufriedenheit der befragten Unternehmen mit dem Digitalisierungsstandard der öffentlichen Verwaltung aufgezeigt hat. „Während Niedersachsen bei der digitalen Infrastruktur langsam, aber sicher auf einem guten Weg ist, besteht bei der Digitalisierung der Verwaltung weiterhin Aufholpotential“, so Wilkens weiter. “Niedersachsen zeigt bei der Digitalisierung weiterhin Licht und Schatten. Auf dem herausfordernden Weg an die Spitze ist Niedersachsen bislang nur Durchschnitt. Eine Führungsrolle des Landes ist derzeit nicht erkennbar“, kommentieren Monika Scherf und Maike Bielfeldt, Hauptgeschäftsführerinnen der IHK Niedersachsen (IHKN), die neuesten Ergebnisse des" Bitkom Länderindexes 2024".
Detail-Auswertungen zu allen 16 Bundesländern inklusive Stärken und Herausforderungen in den vier Teilkategorien des "Länderindex 2024" sind online beim Bitkom abrufbar. -
Umstrittenes Hamburger KI-Video zu drohendem AfD-Szenario für Deutschland floppt auf YouTube.
 |
Kleines Mädchen und enttäuschte Oma sollen gegen die AfD Stimmung machen.
(Bild: YouTube/Ponywurst Production, Screenshot: HANSEVALLEY) |
Hamburg, 23.04.2024: Das an Alster und Elbe federführend produzierte Polit-Fantasie-Video "Oma, was war noch einmal dieses Deutschland" hat knapp zwei Wochen nach der Veröffentlichung erst gut 360.000 Aufrufe auf "YouTube" zu verzeichnen. Erfolgreiche Videos erreichen hingegen binnen Tagen Millionen Zuschauer. Die drei verantwortlichen Macher des links-grünen Droh-Szenarios einer Bundesrepublik als heruntergewirtschafteter Diktatur unter Herrschaft der "Blauen" (als verwendetes Synonym für die AfD) lässt absichtlich keine Kommentare oder Bewertungen (Likes bzw. Dislikes) auf der an sich offenen "Google"-Videoplattform zu. Damit entziehen sich die drei verantwortlichen Produzenten - der Ex-Flugbegleiter, Ex-Pokerturnier-Veranstalter und linke Podcaster Andreas Loff, der gebürtige Iraner, wegen schwerer Körperverletzung Vorbestrafte, Palästinenser-Anhänger und linke Schriftsteller Behzad Karim Khani sowie der Männer-Coach, Yoga-Leher und linke Filmemacher Christian Suhr der öffentlichen Diskussion über das von der Hamburger Produktion "Ponywurst" mit generativer KI produzierte Polit-Märchen.
Das Video setzt die mehr als 40 % ausländischen Tatverdächtigen gemäß aktueller Kriminalstatistik, die in 2022 56.000 registrierten illegalen und allein 2023 4.000 abgelehnten und zur Ausreise verpflichteten Einwanderer mit fast 14 Mio. Ausländern im Zentralregister - darunter Millionen integrationswilliger und -fähiger Ausländer, wie iranische Ärzte und türkische Gemüsehändler - gleich. Erneut wird das Treffen konservativer und rechtsorientierter Teilnehmer des "Düsseldorfer Kreises" in der Potsdamer "Adlon-Villa" aka "Wannseekonferenz 2.0" rhetorisch als Ausgangspunkt von vermeintlichen "Deportationen" missbraucht, um nach Möglichkeit einen neuen Sturm der Entrüstung zu produzieren.
Um dem - in einer politisch-korrekten Öko-Umgebung des Jahres 2060 spielenden - Science-Fiction-Szenario eine vermeintlich gesellschaftlich breite Akzeptanz zuzuschreiben, wird das Video gemäß Abspann u. a. vom laut Kritikern Christen verspottenden Comedian Atze Schröder, dem umstrittenen linken Polit-Entertainer Micky Beisenherz, dem American-Football-Kenner Patrick Esume und dem wegen einer mutmaßlichen Vergewaltigung seiner Ex-Freundin in die Schlagzeilen geratenen Comedian Luke Mockridge unterstützt.
Die öffentliche Diskussion hat der zeitkritische NRW-YouTuber "Dome König" auf seinem YouTube-Channel "Mad in Germany" übernommen. In den Kommentaren seiner kritischen Auseinandersetzung mit dem rd. 3:30 Minuten langen Weltuntergangs-Szenario einer vermeintlich von allen Ausländern per unterstellter "Deportation" aka Remigration bereinigten Bundesrepublik machen sich die Zuschauer offen und kritisch Luft, da die Macher dies auf ihrem Video-Account verbieten. Zahlreiche Kommentare auf der Seite des YouTubers Dominik gehen gezielt auf die Problematik ungewollten Massen-Zuzugs in die Sozialsysteme - vornehmlich junger, nicht integrierbarer Männer aus arabischen Ländern mit islamischer Religion und ohne Schul- bzw. Berufsausbildung in den deutschen Städten - ein. Ein Nutzer bringt die Befürchtungen nicht nur von AfD-Wählern auf den Punkt: "Frankfurt hat ein Migrationsanteil von über 50% und Offenbach über 60%". Ein passendes sarkastisches Zitat dazu lautet: "Wir brauchen halt Bevölkerungsaustausch, dringend!" Ein anderes Zitat pointiert: "Meine Nachbarn - alles gute Fachkräfte - verstehen meine Sprache nicht."
Dazu passt die aktuelle Veröffentlichung des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen: Danach stimmten 67,8 % der bereits 2022 befragten mehr als 8.500 Schüler neunter Klassen im "Niedersachsen Survey" - darunter 300 Muslime - der Aussage zu: „Die Regeln des Korans sind mir wichtiger als die Gesetze in Deutschland.“ Zudem gab beinahe die Hälfte (45,8 %) an, ein islamischer Gottesstaat sei die beste Staatsform, zitiert die konservative Wochenzeitung "Junge Freiheit" die repräsentativen Daten aus Hannover. Hamburgs SPD-Schulsenatorin Ksenija Bekeris nannte die Ergebnisse der Auswertung gegenüber "Bild" „alarmierend“. Ein YouTuber vergleicht das per KI-generierte "Horror-Szenario" eines vermeintlich menschenleeren und verödeten Deutschlands mit der aktuellen Politik der Berliner Ampel: "Ich dachte, es ginge um die Deindustrialisierung Deutschlands, also die Folgen des Grünen Programms." Auf die aktuelle Lage durch Grüne Ideologie und Grenzverschiebung der Meinungsfreiheit verängstige Bundesbürger sagt ein "YouTube"-Nutzer: "Wenn der Faschismus wiederkehrt, wird er nicht sagen: ‹Ich bin der Faschismus›. Nein, er wird sagen: ‹Ich bin der Antifaschismus›"
"Zeit"-Kulturredakteur Johannes Schneider warnt in einem Kommentar der links-liberalen Wochenzeitung vor derart produzierten, "despotisch" anmutenden Filmen zu vermeintlicher "Deportation" aka "Exodus", daraus folgendem Fachkräftemangel, mutmaßlicher Bildungskatastrophe, fehlenden Ärzten, Massenverelendung, einer verwüsteten Synagoge, Nazi-Vergleichen über funktionierende Autobahnen, Gleichschaltung von Medien und Politik sowie einer angedeuteten "Höcke-Wahlsiegerpose": "solche Schreckensbilder können der AfD in die Hände spielen". Die "YouTube"-Nutzerin @anjamueller2126 bringt auf den Punkt: "Wer die Bewertung und Kommentare ausschaltet, der hat Angst vor der Wahrheit." Das Video "Oma, was war nochmal dieses Deutschland" ist auf "YouTube" veröffentlicht, die offene Kritik des YouTubers "Dome König" und zahlreicher Onliner-User ist hier zu finden. -
Hamburger Senat rechnet sich kaum beteutenden Fintech-Standort schön.
 |
In Hamburg weiß man, wie man aus wenig mehr machen kann.
(Grafik: Finanzplatz Hamburg) |
Hamburg, 12.04.2024: Die Finanzbehörde der Freien und Hansestadt und der Branchenverein "Finanzplatz Hamburg" bei der Handelskammer haben in einer aktuellen Mitteilung den Fintech-Standort mit mehr als 100 Unternehmen an Alster und Elbe angegeben. Als Grund für die vermeintlich positive Entwicklung wird u. a. das seit 2022 laufende, städtische Förderprogramm "InnoFinTech" der staatlichen Förderbank "IFB" ins Feld geführt. 20 der gelisteten "Fintechs" hätten Geld aus dem öffentlichen Fördertopf bekommen.
Tatsächlich hat der Finanzplatz an der Elbe in den vergangenen Jahren massiv an Bedeutung verloren, da Banken in erhebliche Schieflage geraten sind (z. B. "HSH Nordbank"/"HCB", "M. M. Warburg", "Varengold") oder Startups fusionierten oder vom Markt verschwanden (z. B. "Deposit Solutions"/"Raisin"). Laut HANSEVALLEY-Rhein/Main-Korrespondentin wird der "Finanzplatz Hamburg" am Bankenstandort Frankfurt praktisch nicht wahrgenommen.
Die Listung des sogenannten "Fintech-Monitors" führt mit Stand März 2024 auch Firmen auf, die in anderen Städten beheimatet sind, außerhalb Hamburgs entwickeln und vermarkten, den größten Teil ihres Geschäfts außerhalb Hamburgs erzielen oder zu etablierten, teils Finanz-fernen Branchen gehören. Als Beispiele können u. a. genannt werden:
Bundesweite Aktivitäten:
- "Finanzcheck.de" - Der Kreditvermittler hat vor Jahren seine Eigenständigkeit verloren und gehört zu "Smava" in Berlin
- "Raisin" - Das Startup sitzt mit Headquarter und Vorstand in Berlin, die angeschlossene Bank sitzt in Frankfurt/Main
- "WebID" - Der Identity-Provider hat seinen Hauptsitz in Berlin und weltweit, u. a. auch in München und Hamburg
Bankeigene Aktivitäten:
- "Ownly" und "Warburg Navigator" - Beide Banking-Apps sind Konzern-Beteiligungen der etablierten "Warburg"-Bank
- "StarFinanz" - Die Software-Schmiede der Sparkassen-IT-Gesellschaft "FI" ist für die Sparkassen-Apps zuständig
Branchenfremde Aktivitäten:
- "Collect AI" - Der digitale Inkassodienst ist eine Digital-Tochter des "Otto"-eigenen Inkassodienstes "EOS".
- "Otto Payments" - Der Zahlungsdienstleister betreut vor allem die Zahlungsabwicklung des "Otto"-Versandhandels
Bis vor Kurzem listete die zweifelhafte Aufstellung von Senat und Handelskammer sogar noch die "Comdirect" auf, obwohl diese in Quickborn und nicht in Hamburg aktiv ist und nur noch als Endkunden-Abteilung der "Commerzbank" aus Frankfurt/Main dient. Zudem ist offen, wie viele der gelisteten Startups überhaupt noch geschäftlich aktiv sind oder als "Lebende Tote" angesehen werden müssen.
Eberhard Sautter, Vorstandsvorsitzender Finanzplatz Hamburg e. V., jubelt den zweitklassigen Finanzstandort dennoch hoch: „Die lebendige Fintech-Szene in Hamburg ist ein Zeichen für die Vitalität unseres Finanzplatzes. Schon seit vielen Jahren legen wir als Verein, etwa mit unserer Marke Fintech Hamburg, einen Fokus auf die Stärkung der Innovationsförderung in unserer Branche und nehmen laufend neue Akteure in unser Netzwerk auf. Das InnoFinTech-Programm trägt mit attraktiven Förderkonditionen zur positiven Entwicklung des Standorts bei.“
Mit dem im Rahmen einer 1,3 Mio. €-Anschubfinanzierung im Frühjahr 2021 initiierten Wirtschaftscluster lässt sich die seit Jahren schrumpfende Banken- und Versicherungsbranche an Alster und Elbe ihre Marketing-Aktivitäten direkt mit einer millionenschweren Subvention durch den Steuerzahler finanzieren. Damit ist die Branchenvertretung der Finanzbranche an Alster und Elbe finanziell und politisch abhängig vom rot-grünen Senat.
-
Hamburger Distanzhändler Otto verliert in einem Jahr weitere 320 Mio. Euro Handelsumsatz.
 |
Otto.de ist und bleibt eine Baustelle des Familienkonglomerats
(Foto: HANSEVALLEY) |
Hamburg, 11.04.2024: Der Umsatz des größten in Deutschland ansässigen Online-Händlers - "Otto.de" - ist im abgelaufenen Geschäftsjahr 2023/24 mit Stichtag 29.02.2024 laut Statista um weitere 320 Mio. € bzw. 8 % eingebrochen und bei 4,2 Mrd. € gelandet. Bereits im Geschäftsjahr 2022/2023 musste der umstrittene Handelskonzern einen Wegbruch des Geschäfts mit Bekleidung, Möbeln und Waschmaschinen um mehr als 600 Mio. € bzw. fast 12 % auf 4,52 Mrd. € hinnehmen. Damit ist es dem Distanzhändler nicht gelungen, den Abwärtstrend seines Geschäfts seit dem Corona-Sondereffekt von 5,124 Mrd. € im Geschäftsjahr 2021/2022 zu stoppen.
Der als teuer und konservativ geltende Online-Händler konnte die Geschäftszahlen seines Stammgeschäftes nur durch das seit 2020 aktive Marktplatzmodell retten. So erreichte "Otto.de" inkl. seiner Marktplatzhändler einen Gesamtumsatz von 6,5 Mrd. € - womit 2,3 Mrd. € auf Provisionen und Gebühren mit Drittanbietern auf "Otto.de" entfallen. Im Vorjahreszeitraum 2022/2023 erreichte der deutsche Versandhändler inkl. Marktplatzanteil 6,2 Mrd. €. Damit stieg das Geschäft mit jetzt gut 6.500 Händlern auf der Plattform in einem Jahr nur um 2 % - verlor allerdings zum Corona-Spitzenjahr 2021/2022 gut 400 Mio. €.
Das Problem: Das Stammhaus "Otto.de" ist das größte "Asset" im Handelsbereich des Familienkonglomerats aus Handel (u. a. "About You", "Baur", "Heine", "Otto", "Schwab" und "Witt"), Versand ("Hermes") und Inkassodienst ("EOS"). Bei 10,8 Mrd. € nationalem und internationalem Gesamtumsatz der Handelssparte macht das deutsche Kerngeschäft allein 40 % aus. Im Gegensatz zu "Otto" konnte der amerikanische Kontrahent und Marktführer "Amazon EU" im vergangenen Jahr einen Umsatz in Deutschland i. H. v. umgerechnet 34,9 Mrd. € erzielen - über 30 Mrd. € mehr, als die Geschäfte von "Otto.de" ohne Marktplatz. Damit wächst der Abstand beim Umsatz zwischen "Amazon" und "Otto.de" auf mehr als 8:1.
Die "Otto-Group" ist aus dem vorangegangenen Geschäftsjahr 2022/2023 mit 413 Mio. € Minus gegangen und hatte die Gesamtverschuldung von 714 Mrd.€ auf 2,81 Mrd. € vervierfacht. Die milliardenschweren Schulden machen dem Familienunternehmen schwer zu schaffen. Zudem wurden bereits nach den schlechten Zahlen im vergangenen Jahr Stellenkürzungen im Bereich Marketing angekündigt. Jetzt regiert auf dem "Otto-Campus" in Hamburg ein rigoroser Rotstift. Der Konzern will seine Gesamtzahlen erst Ende Mai d. J. veröffentlichen.
Ein Beitrag zum zur aktuellen Geschäftsentwicklung ist u. a. bei den Kollegen von "Channel Partner" nachzulesen. -
Betroffene Mutter verklagt Schulleiter und Polizei nach "Schlumpf-Skandal" von Ribnitz-Damgarten.
 |
Der Schlumpf-Sklandal geht jetzt vor Gericht.
(Grafik: Twitter Karikatur - @PolitikNote6) |
Greifswald, 10.04.2024: Der "Schlumpf-Skandal" um die 16-jährige Loretta B. aus Ribnitz-Damgarten hat ein gerichtliches Nachspiel. Die Mutter der Gymnasiastin lässt vor dem zuständigen Verwaltungsgericht in Greifswald klären, ob der übereifrige, politisch nicht neutrale Direktor des Richard-Wossidlo-Gymnasiums die TikTokerin während des Chemie-Unterrichts aus der Schulklasse holen durfte, um sie einer Gefährderansprache durch drei uniformierte Polizeibeamte aus Stralsund auszusetzen. Das meldet die Berliner Wochenzeitung "Junge Freiheit".
Anett B. will richterlich feststellen lassen, dass die europaweit massive Kritik ausgelöste Aktion nach einem AfD-freundlichen Schlumpf-Spot illegal war. Schulleiter Jan-Dirk Zimmermann hatte nach einer denunzierenden E-Mail und Anweisungen des Bildungsministeriums in Schwerin eigenständig die Polizei gerufen, die die Schülerin durch die halbe Schule geleitete. Die Mutter der Schülerin wurde von dem Lehrer hingegen nicht informiert, kritisierten u. a. "FAZ", "NZZ" und "Welt".
Die Familie wird vor dem Verwaltungsgericht von dem Kölner Verfassungsrechtler Prof. Ralf Stark aus Köln vertreten. Dieser hat erklärt, dass die Aktivitäten von Schulleiter und Polizeibeamten rechtswidrig sind, "weil sie zum einen grob unverhältnismäßig seien, zum anderen bereits Zweifel an dem Vorliegen der gesetzlichen Tatbestandsvoraussetzungen bestehen.“ Juristisches Mittel ist die Fortsetzungsfeststellungsklage, mit denen die Maßnahmen von Schulleiter und Polizei als illegal festgestellt werden sollen.
„Es ist wichtig, dass meiner Tochter hier Gerechtigkeit widerfährt, denn sie hat nichts Strafbares getan, und sowohl das Innen- als auch das Bildungsministerium haben das Verhalten der Polizei und des Schulleiters immer wieder verteidigt“, so die Mutter. Der stellvertretende AfD-Fraktionsvorsitzende im Schweriner Landtag, Enrico Schult, sagte: „Wir als AfD-Fraktion begrüßen die gerichtliche Klarstellung, auch um Rechtssicherheit für künftige Fälle und für alle Eltern zu erlangen.“
Für den Landespolitiker geht es bei der juristischen Klärung um eine zentrale Frage: „Wie weit darf der Staat in dem Schutzraum Schule eigentlich gehen und in Grundrechte der Kinder und Eltern eingreifen?“ AfD, CDU und FDP im Landtag hatten das Bildungsministerium einhellig kritisiert, die von Schulleiter Zimmermann zitierte Anweisung den Abgeordneten des Landes vorzuenthalten. Bleibt die Frage, ob die zuständigen Minister von Innen- und Bildungsministerium nach einem Urteil Konsequenzen aus dem "Schlumpf-Skandal" ziehen.
Ein ausführlicher Beitrag zum Thema ist in der "Jungen Freiheit" nachzulesen. -
Grüne im Kreistag von Vorpommern-Rügen versuchen, Landrat nach Kritik an der "Schlumpf-Verfolgung" in die Nazi-Ecke zu stellen.
 |
Landrat Stefan Kerth wird von den Grünen im Kreistag in die Nazi-Ecke gestellt.
Foto: Landkreis Vorpommern-Rügen |
Stralsund, 28.03.2024: Der Streit um das ersichtlich unverhältnismäßige Verhalten des Schulleiters eines Gymnasiums in Ribnitz-Damgarten geht in eine neue Runde. Jetzt attackieren die Bündnisgrünen im Kreistag von Vorpommern-Rügen den aus der SPD-ausgetretenen Landrat Stefan Kerth (Foto) mit der "Nazi-Keule" und werfen ihm indirekt Unterstützung der zuvor von der Polizei in sozialen Medien ausgespähten 16-jährigen "TikTokerin" Loretta B. vor.
Jürgen Suhr, Fraktionsvorsitzender der Bündnisgrünen im Kreistag von Vorpommern-Rügen geht den parteilosen Landrat an und versucht diesen, indirekt abzustempeln: "Wir hätten erwartet, dass sich Herr Kerth klar gegen die zum Ausdruck gebrachte rechtsextremistische Haltung positioniert und den Schulleiter unterstützt. Es ist bedauerlich, dass dies nicht geschehen ist." Damit verfolgen die Grünen im Kreistag dieselbe Politik des Framings, wie die Bundespartei.
Der wegen der misslungenen Migrationspolitik und der daraus folgenden unveränderten Migrationswelle im vergangenen Jahr aus der SPD ausgetretene Landespolitiker Kerth hatte zur Aktion des Schulleiters, die Gymnasiastin während des Chemie-Unterrichts mit drei uniformierten Beamten aus dem Unterricht zu holen, um sie einer unverhältnismäßigen "Gefährderansprache" auszusetzen, gesagt: Dies " ist kein guter Tag in das Vertrauen in die Meinungsfreiheit und in die Menschen im öffentlichen Dienst."
Auf die von der nicht informierten Mutter Annett B. als "Stasischeiße" in verschiedenen Medien kritisierte Aktion auf Veranlassen des Schweriner Bildungsministeriums haben sich die Grünen im Kreistag erwartungsgemäß nicht kritisch geäußert und die "Stasi-ähnlichen" Methoden damit zumindest stillschweigend für gutgeheißen. Die SPD-eigene "Ostsee-Zeitung" hat die Kritik der Grünen ersichtlich ohne Gegenrecherche übernommen.
-
Schlumpf-Skandal entwickelt sich zum PR-Desaster für rot-rote Landesregierung in Schwerin.
 |
Ein übereifriger Schulleiter bring die Landesregierung in MV in Bedrängnis.
(Grafik: via @PolitikNote6, Twitter) |
Schwerin, 22.03.2024: Der "Schlumpf-Skandal" von Ribnitz-Damgarten schlägt weiter hohe Wellen. Am (gestrigen) Donnerstag (21.03.21) versuchten die Abgeordneten im Bildungsausschuss des Schweriner Landestages auf Antrag von AfD, CDU und FDP, über drei Stunden vom Links-geführten Bildungsministerium die Wahrheit zu dem massiven Polizeieinsatz gegen eine 16-jährige Schülerin im Richard-Wossidlo-Gymnasium in Damgarten herauszufinden.
Während die Mutter der Betroffenen - Annett B. - gegenüber dem Nachrichtenportal "Nius" erneut versicherte, dass in dem kritisierten "Vier-gegen-Eins"-Gespräch von Stralsunder Polizei und in der Kritik stehendem Schulleiter der harmlose AfD-Tiktok-Clip erörtert wurde, behauptet die Polizei seit dieser Woche, dass das Schlumpf-Video gar nicht Thema der offenbar überzogenen "Gefährderansprache" war.
Spindoktoren der rot-roten Landesregierung hatten der "Welt" Polizeiprotokolle zu Stasi-ähnlichen Aufzeichnungen zum vermeintlichen Verhalten der 16-jährigen Loretta B. gesteckt, durch die anhand des Logos "HH" der Bekleidungsmarke "Helly Hansen" durch Umdeutung in "Heil Hitler" der Gymnasiastin eine rechtsextreme Gesinnung unterstellt wurde. Gestern bekamen die Abgeordneten im Ausschuss neue Wunderlichkeiten mitgeteilt.
So wurde die Denunzierungs-Mail zunächst an eine ganz andere Schule geschickt, bevor die "Petz-Post" einen Tag vor der Polizeiaktion beim richtigen und angegangenen Schulleiter Jan-Dirk Zimmermann landete. Wann dieser die Mail las und warum er trotz frühzeitigem Empfang die betroffene Schülerin mit drei Beamten mitten aus dem Chemie-Unterricht holen ließ, konnte oder wollte das Bildungsministerium nicht aufklären.
Der bildungspolitische Sprecher der CDU-Fraktion im Landtag - Torsten Renz - brachte zur Sitzung auf den Punkt: "Unterlagen, die der Ausschuss angefordert hatte, wurden in großen Teilen gar nicht und in anderen Teilen erst nach mehreren Auszeiten und Rücksprachen während der heutigen Sitzung an die Ausschussmitglieder verteilt. Unklar ist auch nach wie vor, welche Handlungsoptionen oder –vorgaben für den Schulleiter existieren – die exakte Erlasslage ist noch immer nicht öffentlich bekannt."
Die bildungspolitische Sprecherin der FDP-Landtagsfraktion - Sabine Enseleit - stellte fest: Weil uns trotz meines Antrages die Anlagen zur Vorschrift zu Notfällen nicht zur Verfügung gestellt wurden, können wir die Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen nicht prüfen. Es bleibt also die drängende Frage, wie gewährleistet wird, dass das Vorgehen auch tatsächlich verhältnismäßig ist."
Der schulpolitische Sprecher der AfD-Landtagsfraktion - Enrico Schult - wurde konkreter: "Überhaupt nicht hilfreich ist, dass das Bildungsministerium ‚Fallkonstellationen‘ zu einem am 22.02.24 an alle Schulleitungen versandten Rundschreiben zurückhält, auf die sich der Schulleiter bezog und die klarstellen sollen, wie in vermeintlichen Gefährdungsfällen zu verfahren sei. Weshalb eigentlich? Enthalten diese Anlagen politisch akzentuierte Vorgaben?"
Der CDU-Bildungspolitiker fasst zusammen: "Ich habe heute den Eindruck gewonnen, dass die Ministerien dies mit voller Absicht tun. Offenbar waren sich Ministerin Oldenburg und Minister Pegel einig, dass die Nachfragen von alleine aufhören, wenn sie nur hartnäckig genug ignoriert werden, und dass das Thema auf diese Weise erst gar keine mediale Relevanz entfaltet. Ich stelle fest: Das glatte Gegenteil ist eingetreten."
-
Schlumpf-Skandal in MV:
Harmloser TikTok-Clip kriminalisiert 16-Jährige mit Gefährderansprache - NDR und Ostsee-Zeitung skandalisieren öffentliche Kritik an verantwortlichem Schulleiter.
Mutter Annett B: "Machen sich diese Leute eigentlich klar, was sie da tun?"
 |
In Ribnitz-Damgarten werden Schülerinnen auch für Schlumpf-Clips verfolgt.
(Foto: Marta Posemuckel, Pixabay) |
Ribnitz-Damgarten, 18.03.2024 - *Update*: Ein rechtlich unproblematischer Schlumpf-Clip auf "TikTok" sorgt im vorpommerschen Damgarten für einen Polizeieinsatz gegen eine 16-jährige Schülerin. Der Fall beschäftigt den Schweriner Landtag, das politische Berlin und schlägt hohe Wellen bis zu "Tesla"-Chef Elon Musk. Ein offensichtlich übereifriger, SPD-naher Schulleiter löst den "Schlumpf-Skandal" in vorauseilendem Gehorsam zur rot-roten Landesregierung aus. Der Staatsschutz ermittelt.
Am 27. Februar d. J. alarmiert der Rektor des Richard-Wossidlo-Gymnasiums in Ribnitz-Damgarten - Jan-Dirk Zimmermann - die Polizei wegen "Verbreitung mutmaßlich verfassungsfeindlicher Inhalte in sozialen Netzwerken". Drei uniformierte Beamte der zuständigen Polizeiinspektion Stralsund rücken daraufhin vor der Schule an - unter den Augen diverser Schüler hinter den Fensterscheiben des Neubaus. Im Visier: die 16-jährige Loretta B. Sie hatte Monate zuvor einen "Schlümpfe-Clip" auf dem Video-Netzwerk "TikTok" gepostet.
Damgartener Schülerin: "Deutschland ist Heimat, kein Ort."
Die Mutter der betroffenen und nun aktenkundig vorbelasteten Schülerin erklärt: "Da heißt es, dass die Schlümpfe und Deutschland etwas gemeinsam haben: Die Schlümpfe sind blau und Deutschland auch. Das war wohl ein witziger AfD-Werbe-Post. Und dann hat sie einmal gepostet, dass Deutschland kein Ort, sondern Heimat ist.“ Eine Tippgeberin meldet die junge "TikTokerin" wegen vermeindlich "extremistischer Posts", rechtfertigt sich der politisierende Schulleiter gegenüber der "Ostsee-Zeitung".
Elon Musk auf "X": "Ist das wirklich alles, was vorgefallen ist?“
Während Polizei und der - laut Medien SPD-nahe - Direktor beteuern, die Schülerin sei aus dem Unterricht gebeten und keine weiteren Personen involviert worden, schildert die Schülerin, dass die drei Uniformierten direkt vor der Klassentür standen und alle Mitschüler nach Aufruf ihres Namens durch den Schulleiter wussten, dass sie mit dem Polizeieinsatz gemeint war. Von den Uniformierten eskortiert wird die Gymnasiastin vom Chemieraum quer durch die halbe Schule zum Lehrerzimmer geführt - vorbei an den Augen der Schüler zweier Schulklassen höherer Jahrgänge im Atrium.
Mutter zieht Vergleich mit DDR-Diktatur: "Das ist Stasischeiße!"
Die Polizei stellt fest: Weder das Posten des AfD-Clips mit blauer "Statista"-Deutschlandkarte zu AfD-Wahlergebnissen aus Mai 2022 noch die persönliche Äußerung der Schülerin auf "TikTok" waren strafrechtlich relevant. Kein Anfangsverdacht. Dennoch unterziehen die Beamten die Schülerin einer "Gefährderansprache" - Personen vorbehalten, die die öffentliche Sicherheit gefährden könnten. Laut feingeschliffener Polizeimeldung ging es später nur darum, "sie vor möglichen Anfeindungen zu schützen, die sich aus ihren Aktivitäten in sozialen Netzwerken ergeben könnten".
Polizei Neubrandenburg: "ein politisch-extremistischer Vorfall"
Stralsunds Polizeisprecher Marcel Opitz brachte die - mit Zustimmung des Schulleiters und ohne Beteiligung der Eltern durchgeführte - "Gefährderansprache" als "normenverdeutlichendes Gespräch" dennoch unmissverständlich auf den Punkt. Eine Sprecherin der Neubrandenburger Polizei unterstreicht gegenüber dem "Stroer"-Nachrichtenportal "T-Online" die Polizeiaktion: "Schulleiter in Mecklenburg-Vorpommern sind offiziell dazu angehalten, bei politisch-extremistischen Vorfällen die Polizei zu informieren".
Klage der Mutter: "Die wussten vorher, dass es nicht strafbar ist."
Mutter Anett B. bringt dazu einen interessanten Hintergrund zur Sprache: „Und dann sagten die Polizisten zu meiner Tochter, dass zu ihrem eigenen Schutz die Beamten sie darum bitten möchten, solche Posts in Zukunft zu unterlassen. Die wussten also vorher, was meine Tochter gepostet hatte, sie wussten, dass es nicht strafbar war und trotzdem dieser Aufmarsch, diese Drohungen, diese Unterdrückungen der Meinungsfreiheit.“
Annett B. weist Minister-Verharmlosung zurück: "Das ist zynisch."
Polizeihauptkommissar Opitz versucht sich öffentlich zu verteidigen: Zwar sei dem Mädchen nichts vorzuwerfen, aber "gemäß Legalitätsprinzip galt es den Sachverhalt zu erforschen". Sein Dienstherr - SPD-Innenminister Christian Pegel - versuchte bei einer Aussprache im Schweriner Landtag am vergangenen Donnerstag, den Fall kleinzureden: „Ich glaube, dass die Verhältnismäßigkeit gewahrt war, weil man keine Festnahme, keine Handschellen, keine böse Ansprache gewählt hat“. Die Mutter kommentiert die Aussage mit den Worten: "Das ist zynisch."
Betroffene Schülerin: "die stechenden Blicke aller auf mir gespürt“
Die Schülerin ruft nach der Aktion aufgelöst ihre Mutter an: „Mama, du glaubst nicht, was mir passiert ist. Die Polizei war bei mir in der Schule und hat mich aus dem Unterricht abgeholt.“ Die Mutter der 16-jährigen Gymnasiastin findet gegenüber der - den Polizeieinsatz bundesweit bekanntmachenden - Berliner Wochenzeitung "Junge Freiheit" deutliche Worte zur Aktion des Schulleiters: „Das ist so eine heftige, mit Verlaub, Stasischeiße, ich hätte das in meinem ganzen Leben nicht für möglich gehalten, was meiner Tochter hier angetan wurde.“
Ostsee-Zeitung: "Stimmung der Unsicherheit und Verängstigung"
Der verantwortliche Schulleiter gibt der ihm politisch genehmen "Ostsee-Zeitung" ein Interview. Der Pädagoge fühlt sich gegenüber "OZ"-Chefreporter Michael Meyer durch Anfeindungen im Internet nun massiv bedroht. Der Reporter holt politisch mit vermeintlich "rechtsnationalen Posts" der Schülerin die Nazi-Keule raus. NDR MV-Politikreporter Stefan Ludmann skandalisiert die offene Kritik an Schulleiter Zimmermann als "Hetzkampagne" gegen die gesamte Schule. "T-Online" will eine "kampagenhafte Berichterstattung" "rechtspopulistischer Blogs" ausgemacht haben.
Polizeibeamter: auf Tiktok schon „zu viel Nationalstolz“ gezeigt
Die Mutter weigert sich, mit der SPD-eigenen "Ostsee-Zeitung" zu reden. Die Zeitung und ihr Chefreporter spekulieren daraufhin, dass sie AfD-Mitglied sein soll und zitiert nicht bestätigte Äußerungen von Lehrern der Schule zur vermeintlichen Gesinnung der Mutter. Eine Lehrkraft bringt gegenüber der Zeitung allerdings explizit zum Ausdruck, dass die Anzeige des in der Kritik stehenden Schulleiters bei der Polizei übertrieben gewesen sei.
Von Beamten eskortierte Loretta: "Zahlreiche Schüler waren Augenzeuge"
Das Bildungsministerium in Schwerin teilte mit, dass der Staatsschutz Ermittlungen wegen Drohanrufen und Schmäh-E-Mails eingeleitet habe. Das Polizeipräsidium in Neubrandenburg sprach auf "X" (vormals "Twitter") von "Hetze" gegen den offensichtlich politisch motiviert agierenden Schulleiter. Dieser zieht sich gegenüber der "OZ" auf eine „exakt vorgeschriebenen Schrittfolge“ bei Verdächtigungen zurück. Damit erhärtet sich der Verdacht, dass der Schulleiter auf Anweisung des Bildungsministeriums handelte.
Mutter Anett B: "Ich glaube, man wollte an ihr ein Exempel statuieren"
Mutter Anett B. gegenüber der "Jungen Freiheit": "Ich glaube, man wollte an ihr ein Exempel statuieren: „Schaut her, das machen wir mit Schülern, die politisch nicht in unserer Spur laufen!“ Die Mutter verweist auf eine Ausstellung der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung in der Aula des Gymnasiums zum Thema "Demokratie stärken" - vier Tage vor der Polizeiaktion. Der SPD-nahe Schulleiter Zimmermann schreibt auf der mittlerweile gesäuberten Homepage: "Am 23. Februar fand die Eröffnung in Anwesenheit eines Vertreters der Friedrich-Ebert-Stiftung MV, des Bürgermeisters der Stadt Ribnitz-Damgarten und Vertretern der Bürgerschaft statt“.
AfD-Bildungspolitiker: "Schulen zur Gesinnungsschnüffelei benutzt"
Der Vorfall an dem vorpommerschen Gymnasium spielt der AfD in die Hände: Landessprecher Leif-Erik Holm spricht von einem „Skandal“. Der bildungspolitische Sprecher der AfD-Fraktion im Landtag von MV und Vater zweier schulpflichtiger Kinder - Enrico Schult - springt der Mutter zur Seite: "... ein Schulleiter sollte sich eher vor seine Schüler stellen und mindestens zuerst die Eltern ins Vertrauen ziehen, anstatt gleich drei Polizisten zu rufen, weil er eine anonyme Denunziations-Mail über eine Schülerin erhält.“
Anzeige gegen SPD-nahen Lehrer wegen falscher Verdächtigung
AfD-Partei- und Fraktionsvorsitzende Alice Weidel befürchtet auf "X": „Diese Entwicklung ist erschreckend. Diejenigen, die den Schutz der Demokratie als Deckmantel missbrauchen, beschädigen selbige massiv.“ Bundestagsabgeordnete Beatrix von Storch erstattete laut Nachrichtenredaktion "RND" (ebenfalls "Madsack"/SPD-"DVVG") bei der Staatsanwaltschaft in Stralsund Strafanzeige gegen den aus Aachen stammenden Schulleiter - v. a. wegen des Verdachts der falschen Verdächtigung und der Nötigung. Thüringens AfD-Chef und Ex-Lehrer Björn Höcke will gegen den Schulleiter eine Dienstaufsichtsbeschwerde einreichen.
CDU-Fraktionschef Peters: "Das Ganze wirkt ungeheuerlich."
„Ich gehe davon aus, dass die Agenda von Frau Schwesigs rot-rotem Bündnis eine Rolle gespielt hat", fokussiert der designierte CDU-Fraktionsvorsitzende im Schweriner Landtag - Daniel Peters - die Polizeiaktion des Damgartener Schulleiters. Die Union kündigt an, das Thema in Sondersitzungen des Innen- und des Bildungsausschusses zu thematisieren. Auf der Tagesordnung steht die Frage, ob Bildungs- und Innenministerium Lehrer angeordnet haben, Schüler mit Polizeiaktionen einzuschüchtern, wenn diese andere politische Meinungen äußern, als die der rot-roten Landesregierung.
Der vom Geschwister-Scholl-Gymnasium in Aachen-Ost stammende Schulleiter Zimmermann hat sich bis heute für seine Aktion in dem von ihm geleiteten Gymnasium in Damgarten bei der - aufgrund des Polizeieinsatzes nun aktenkundigen - Schülerin und ihrer Mutter erkennbar nicht entschuldigt. Die offizielle Pressemitteilung der Polizeidirektion Stralsund ist hier nachzulesen. Ein Interview mit der Damgartener Schülerin und ihrer Mutter ist auf "Junge Freiheit" erschienen (Paywall). -
Linksfraktion nimmt unausgegorene Planungen für Informatikunterricht in Hamburg auseinander.
 |
In Hamburg soll Informatikunterricht u. a. mit Tablets ablaufen.
(Foto: Fran Innocenti, Unsplash) |
Hamburg, 11.03.2024: Nach den Sommerferien beginnt mit dem Schuljahr 2024/2025 in den siebenten Klassen acht weiterführender Hamburger Schulen der neu eingeführte Informatikunterricht als einjährige Pilotphase. Informatik wird künftig ab Jahrgangsstufe 7 mit mindestens vier Stunden pro Woche sowohl in Gymnasien als auch Stadteilschulen verbindlich unterrichtet. Die Linke in der Hamburger Bürgerschaft hat dem Senat zu den Planungen konkrete Fragen gestellt.
So sollen aktuell 340 Lehrerinnen und Lehrer in Hamburg für den Informatikunterricht bereitstehen. Außerdem sollen weitere Lehrer für den stadtweiten Unterricht qualifiziert werden. Allerdings weiß die zuständige Schulbehörde aktuell nicht, wie viele Lehrkräfte trainiert werden müssen. Bekannt ist lediglich, dass umgerechnet 187 Vollzeitstellen für den Informatik-Unterricht notwendig sind. Die werden jedoch nicht vor 2028/2029 vorhanden sein.
Die Einrichtung von Informatik-Lehrräumen wird schlichtweg den Schulen überlassen. Bei Endgeräten will der Senat in den 7. und 8. Klassen nur mit den in der Corona-Pandemie mit Bundesmitteln angeschafften Tablets arbeiten lassen und sieht Notebooks u. a. zum Programmieren erst ab Klasse 9 für erforderlich. Dem widerspricht die zuständige Expertin der Linkspartei in der Hamburgischen Bürgerschaft.
Die bildungspolitische Sprecherin - Sabine Boeddinghaus - geht mit den Planungen der SPD-geführten Schulbehörde hart ins Gericht: „Die Personaldecke für Informatik ist viel zu dünn. Sie mag für die Pilotphase ausreichen, aber erst drei Jahre nach der flächendeckenden Einführung geht die Schulbehörde davon aus, ausreichende Lehrkräfte zu haben."
Die Oppositionspolitikerin nimmt die Antworten des Senats auch im Detail auseinander: "Es fehlen Laptops und Standrechner. Mit Tablets braucht die Behörde gar nicht erst ankommen - ein effektiver Informatikunterricht ist mit ihnen nicht möglich, weil sie den nötigen Anforderungen nicht entsprechen. Auf ihre Zahl zu verweisen, ist aber auch irreführend: Sind die Geräte vorhanden, nutzbar, einsatzbereit? Das weiß die Behörde nicht."
Die Linkspartei wirft der Schulbehörde vor, blind für die Wirklichkeit in den Schulen zu sein - insbesondere mit der Annahme, Schulen mit einem niedrigen Sozialindex 4 und 5 seien als Pilotschulen geeignet, für alle Hamburger Schulen als Blaupause gelten zu können. Die sozial problematischen Schulen hätten Besseres zu tun, "als ihre Ressourcen für ein unausgereiftes Glitzerfach der Schulbehörde zu verwenden.“
Die Antwort des Senats auf die Anfrage der Linksfraktion kann hier eingesehen werden. -
Selbsternannte Digitalmetropole Hamburg betreibt noch immer fast 450 Faxmaschinen.
 |
Faxgeräte sind für den Hamburger Senat fast noch digitale Altagshelfer.
(Foto: Tumi-1983, Lizenz: GNU Free Documentation Licence) |
Hamburg, 08.03.2024: Die selbsternannte "Digitalcity Hamburg" hinkt bei der praktischen Digitalisierung der Verwaltung bis heute massiv hinterher. Eine kleine Anfrage des digitalpolitischen Sprechers der CDU-Fraktion in der Hamburger Bürgerschaft - Sandro Kappe - bringt zum Vorschein: In den Hamburger Behörden und Betrieben werden bis heute noch fast 450 Faxgeräte betrieben.
Besonders rückständig ist die Innenbehörde des umstrittenen SPD-Innensenators Andy Grote: Bei der unterstellten Polizei mit rd. 8.000 Beschäftigten und vier Kommissariaten in der Hansestadt laufen aktuelle fast 340 Faxmaschinen. Damit ist die Innenbehörde die bis heute am meisten analog arbeitende Verwaltung an Alster und Elbe.
Auch in der Justiz sieht es nicht viel besser aus: 65 Faxgeräte leisten in der Justiz- und Verbraucherschutzbehörde nach wie vor ihren Dienst. Der Senat beteuert, die überalterte Technik unter Berücksichtigung "datenschutz-/rechtlicher, technischer und organisatorischer Möglichkeiten sukzessive abbauen" zu wollen. Für die CDU ist das Thema Digitalisierung im rot-grünen Tschentscher-Senat nicht angekommen.
Der CDU-Digitalexperte Sandro Kappe sagte gegenüber der Nachrichtenagentur "DPA": „Angesichts der fortschreitenden Digitalisierung und der Forderung nach effizienten Verwaltungsprozessen ist es schockierend, dass die Stadt Hamburg weiterhin auf veraltete Technologien wie Faxgeräte setzt.“
Der Christdemokrat liegt nach: „Noch schockierender ist, dass zwei Bezirksämter, die von der grünen Partei geführt werden, immer noch auf Faxgeräte setzen. Alle anderen haben diese bereits abgeschafft.“ Damit stehen die Bezirksämter Altona und Nord direkt am Pranger.
Von insgesamt 574 stadteigenen Leistungen, die theoretisch digitalisiert werden sollten, sind 26 % lediglich teilweise und alarmierende 22 % überhaupt nicht digitalisiert. Das Hamburg alles andere als digital führend ist, zeigt eine weitere Zahl:
Laut Applied AI Institute for Europe gibt es in der Startup-Hauptstadt Berlin aktuell stolze 165 Tech-Startups, die sich im Kern mit KI beschäftigen, in der Technologie-Hauptstadt München sind es satte 99. Die selbst erannte KI-Metropole Hamburg hinkt auch hier mit gerade einmal 41 Startups hoffnungslos hinterher.
Die kleine Anfrage der CDU-Fraktion und die Antworten des Senats zum Einsatz von Faxgeräten in der Hamburger Verwaltung kann hier nachgelesen werden. -
Betrieb des Hamburger Fernsehturms durch Karajica, Westermeyer & Co. bis jetzt ein Luftschloß.
 |
Seit 2001 passiert mit dem Sanierungsfall "Telemichel" nichts.
(Foto: Instagram/@pixbysven/@hamburgerfernsehtum) |
Hamburg, 08.03.2024: Die medial groß verkündeten Planungen für den Betrieb der Hamburger Fernsehturm-Plattformen durch den in wirtschaftliche Schwierigkeiten geratenen Hamburger Immobilien-Unternehmer Tomislav Karajica, den umstrittenen Veranstalter der Marketing-Massenveranstaltung "OMR" Philipp Westermeyer und den wirtschaftlich wenig erfolgreichen Hamburger Ex-Messechef Bernd Aufderheide lösen sich offensichtlich in Luft auf. Das hat die Linksfraktion in der Hamburger Bürgerschaft herausgefunden.
Ende Mai 2020 wurde der denkmalgeschützte "Heinrich-Hertz-Turm" durch die Eigentümerin "Deutsche Funkturm" ("Deutsche Telekom") an die drei stadtbekannten Geschäftsmacher und ihre "HH Tower Betriebsgesellschaft" für 20 Jahre mit großem Medienrummel verpachtet. Das Trio versprach im ehemaligen Fernsehturm-Restaurant u. a. Raum für Veranstaltungen gemeinnütziger Vereine und Organisationen, die sich keine kommerziellen Eventflächen leisten können.
Der rd. 280 Meter hohe und seit 2001 nicht mehr bewirtschaftete "Telemichel" sollte mit 37 Mio. € Steuermitteln von Bund (durch die umstrittene Grüne Kulturbeauftragte Claudia Roth) und die Stadt Hamburg (SPD-Kultursenator Carsten Brosda) unter Regie der "Deutschen Funkturm" saniert und mit Gastronomie und Veranstaltungen ab 2026 für die Öffentlichkeit wieder zugänglich gemacht werden. Die Zustimmung zur Sanierung stammt bereits aus dem Jahr 2017. Bislang flossen rd. 2 Mio. € an Architekten und Bauingenieure. Bis heute gibt es jedoch weder einen Bauantrag noch die aus Steuergeldern versprochene Sanierung.
Der Hamburger Senat redet sich in der Antwort an die Abgeordneten der Bürgerschaft mit der Corona-Pandemie als Ursache für die Verzögerungen heraus: "Bei der Sanierung des Heinrich-Hertz-Turms handelt es sich um einen komplexen Planungsprozess, der zudem durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie beeinflusst wurde." Bei der Sanierung und dem teilweisen Neubau des "CCH" der "Messe Hamburg" hat sich der Senat als Eigentümerin dieser Begründung nicht bedient.
Unteressen musste der stadtbekannte Immobilien-Magnat Karajica eine Reihe seiner Aktivitäten in den Konkurs schicken, darunter "Imvest Planen und Bauen" mit rd. 70 Mitarbeitern und den Online-Optiker "Edeloptics". Die geplante Sanierung der "Mundsburg-Tower" endete in einem Verkauf der Immobilie, der Umbau des ehemaligen "Telekom"-Tagungshotels "Rcadia" Bergedorf in ein Gaming-House wurde abgeblasen. Die Planungen für die 150 Mio. € teure Mehrzweckarena "Elbdome" in Rothenburgsort sind nicht weiter fortgeschritten. Die Firmenholding des Immobilienmagnaten wurde von "Home United" in "Think United" umgemünzt.
Die beiden "Telemichel"-Partner Bernd Aufderheide und Philipp Westermeyer scheinen unterdessen weiter Geschäfte miteinander machen zu wollen: Der pensionierte Ex-Chef der "Messe Hamburg" will jetzt den Marketing-Unternehmer bei der weiteren Expansion der "Online Marketing Rockstars" als Berater unterstützen. Das Marketing-Event "OMR" erwartet am 7. und 8. Mai d. J. in den Hamburger Messehallen nach eigenen PR-Angaben bis zu 70.000 Teilnehmer.
Die kleine Anfrage der Linken und die Antworten des Hamburger Senats können hier nachgelesen werden. -
Online-Händler Otto.de schmeißt nach schlechtem Jahr seinen Plattformchef raus.
 |
Der Gemischtwaren-Händler Otto.de wird zur Dauerbaustelle.
Foto: HANSEVALLEY |
Hamburg, 06.03.2024: Nach den schlechten Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2023/2024 hängt beim Hamburger Gemischtwaren-Händler "Otto.de" der Haussegen schief. Kurz nach einem schöngefärbten Pressegespräch zum Thema Umsatzentwicklung mit dem zuständigen Konzernvorstand für E-Commerce - Sebastian Klauke - hat das Hamburger Stammhaus den "Otto.de"-Bereichsvorstand für das Handels- und Plattform-Geschäft - Bodo Kipper - vor die Tür gesetzt.
Während die Gesamtumsätze der E-Commerce-Plattform "Otto.de" inkl. Partnerumsätzen über dem Vorjahreswert von 6,3 Mrd. € liegen sollen und dabei allein die 6.500 Händler auf dem Marktplatz aktuell über 2 Mrd. € umgesetzt haben, ist das Kerngeschäft des Bekleidungs-, Möbel- und Elektrohändlers "Otto.de" offensichtlich auf unter 4 Mrd. € eingebrochen, rechnet das Fachmagazin "Exciting Commerce" vor.
Damit ist der in Fachkreisen als teuer, langsam und überaltert geltende Händler nach gut 4,5 Mrd. € im Jahr 22/23 um über 500 Mio. € Umsatz bzw. mehr als 10 % weggebrochen. Das Problem: Das Stammhaus "Otto.de" ist das größte "Asset" im Handelsbereich des Familienkonglomerats. Bei 10,8 Mrd. € nationalem und internationalem Gesamtumsatz der Handelsparte macht das deutsche Kerngeschäft allein 40 % aus.
Im Gegensatz zu "Otto" konnte der amerikanische Kontrahent und Marktführer "Amazon EU" im vergangenen Jahr einen Umsatz in Deutschland i. H. v. umgerechnet 34,9 Mrd. € erzielen - über 30 Mrd. € mehr, als die Geschäfte von "Otto.de" ohne das Marktplatz-Geschäft. Damit wächst der Abstand beim Umsatz zwischen "Amazon" und "Otto.de" auf mehr als 8:1.
Die "Otto-Group" ist aus dem vorangegangenen Geschäftsjahr 2022/2023 mit 413 Mio. € Minus gegangen und hatte die Gesamtverschuldung von 714 Mrd. auf 2,81 Mrd. € vervierfacht. Die milliardenschweren Schulden machen dem Familienunternehmen schwer zu schaffen. Zudem wurden bereits nach den schlechten Zahlen im vergangenen Jahr Stellenkürzungen im Bereich Marketing angekündigt. Jetzt regiert auf dem "Otto-Campus" in Hamburg ein rigoroser Rotstift:
So hat der "Otto-Verbund" einen konzernweiten Einstellungsstopp für alle Bereiche beschlossen, seine Werbebudgets im Handelsbereich zusammengestrichen, die Warenbevorratung reduziert und zum Unwillen der Kunden auch die Preise erhöht. Die Existenz des "Otto-Konzerns" scheint wie erwartet ernsthaft gefährdet zu sein. Die genauen Zahlen zum Geschäftsjahr 2023/2024 werden erst Ende Mai d. J. veröffentlicht.
-
Handelskonzern Otto verliert in der Krise weitere 9 Prozent Umsatz - Amazon gewinnt trotz Inflation 12 Prozent dazu.
 |
Die Sonne scheint schon lange nicht mehr über dem Otto-Campus in Bramfeld.
(Foto: Otto) |
Hamburg, 28.02.2024: Im zweiten Jahr in Folge bricht der deutsche Handels-Umsatz des Hamburger "Otto-Konzerns" um 9 % und mehr ein. Das am Donnerstag d. W. endende Geschäftsjahr 2023/2024 wird das Hamburger Familien-Konglomerat erneut mit tief roten Zahlen beenden. So ist der E-Commerce-Umsatz national und international zusammen in einem Jahr von 12 Mrd. € auf 10,8 Mrd. € eingebrochen. Im größten Teilmarkt Deutschland mit "Otto.de" und anderen Gesellschaften stürzte der Handels-Umsatz von 7,5 Mrd. auf 6,6 Mrd. noch einmal massiv ein.
Weiter abwärts geht es beim Hamburger Distanz-Händler generell in den Bereichen Mode + Accessoires sowie Home + Living. Mehr oder weniger stabil ist laut E-Commerce-Konzernvorstand Sebastian Klauke der Bereich Elektronik + Haushaltsgeräte. Als Hauptgrund nennen die Hamburger weiter sinkende Warenkörbe und eine höhere Sensibilität für günstigere Preise. Zugleich sollen die Kunden von "Otto", "Baur" & Co. ähnlich oft online shoppen, wie im vergangenen Jahr.
Die "Otto-Group" ist aus dem vorangegangenen Geschäftsjahr 2022/2023 mit 413 Mio. € Minus gegangen und hatte die Gesamtverschuldung von 714 Mrd. auf 2,81 Mrd. € vervierfacht. Die milliardenschweren Schulden machen dem Familienunternehmen schwer zu schaffen. Zudem wurden bereits nach den schlechten Zahlen im vergangenen Jahr Stellenkürzungen im Bereich Marketing angekündigt. Jetzt regiert auf dem "Otto-Campus" in Hamburg ein rigoroser Rotstift:
So hat der "Otto-Verbund" einen konzernweiten Einstellungsstopp für alle Bereiche beschlossen, seine Werbebudgets im Handelsbereich zusammengestrichen, die Warenbevorratung reduziert und zum Unwillen der Kunden auch die Preise erhöht. Die Existenz des "Otto-Konzerns" scheint wie erwartet ernsthaft gefährdet zu sein. Die genauen Zahlen zum Geschäftsjahr 2023/2024 werden erst Ende Mai d. J. veröffentlicht.
Zwar hat der größte Handelsbereich "Otto.de" mit nunmehr 17 Mio. Produkten und rd. 6.500 Partnern sein Marktplatzgeschäft weiter ausgebaut und liegt in der aktuellen Marktplatz-Studie von "Appinio" mit großem Abstand hinter den beiden direkten Marktplatz-Konkurrenten "Amazon" und "Ebay" (HANSEVALLEY berichtet am Donnerstag-Mittag). Finanziell haben die Hamburger davon jedoch kaum profitiert.
Im Gegensatz zu "Otto" konnte der amerikanische Kontrahent und Marktführer "Amazon EU" im vergangenen Jahr mit Stichtag 31.12.2023 einen Umsatz in Deutschland i. H. v. umgerechnet 34,9 Mrd. € erzielen - 28,3 Mrd. € mehr, als alle Handelsaktivitäten des "Otto-Konzerns" in Deutschland zusammen. Damit wächst der Abstand beim Umsatz zwischen "Amazon" und "Otto" auf mehr als 5:1.
Der im Original in Dollar ausgewiesene "Amazon"-Umsatz stieg trotz Inflation und kritisch höherer Verbraucherpreise in Deutschland gegenüber 2022 um satte 11,9 %, während die "Otto-Gruppe" noch einmal mehr als 9 % einbüßen musste. "Otto"-Konzernvorstand Klauke versuchte gegenüber Journalisten, die Lage zu relativieren. So läge "Otto" unter den vom E-Commerce-Branchenverband BEVH prognostizierten E-Commerce-Einbrüchen für 2023 von 11,8 %. Mit einer Erholung rechnet der Hamburger Händler allerdings auch frühestens 2025.
Eine weitergehende Meldung der "Otto Group"-Zahlen 2023/2024 ist auf den Presseseiten des Anbieters nachzulesen. Die Jahreszahlen 2023 von "Amazon" können im Börsenblatt nachvollzogen werden. -
FreeNow fordert ein Ende des ruinösen und kriminellen Mietwagen-Geschäfts.
 |
FreeNow-Deutschlandchef Mönch wehrt sich gegen krininelle Mietwagenbetreiber.
Foto: FreeNow |
Hamburg, 23.02.2024: Die führende deutsche Mobilitäts-Plattform - das Altonaer Vermittlungs-Unternehmen "FreeNow" - will das ruinöse Preisdumping im deutschen Mietwagen-Markt beenden und faire Bedingungen für Mietwagen-Betreiber als auch konkurrierende Taxi-Betriebe erreichen. Deutschland-Chef Alexander Mönch fordert dabei Veränderungen zugunsten beider Anbietergruppen des sogenannten "Ridehailings".
Aus Sicht von "FreeNow" sind Dumping-Preise mit bis zu 50 % Preisvorteil und mehr gegenüber der identischen Leistung von Taxen für Betreiber von Mietwagen nicht kostendeckend und damit ruinös. Die Folge sind illegale Fahrer ohne Lizenz, die z. T. unter Mindestlohn fahren, unversicherte Fahrzeuge oder kriminelle Aktivitäten, bei denen Mietwagen ohne Zulassung kurzfristig unterwegs sind, bis sie erwischt werden.
So existieren eine Reihe der Mietwagenbetriebe nur als Briefkastenfirmen und werden Fahrzeuge mit gefälschten Dokumenten bei den Vermittlungsplattformen angemeldet. Bei einer Anhörung im Berliner Abgeordnetenhaus forderte "FreeNow"-Deutschlandchef Mönch in dieser Woche ein gemeinsames Vorgehen aller in Deutschland aktiven Vermittlungsplattformen, um der geschäftsschädigenden Entwicklung Einhalt zu gebieten.
"FreeNow" bietet den Aufsichtsbehörden an, neu registrierte Mietwagen-Firmen prüfen zu lassen, ebenso wie bestehende Betriebe. Das Berliner Ordnungsamt "Labo" kann diese Prüfungen allerdings erst in Zukunft durchführen, wenn die neu zugesagte Fachabteilung als Aufsichtsbehörde mit sieben Mitarbeitern handlungsfähig ist. "Bolt" und "Uber" geben zum Vorschlag des Konkurrenten "FreeNow" für eine Prüfung der Mietwagenbetriebe keine Stellungnahme ab.
Für die mit regelmäßigen Rabatten werbenden Plattformen geht es in erster Linie um möglichst viele verfügbare Fahrzeuge, die Fahrten abwickeln. Mit jeder Buchung über die Plattform-Apps kassieren "Bolt" und "Uber" 15-20 % Provision. Dabei verschließen sie womöglich die Augen vor illegalen Mietwagenbetreibern. Wettbewerber "FreeNow" hat sich seinerseits im vergangenen Jahr aus dem ruinösen Geschäft großteils zurückgezogen und lobt auch keine Rabatte mehr für Fahrten mit Mietwagen aus.
Allein in Berlin geht es um ein Geschäft mit insgesamt rd. 4,500 Fahrzeugen. So sollen im Berliner Markt laut Aufsichtsbehörde "Labo" 20 % bzw. 1.000 der Wagen ohne eine gültige Konzession unterwegs sein. Der Berliner SPD-Verkehrsexperte Tino Schopf geht sogar von bis zu 2.000 illegalen Wagen aus, die von Billiger-Anbieter "Bold", der "BMW"- und "Daimler"-Tochter "FreeNow" (vormals "MyTaxi") und der US-Plattform "Uber" vermittelt werden.
"FreeNow" schlägt vor, über Mindestpreise und Preisspannen einen fairen Wettbewerb von Mietwagen- und Taxibetrieben zu erreichen. So sollen Taxen je nach Auslastung die Möglichkeit haben, vom gesetzlich vorgeschriebenen Preis bis zu 5 % nach unten und 20 % nach oben abweichen zu dürfen. Zugleich sollten die Taxipreise vor Fahrtantritt wie in München verbindlich festgelegt und transparent angegeben werden.
Für Mietwagen soll der Mindestpreis am unteren Ende der Taxikonditionen liegen, um Preisdumping zu verhindern. Damit sollen bei den Mietwagenfirmen Mindestlöhne gezahlt, Sozialabgaben sowie Steuern und Gebühren entrichtet, alle Fixkosten abgedeckt und ein Gewinn erwirtschaftet werden. Damit könnte illegalen Mietwagen-Betreibern das Handwerk gelegt werden, so "FreeNow"-Chef Alexander Mönch gegenüber HANSEVALLEY.
Langfristig geht es um die Reputation der Vermittlungsplattformen selbst. Ähnlich wie bei nicht sicherem Kinderspielzeug und nicht geprüften Elektrogeräten auf chinesischen Marktplätzen wie "Temu" fallen illegale und kriminelle Machenschaften am Ende den Plattformanbietern auf die Füße. Die "FreeNow"-Gesellschafter "BMW" und "Daimler" gehen hier entgegen den aggressiven Billiganbietern "Bolt" und "Uber" einen anderen Weg.
-
In der IT der Hamburger Staats- und Universitätsbibliothek geht es zu, wie bei Rempels unterm Sofa.
 |
Das Chaos in einem Serverraum der Hamburger "SUB".
(Fotos: Landesrechnungshof Hamburg) |
Hamburg, 22.02.2024: In der IT-Abteilung der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg - "SUB" - geht es nach Recherchen des Landesrechnungshofs zu, wie "bei Rempels unterm Sofa". Die Finanzkontrolleure stellten im Rahmen ihrer Fahndungen, Stichproben und Vor-Ort-Besichtigungen fest: Die in der Verantwortung der Wissenschaftsbehörde von Bürgermeisterin Katharina Fegebank stehende "Stabi" hat für Ihre IT mit insgesamt 109 Software-Programmen keinen vorgeschriebenen "BSI-Grundschutz" durchgeführt, heißt: Es gibt bislang keine systematische Planung und Umsetzung von Sicherheitsmaßnahmen für die IT der Universitäts-Bibliothek.
Schlimmer noch: 104 der 109 IT-Programme wurden vor ihrem Einsatz nicht ausreichend getestet - entgegen der Vorschriften der Freien und Hansestadt. Damit ist ein zuverlässiger, sicherer IT-Betrieb der Bibliothek nicht gewährleistet und die "Stabi" müsste ihre IT von Gesetzes wegen bis auf 5 getestete Programmen komplett abschalten. Das Chaos in der IT der Universitätseinrichtung geht noch weiter: Eine elektronische Zeiterfassung gibt es bei der größten Hamburger Bibliothek unter IT-Chef Jens Wonke-Stehle und seinen fast 10 verantwortlichen IT-Mitarbeitern bislang nicht.
Die Archivierung der Akten erfolgt in dem Hamburger Landesbetrieb laut Rechnungshof bis heute vollständig in Papierform. Für interne Prozesse wie Dienstanträge werden fast ausschließlich Umlaufmappen genutzt, wie sie zuletzt vor 10 Jahren beim Arbeitsamt zu finden waren. Der Rechnungshof hat die "SUB" explizit dafür kritisiert, keine bereits erprobten und in der Verwaltung der Hansestadt erfolgreich eingesetzten Programme für Zeiterfassung, Aktenführung, Archivierung oder Dokumentenmanagement zu nutzen.
 |
Statt Zutrittskontrolle und Sicherhheit ist dieser Serverraum ein wildes Lager.
(Fotos: Landesrechnungshof Hamburg) |
Was bei der mangelnden Nutzung von sicheren, geprüften Programmen beginnt, sieht in den Serverräumen der Staatsbibliothek nicht besser aus: So werden die Räume laut Begehung des Landesrechnungshofs als Bürolager missbraucht. Die Verkabelung von Servern ist ein wilder Kabelsalat, Server-Racks stehen offen Blenden, sind nicht verschlossen, hängen auf halb Acht oder sind schlichtweg nicht vorhanden, wie die Fotodokumentation der Rechnungsprüfer beweist. Obendrein kann jeder in der Serverräume rein und raus, da es keine Zugangskontrolle gibt.
Die Staats- und Universitätsbibliothek hat nach den festgestellten massiven Mängeln in der IT zugesichert, den Forderungen und Empfehlungen des Landesrechnungshofes nachzukommen und die erheblichen Missstände abzustellen. Den aktuellen Bericht 2024 des Landesrechnungshofes mit der Berichterstattung zum Chaos in der IT der "SUB" kann hier heruntergeladen werden. -
IHK-Mitglieder kritisieren mangelnde Digitalisierung in Mecklenburg-Vorpommern.
 |
Die Unternehmen in MV beurteilen die Digitalisierung der Verwaltung eher negativ.
Grafik: IHK MV |
Schwerin, 20.02.2024: Die Wirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern setzt die Digitalisierung aktiv um, z. B. zur Flexibilisierung des Arbeitens (zu 69 %), zu Qualitätssteigerungen (65 %) und für Kosteneinsparungen (61 %). Das geht aus der bundesweiten Digitalisierungs-Umfrage der Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) zusammen mit den IHKs in MV hervor. In Mecklenburg-Vorpommern beteiligten sich 275 Unternehmen.
Ein Drittel der Unternehmen verfügt trotz umfangreicher Fördermaßnahmen von Bund und Land noch immer nicht über eine ordentliche Breitbandversorgung. Nur für 16 Prozent der Unternehmen hat sich die Versorgungslage seit 2020 verbessert. Eine leistungsfähige Breitband-Internetversorgung ist laut IHK jedoch ein zentraler Standortfaktor.
Firmen müssen mit anderen Betrieben, Kunden und Verwaltungen vernetzt sein, um die Potenziale der Digitalisierung voll ausschöpfen zu können. Die IHKs in MV fordern deshalb insbesondere in den unterversorgten ländlichen Regionen die Priorisierung eines zeitnahen, flächendeckenden und bedarfsgerechten Ausbaus der Breitbandversorgung.
Als Haupthindernis der Digitalisierung benennen die Unternehmen in der Umfrage vor allem die fehlende Digitalisierung von Verwaltungsprozessen. Viele Verwaltungsvorgänge, die einen Informationsaustausch zwischen Unternehmen und Verwaltung erfordern, sind trotz gesetzlicher Vorgaben aus dem Online-Zugangsgesetz in MV bis heute nicht digitalisiert.
Zahlreiche Informationen müssen für Verwaltungen noch immer mehrfach handisch bereitgestellt werden, klagen die Betriebe im Nord-Osten. So ist es nicht verwunderlich, dass der Stand der Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung von über zwei Dritteln der Unternehmen mit der Schulnote 4 und schlechter bewertet wird.
Klaus-Jürgen Strupp, Präsident der IHK zu Rostock zieht aus den Umfrageergebnissen den Schluss: „Klares Ziel muss eine vollständige und flächendeckende Vernetzung der Verwaltungen sein. Einmal erhobene Daten müssen auch für andere Verwaltungseinrichtungen verfügbar sein. Dies gilt auf kommunaler Ebene, aber auch auf den Ebenen Land und Bund.“
Alle Ergebnisse der Digitalisierungsumfrage für MV gibt es auf den Seiten der IHK. -
Bundesländer fordern Stopp der Sklaverei bei den Paketdiensten.
 |
Weihnachten landen in einem Paketwagen 300 Sendungen und mehr.
Foto: DHL |
Hannover, 14.02.2024: Der Bundesrat hat am Freitag vor einer Woche (02.02.2024) umfangreiche Änderungen am Postrechtsmodernisierungsgesetz gefordert, um verbesserte Arbeitsbedingungen für Paketzusteller zu erreichen. Der Beschluss der Länderkammer sieht ein Verbot zum Einsatz von Subunternehmen sowie zur Nutzung von Werkverträgen vor. Niedersachsen hat die Initiative vorangetrieben, da sich die Arbeits- und Entgeltbedingungen für Beschäftigte in Kurier-, Express- und Paketdiensten immer weiter verschlechtert haben.
Die Änderungen beim Postrechtsmodernisierungsgesetz sehen neben Werkvertragsverbot und sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung zu Tarifbedingungen vor, weitere Arbeitsschutzmaßnahmen einzuführen. So wird durch die Länder eine Kennzeichnungspflicht für mittelschwere und schwere Pakete angestrebt. Niedersachsen fordert mit den anderen Ländern außerdem, dass Pakete über 20 Kilogramm künftig nur durch eine Person zugestellt werden dürfen, wenn geeignete technische Hilfsmittel zum Transport zur Verfügung gestellt werden oder eine zweite Person unterstützt.
Niedersachsens Arbeitsminister Andreas Philippi bringt auf den Punkt: „Die Länder haben heute sehr deutlich gemacht, dass sie die schlechten Arbeitsbedingungen für Paketboten nicht länger akzeptieren möchten. Ich freue mich über diese klare Botschaft. Ich fordere die Bundesregierung nachdrücklich auf, die Änderungswünsche im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu berücksichtigen. Es kann nicht sein, dass hart arbeitende Menschen von Unternehmen, deren Subunternehmen oder deren Sub-Subunternehmen um ihre Arbeitnehmerrechte gebracht werden. Gute Arbeit muss für alle gelten und nicht nur für die Meisten."
-
Hamburger Datenschutzbeauftragter verklagt HHLA wegen verweigerter Pflichtauskünfte.
 |
Der Hamburger Terminalbetreiber HHLA nimmt es mit der Offenheit nicht so genau.
(Foto: HANSEVALLEY) |
Hamburg, 08.02.2024: Der Datenschutzbeauftragte der Freien und Hansestadt hat den städtischen Container-Verlader "HHLA" verklagt. Anfang des Monats erging Klage gegen das von der umstrittenen Ex-Postlerin Angela Titzrath geleitete Logistikunternehmen wegen fortlaufender Weigerung zur Auskunft nach dem Hamburgischem Transparenzgesetz. So verwehrt sich die "HHLA" trotz gesetzlicher Verpflichtung als Landesbetrieb, gegenüber interessierten Bürgern Auskunft zu erteilen. Im November '23 hatte Hamburgs oberster Datenschützer Thomas Fuchs den Hamburger Terminalbetreiber bereits gerügt (HANSEVALLEY berichtete).
Konkret hatte ein interessierter Bürger den Geschäftsverteilungsplan der "HHLA" angefordert. Die börsennotierte Aktiengesellschaft hatte dies abgelehnt, mit der Begründung, der Konzern sei ein privatwirtschaftliches Unternehmen und damit nicht veröffentlichungspflichtig. Datenschutzbeauftragter Thomas Fuchs hielt dagegen: "Auch Aktiengesellschaften, deren Aktienmehrheit durch die Stadt gehalten wird, sind gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern zu Transparenz verpflichtet", so Fuchs.
Vor der "HHLA" verklagte die Datenschutzbehörde bereits den Hamburger Flughafen in Fuhlsbüttel, der ebenfalls mehrheitlich der Stadt gehört und keine Auskunft geben wollte. Im aktuellen Tätigkeitsbericht für das vergangene Jahr führt der Datenschutzbeauftragte eine Reihe städtischer Unternehmen und Einrichtungen auf, die es offensichtlich nicht für nötig halten, ihren Veröffentlichungspflichten nachzukommen. So weigerte sich die "Wärme Hamburg GmbH", ihr Organigramm herauszurücken. Ein Krankenhausbetreiber in Altona wehrte sich dagegen, dass die Hygieneberichte der Klinik vom Bezirksamt weitergegeben werden.
Die "Hamburger Hafen- und Logistik-AG" ist in den vergangenen Jahren immer wieder aufgrund selbstherrlich wirkender Verhaltensweisen aufgefallen. So verweigert die Presseabteilung der "HHLA" dem Hanse Digital Magazin seit Jahren die Übersendung von aktuellen Meldungen - offensichtlich aufgrund einer persönlichen und als unprofessionell zu bewertenden Ablehnung seitens Geschäftsführung und Pressestelle aufgrund der unabhängigen Medienberichterstattung von HANSEVALLEY.
Dieses Magazin hatte sich vor zwei Jahren mit den z. T. zweifelhaften Bemerkungen der HHLA-Chefin zu streikenden Terminalarbeitern und fragwürdigen PR-Aktivitäten um das Hamburger Container-Terminal Altenwerder (CTA) beschäftigt. Das HANSESTATEMENT mit dem Titel "Was erlauben Titzrath?" kann hier nachgelesen werden. Trotz erheblicher Kritik an ihrem als herrisch bewerteten Führungsstil wurde Titzrath im Rahmen des Verkaufs von "HHLA"-Anteilen an die Schweizer Reederei "MSC" mit einem neuen 5-Jahres-Vertrag versorgt. Einkommens-Millionärin Titzrath war vor ihrer Tätigkeit als "Hamburgs teuerste Azubine" als Personalvorständin für den Konzern "Deutsche Post DHL" tätig. Hier wurde sie aufgrund eines eigenwilligen Verhaltens gegenüber den Konzerngesellschaften im Juli 2014 "aus persönlichen Gründen" verabschiedet.
-
Ampel streicht Deutscher Bahn Milliarden Investitionen - digitales Stellwerk für S-Bahn in Hamburg vom Tisch.
 |
Eine digitale S-Bahn in ganz Hamburg bleibt ein Wunschtraum.
(Foto: S-Bahn Hamburg) |
Hamburg/Berlin, 05.02.2024: Das geplante digitale Stellwerk für die S-Bahn in der Hamburger Innenstadt ist den Sparzwängen der Berliner Ampel-Koalition zum Opfer gefallen. Im Mai 2022 wurden die Planungen für das digitale Stellwerk in Langenfelde im Rahmen des Bahn-Projekts "Digitalen Schiene" vorgestellt. Damit sollte die Taktung der S-Bahn-Züge insbesondere im Bereich des City-Tunnels vom Hauptbahnhof Richtung Altona auf 90 bis 110 Sekunden verdichtet werden.
Das "Stellwerk Hamburg-City" sollte die bisherigen 80 Jahre alten Stellwerke am Hauptbahnhof und in Altona ablösen. Bis zu 2.000 Züge bzw. 30 % mehr Fahrten sollten laut der Planungen durch die digitalisierte Abfertigungsstation der Deutschen Bahn pro Tag auf den innerstädtischen S-Bahn-Trassen gemanagt werden können. Technisch laufen die Stellbefehle und Signale dabei mittels Ringleitungen aus Hochleistungs-Glasfaserkabeln zu den Weichen.
Der Baubeginn war für 2027 geplant, die Inbetriebnahme für 2029. Der Gesamtkostenrahmen sollte sich auf rd. 400 Mio. € belaufen. Der Bund wollte davon 31,5 Mio. € übernehmen. Daraus wird jetzt nichts: Aufgrund der Haushaltskürzungen der Berliner Ampel bekommt die Deutsche Bahn für Investitionen von insgesamt geplanten 45 Mrd. € nur noch 27 Mrd. €. Die sollen vor allem in bestehende Schienen und Infrastruktur fließen. Neue Projekte, wie das digitale Stellwerk für Hamburg, sind damit über die Tischkante gerutscht.
Neben dem neuen Stellwerk für die Hamburger S-Bahn sind laut Nachrichtendienst "RND" auch die Verlegung des Bahnhofs Fangschleuse in Brandenburg für 172,4 Mio. € gekippt, womit das Tesla-Automobilwerk südlich Berlins verkehrstechnisch besser angeschlossen werden sollte. Ebenfalls Opfer des Ampel-Streichkonzerts: Eine leistungsfähige Anbindung des Fehmann-Belt-Bahntunnels an die Wirtschaftszentren Lübeck und Hamburg. Auch der 773 Mio. € teure Ausbau des Güterostkorridors von Uelzen nach Halle/Saale wird sich um Jahre verzögern, meldet "Der Spiegel".
Ursprünglich sollte die Hamburger S-Bahn bis 2030 weitgehend modernisiert und mit digitaler Technik leistungsfähiger werden. Dazu wurden Gesamtkosten von 800 Mio. € auf Landes-, Bundes- und Bahnseite veranschlagt. Die digitale Aufrüstung der gesamten Hamburger S-Bahn-Flotte auf digital gesteuerte Züge sollte danach rd. 175 Mio. € kosten, die Modernisierung der maroden Infrastruktur rd. 620 Mio. €, darunter das neue digitale Stellwerk Hamburg-City 400 Mio. €. (HANSEVALLEY berichtete).
-
E-Commerce in 2023 um weitere 10 Mrd. € eingebrochen - akute Gefahr für Aboutyou, Bonprix, Otto & Co.
 |
Der E-Commerce in Deutschland verliert weitere Milliarden Umsatz.
Grafik: BEVH |
Berlin, 25.01.2024: Der deutsche Online-Handel über Shopping-Portale und Handy-Apps ist im vergangenen Jahr noch einmal um fast 12 % auf nur noch 79,7 Mrd. € Brutto-Umsatz eingebrochen. Im Jahr zuvor erwirtschafteten die Marktplätze, Online-Händler, Multichannel-Anbieter und Hersteller im Direktvertrieb noch einen Gesamtumsatz von 90,4 Mrd. €, in 2021 sogar i. H. v. 99,1 Mrd. €. Nach Einbrüchen in den ersten drei Quartalen 2023 i. H. v. 15,0 %, 12,2 % und 13,9 % konnte auch das wichtige vierte Quartal mit "Black Friday" und Weihnachtsgeschäft durch 7,1 % Einbruch das Jahresgeschäft der deutschen Onlineanbieter nicht mehr retten.
Besonders hart trifft es die drei großen Produktcluster bekannter deutscher Online-Händler, wie "Otto.de", "Media Markt/Saturn" oder "Zalando": Unterhaltungselektronik einschl. Computer büßte 14,7 % Umsatz ein, der Bereich Bekleidung stürzte in 2023 um 13,3 % ab und der Möbelsektor einschl. Elektrogroßgeräten gab um 9,8 % nach. Besonders hart trifft es dabei die reinen Online-Händler ohne Marktplatz und Drittanbieter. Sie verloren im Krisenjahr 2023 insgesamt 14,7 % Ihres Geschäfts.
Die mit 53 % Marktanteil dominierenden Marktplätze, wie "Aboutyou.de", "Kaufland.de", "Otto.de" oder "Zalando.de" verloren hochgerechnet 8,5 % Umsatz. Deutlich erkennbar: Während in den Corona-Jahren rd. die Hälfte der Kunden mindestens einmal in der Woche online eingekauft haben, ist die Kauffrequenz im vergangenen Jahr auf nur noch 34 % wöchentlicher Einkäufe abgestürzt. Am wenigsten mussten Artikel des täglichen Bedarfs einbüßen, wie Lebensmittel, Drogerieartikel und Tierbedarf.
Der Branchenverband des Onlinehandels - BEVH - redete sich die erneut schlechten Zahlen schön. Verbandspräsident Gero Furchheim sagte: „Wir erwarten, dass die Talsohle im deutschen E-Commerce im Laufe des Jahres erreicht wird. Das vierte Quartal 2023 war mit einem Rückgang von 7,1 Prozent das erste Quartal mit einem nur einstelligen Minus seit Frühsommer 2022 und weist für die Zukunft auf eine Stabilisierung der Umsätze hin. Im vergangenen Jahr wirkte sich aus, dass der Onlinehandel in Warengruppen wie Bekleidung und Unterhaltungsartikel stark ist, in denen die deutschen Konsumenten besonders gespart haben."
Die Branchenexperten in Berlin gehen davon aus, dass die Mitgliedsunternehmen z. B. durch Kostenreduzierungen und Personalentlassungen ihre Profitabilität weiter erhöhen werden. Der bereits 2022/2023 mit 413 Mio. € Schulden ins Minus gerutschte Hamburger Handelskonzern "Otto" hatte nach den roten Zahlen zum 28.02.2023 bereits Entlassungen im Ausland angekündigt. Den Familienkonzern mit allein 6.000 Mitarbeitern im E-Commerce in Hamburg dürfte es im zweiten Krisenjahr in Folge besonders schwer treffen.
Der zum "Otto"-Konzern gehörende und im vergangenen Jahr insgesamt 6,3 Mrd. € Umsatz erzielende Hamburger Online-Händler und Marktplatz "Otto.de" lebt fast ausschließlich von den aktuellen Krisenbereichen Bekleidung, Möbel, Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik. Dazu kommen an Alster und Elbe die beiden Konzern-Beteiligungen "Aboutyou" und "Bonprix". Auch sie mussten bereits im vergangenen Geschäftsjahr Federn lassen. Der "Otto-Konzern" veröffentlicht vorläufige Zahlen zum Geschäftsjahr 2023/2024 am 27. Februar d. J.
In die aktuellen Zahlen des Branchenverbandes sind keine Angaben des größten in Deutschland aktiven E-Commerce-Anbieters "Amazon EU" eingeflossen. Die Plattform "Amazon.de" beherrschte im Jahr 2022 mit 31,9 Mrd. € Umsatz unverändert den deutschen E-Commerce-Markt. Ebenfalls nicht berücksichtigt sind millionenschwere Einkäufe deutscher Endkunden auf chinesischen Marktplätzen, wie "Aliexpress", "Shein" oder "Temu". Hier argumentierten die BEVH-Funktionäre in der diesjährigen Jahrespressekonferenz vor allem mit unfairen Wettbewerbsbedingungen und Forderungen nach Regulierung durch die Politik.
Die aktuellen Branchenzahlen zum E-Commerce 2023 ohne "Amazon" und chinesische Marktplätze können hier abgerufen werden. -
Arbeitnehmerfeindliche VW-Tochter Moia wird mit mehr als 10 Mio. € Steuergeldern subventioniert.
 |
Die arbeitnehmerfeindliche VW-Tochter kassiert in Hamburg Millionen-Subventionen.
Foto: Moia |
Hamburg, 24.01.2024: Die für ihre arbeitnehmerfeindlichen Methoden immer wieder vor Gericht geladene und öffentlich kritisierte VW-Mobilitätsfirma "Moia" bekommt trotz ihrer massiven Verstöße aus Steuermitteln mit Unterstützung des Hamburger Senats mehr als 10 Mio. € staatlicher Subventionen des Bundes. Mit 7,6 Mio. € soll der größte Teil bis 2026 für den geplanten Shuttle-Dienst mit autonomen Kleinbussen im Rahmen des Projekts "Alike" unter Leitung der stadteigenen "Hochbahn" ausgegeben werden.
Der gewerkschaftspolitische Experte der Linken im Bundestag - Pascal Meiser - erklärt zu den massiven Missständen bei "Moia": „Es darf doch nicht wahr sein, dass der Bund mit zweistelligen Millionenbeträgen Lohndumping fördert und das FDP-geführte Verkehrsministerium offenkundig keinerlei Notiz davon nimmt. Wenn es darum geht, die Mobilität der Zukunft zu gestalten, dann muss auch dafür gesorgt werden, dass dabei anständige Arbeitsbedingungen herrschen und endlich nach Tarif bezahlt wird."
Der Bundestagsabgeordnete weiter in Richtung des FDP-geführten Bundesverkehrsministeriums: "Verkehrsminister Wissing darf der Tarifflucht bei Moia nicht länger tatenlos zusehen, sondern muss sich gegenüber dem Unternehmen und dem VW-Mutterkonzern dafür einsetzen, dass mit der zuständigen Gewerkschaft IG Metall ein Tarifvertrag abgeschlossen wird. Alles andere gefährdet am Ende auch die Akzeptanz für neue Mobilitätskonzepte.“
Der gewerkschaftspolitische Sprecher der Linken in der Hamburger Bürgerschaft, David Stoop, ergänzt: "„Der Senat macht sich auf den Weg zum Hamburger Takt.“ Schön und gut. Allerdings sollte darauf geachtet werden, welche Manieren seine Reisebegleitung so pflegt. Gute Arbeit muss auch bei der Vergabe von Fördermitteln gelten. Insbesondere, wenn es um zentrale Zukunftsprojekte geht, die Hamburg im Verbund mit einem Weltkonzern wie VW lanciert.
Der Hamburger Abgeordnete kritisiert: "Dem bisherigen Gebaren der Moia-Geschäftsführung wird diesem Anspruch in keiner Weise gerecht. Ein anständiger Tarifvertrag und ordentliche Arbeitsbedingungen sollten eine Selbstverständlichkeit sein. Der Hamburger Senat und die Bundesregierung sind in der Pflicht, dies als Förderer gegenüber Moia deutlich zu machen.“
"Moia" testet seit September 2021 den Betrieb autonomer Kleinbusse in München, seit Juli vergangenen Jahres auch in Hamburg. Das von Insidern als "VW-Schmuddelkind" kritisierte Unternehmen soll mit seiner digitalen und von HANSEVALLEY wegen massiver Programmfehler kritisierten Plattform-Software den Betrieb von bis zu 10.000 Shuttle-Bussen für den Betrieb des 5-Minuten-Versprechens namens "Hamburg-Takt" managen.
Mit einem Gesamtvolumen von 52 Mio. € inkl. Steuergeldern des Bundes soll bis 2026 ein fertiges System aus Software, Genehmigungen und selbst fahrenden Robotaxis auf die Straße der Hansestadt gestellt werden. Ab 2025 soll bereits ein Ridepooling-Dienst mit Passagieren und 20 autonomen Fahrzeugen der Stufe 4 in Echtzeit laufen. Der rot-grüne Senat beteiligt sich über die "Hochbahn" mit rd. 20 % der Eigenmittel bzw. gut 5 Mio. €. an dem Projekt.
-
Schleswig-Holstein erteilt gemeinsamer Innovationsagentur mit Hamburg eine Absage.
 |
Die gemeinsame Innovationsagentur der Metropolregion ist Geschichte.
(Grafik: Metropolregion Hamburg/Mediaserver Hamburg/Colourbox) |
Kiel/Hamburg, 19.01.2024: Die CDU-geführte Landesregierung Schleswig-Holsteins hat der Gründung einer gemeinsamen Innovationsagentur mit Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen ein Jahr vor dem geplanten Start eine Abfuhr erteilt. Wirtschaftsstaatssekretärin Julia Carstens erklärte am Mittwoch im Wirtschaftsausschuss des Kieler Landtags, dass eine solche Einrichtung angesichts der angespannten Haushaltslage aktuell nicht finanzierbar sei.
Aufgrund notwendiger Einsparungen im Landeshaushalt 2024 in Höhe von insgesamt 100 Mio. € aufgrund des Bundesverfassungsgerichtsurteils zum Klima- und Transformationsfonds der Bundesregierung "trenne man sich in Schleswig-Holstein zuerst von Projekten, die noch nicht aufs Gleis gesetzt wurden". Dies sei keine endgültige Entscheidung gegen die grundsätzlich als sinnvoll eingestufte Agentur.
Damit enden zunächst die Bemühungen der vier Bundesländer in der Metropolregion Hamburg um eine gemeinsame Standortförderung - gut ein Jahr nach Veröffentlichung der u. a. von "Prognos" erarbeiteten Innovationsstrategie inkl. Konzept für eine Innovationsagentur. Der Start der länderübergreifenden Fördereinrichtung mit Schwerpunkt auf zukunftsweisende Themen in der Region, gemeinsame Ökosysteme und länderübergreifende Innovationsprozesse war für 2015 geplant.
Der wirtschaftspolitische Sprecher der FDP-Fraktion im Kieler Landtag und vormalige Wirtschaftsminister, Bernd Buchholz, kritisierte die Entscheidung: „Die Innovationsagentur hätte das Ziel gehabt, gemeinsam die Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen im Norden zu stärken. Dass Schleswig-Holstein davon ungleich stärker profitiert hätte, liegt auf der Hand. Der Verweis auf die Haushaltslage zeigt nur, dass Schwarz-Grün nicht gewillt ist, die richtigen Prioritäten zu setzen.“
Offene Kritik gab es am Mittwoch-Abend (17.01.2024) auf dem Neujahrsempfang der IHK in Lübeck. Hauptgeschäftsführer Lars Schöning kritisierte in Anwesenheit von Ministerpräsident Daniel Günther und Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen: "Das ist aus unserer Sicht ein Schritt in die verkehrte Richtung und nicht der Impuls, auf den die Unternehmen im gemeinsamen Wirtschaftsraum gewartet haben.“
Der Wirtschaftsvertreter bezog sich vor 1.000 geladenen Unternehmern und Vertretern aus Politik, Wissenschaft und Gesellschaft auf die OECD-Studie aus 2019, die „uns schmerzlich vor Augen führt, dass wir in der Metropolregion zu viele Chancen, die sich im Bereich Erneuerbare Energien und Innovationen bieten würden, nicht konsequent nutzen. Hier erwarten wir ein Umdenken.“
Die Wirtschaftsbehörde der Freien und Hansestadt Hamburg bedauert das beschlossene Ausscheiden Schleswig-Holsteins aus dem Vorhaben. Die Wirtschaftsbehörde verwies auf aktuelle Kosten für die Agenturgründung im niedrigen sechsstelligen Bereich und betonte, dass die Finanzierungsplanung noch nicht abschließend feststehe.
Hamburgs Wirtschaftsstaatsrat Andreas Rieckhof erklärte: „Die Innovationsagentur kann einen großen Gewinn für die gesamte Metropolregion darstellen und war eine ausdrückliche Empfehlung der OECD. Wenn Schleswig-Holstein am Ausscheiden aus dem gemeinsamen Projekt festhält, wäre das daher für alle Beteiligten bedauerlich. Wir hoffen, dass die schleswig-holsteinische Entscheidung nicht endgültig ist – die Tür für eine Beteiligung bleibt für Schleswig-Holstein offen.“
Konkret geht es laut Kieler Wirtschaftsministerium um Finanzierungskosten in "Phase 0" i. H. v. von rd. 250.000,- €. Das Wirtschaftsministerium erklärte zur Hamburger Stellungnahme, dass weitere Kosten für notwendiges Fachpersonal hinzu kommen würden. Laut "Prognos"-Strategie sind für die Agentur ab 2015 gemeinsame Kosten von rd. 1 Mio. € und im 5. Jahr bis zu 2,5 Mio. € geplant. Größter Kostenblock wird nach dem Aufbau ab drittem Jahr das Personal mit 1,0 bis 1,8 Mio. €.
Die gemeinsame Innovationsagentur sollte zum "Schwungrad für länderübergreifende Innovationsaktivitäten in der Metropolregion Hamburg" werden, so die Strategie. Geplant war, dass dazu die Leuchtturmthemen der Region in einer gemeinsamen Innovationsstrategie bearbeitet und mit Innovationspartnern gemeinsam gefördert werden sollten.
Hinter den Planungen für eine gemeinsame Innovationsagentur stehen die im Rahmen der "Prognos"-Strategie erarbeiteten fünf Themenfelder 1) Nachhaltige & vernetzte Energiesysteme, 2) Nachhaltige Materialien & Produktionsprozesse, 3) Bioökonomie & Ernährungswirtschaft, 4) CO2-freie Mobilitätslösungen sowie 5) Digitalisierung und künstliche Intelligenz.
Im Kontext Digitalisierung sollte sich die Innovationsagentur u. a. um die Förderung der bestehenden Schwerpunkte Big Data und Datenplattformen, Automatisierung und IOT, KI, Quantencomputing und XR-Technologien kümmern. Technologie-übergreifend wurde zudem das Thema Smart City u. a. im Kontext digitale Verwaltung und vernetzte Mobilität definiert.
Die Metropolregion Hamburg umfasst mit rd. 5,4 Mio. Einwohnern als Wirtschaftsraum insgesamt 20 Landkreise, 100 Gemeinden und 1.000 Orte rund um die Freie und Hansestadt Hamburg. Schleswig-Holstein zählt zu 51 % bis zu den Landkreisen Dithmarschen und Ostholstein sowie inkl. Neumünster zum Ballungsraum.
-
Landesregierung in Schwerin bekommt kontinuierliche Unterstützung des KI-Zentrums MV nicht auf die Reihe.
 |
Gute Arbeit mit 100 Partnern - von der Landesregierung hängengelassen.
(Screenshot: HANSEVALLEY) |
Schwerin, 15.01.2024: In Mecklenburg-Vorpommern gibt es Streit um die weitere Finanzierung des landesweit bedeutenden Zentrums für Künstliche Intelligenz an der Universität Rostock. Seit 31. Dezember 2023 ist die Finanzierung des "KI-Zentrums" durch EU-Mittel ausgelaufen. Laut CDU-Fraktion im Schweriner Landtag lässt die rot-rote Landesregierung das fünfköpfige Stammteam, weitere wissenschaftliche Mitarbeiter und KI-interessierte Unternehmen "am ausgestreckten Arm verhungern".
Die Hängepartie um die weitere Finanzierung des Transferzentrums ist nicht neu: Bereits für das Jahr 2023 gab es eine große Ungewissheit um die weitere Finanzierung. Hier wurde erst zwei Monate vor dem Auslaufen der Finanzierung nach einem Antrag der Opposition im Landtag reagiert und die Finanzierung auf den letzten Drücker ermöglicht.
Die digitalpolitische Sprecherin der CDU im Landtag von MV, Ann-Christin von Allwörden, bringt auf den Punkt: „Wie wichtig die Arbeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des KI-Zentrums ist, hat die Ostseezeitung kürzlich aufgearbeitet. Über 100 Firmen stehen mit dem Zentrum zum Megathema Künstliche Intelligenz in Kontakt. Möchte die Landesregierung auch zukünftig diesen niedrigschwelligen Wissens- und Technologietransfer von der Forschung in die kleinen und mittleren Unternehmen sicherstellen, ist das KI-Zentrum mit seinen Einzelberatungen hierfür unerlässlich."
Die regierende SPD im Nord-Osten fühlt sich von der offenen Kritik der Union düpiert. In einer kurzfristigen Meldung erklärte der zuständige Fachsprecher, dass das Wissenschaftsministerium die Finanzierung übernehmen werde. Laut Antwort habe das Wissenschaftsministerium die Fortsetzung der Förderung bereits zu Jahresbeginn 2024 an die Hochschulleitung kommuniziert und eine Zusage gegeben.
Damit werde die Landesregierung ihr Versprechen zur Fortsetzung der finanziellen Unterstützung "zeitnah einlösen". Das "KI-Zentrum MV" ist seit 2020 ein Transferzentrum, um Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz in vornehmlich kleine und mittlere Unternehmen zu bringen. Dazu veranstaltet das Team u. a. themenspezifische Workshops, bietet individuelle Beratung an und beteiligt sich in "Ko-Produktionen" an der Einführung von KI-Lösungen in KMUs. Bisher wurde es aus Brüsseler EFRE-Mitteln finanziert.
Dirk Stamer, hochschulpolitischer Sprecher der SPD im Schweriner Landtag, kontert: „Das Zentrum für Künstliche Intelligenz und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leistet einen wichtigen Beitrag zur Modernisierung der Firmen in MV. Für diese Arbeit sind wir ihnen außerordentlich dankbar. Genau deshalb hat die Landesregierung bereits zugesichert, dass das Zentrum auch weiterhin finanziell unterstützt wird."
Weitere Informationen zum KI-Zentrum MV gibt es auf der Projektseite. -
Rot-Grüner Senat versucht mangelhafte Behörden-Digitalisierung mit alten Fakten zu vernebeln.
 |
Auch die Digitalisierung sorgt für trübe Aussichten auf den Hamburger Senat.
Foto: HANSEVALLEY |
Hamburg, 09.01.2024: Die Freie und Hansestadt druckt in fast einer Million Vorgängen pro Jahr mit 130 verschiedenen Fachprogrammen immer noch rd. 350 Millionen Seiten Papier aus. Die nach Ansicht des rot-grünen Senatssprechers Marcel Schneider im Vergleich zu den anderen 15 Bundesländern und den 407 Großstädten mit mehr als 30.000 Einwohnern digital führende Verwaltung schlägt sich in der Realität mit überalterten, nicht kompatiblen und nur teilweise digitalen Programmen herum.
Der digitalpolitische Sprecher der CDU-Fraktion in der Hamburigschen Bürgerschaft pointiert gegenüber dem "Hamburger Abendblatt" den Stand der Digitalisierung in den Behörden der Stadt: "Trotz gesetzlicher Vorgaben und Versprechungen zur Digitalisierung entpuppt sich die Umsetzung als Desaster, geprägt von Ineffizienz, mangelnder Transparenz und ungenügendem Handlungswillen."
Der Senat kann in vielen Fällen selbst nicht sagen, ob und wie weit die notwendigen Computerprogramme digital mit anderen Anwendungen und Fachabteilungen zusammenarbeiten. 294 sogenannte Fachverfahren sind laut aktueller Anfrage des CDU-Abgeordneten Sandro Kappe zu 100 Prozent digital und ohne Ausdrucken von Formularen und Bescheiden nutzbar, 150 Programme allerdings nur teilweise.
Besonders analog geht es u. a. noch in der Grünen Justiz- sowie Umweltbehörde, in der SPD-Sozialbehörde und bei der gern mal Millionen Euro verschenkenden SPD-Finanzbehörde zu, so die Mitteilung des Senats auf die Senatsanfrage des digitalpolitischen Sprechers der Union in der Bürgerschaft. Auch in den Bezirken herrschen zum Teil analoge Zustände aus dem letzten Jahrhundert vor, z. B. im Bezirksamt Nord.
Ein näherer Blick in die Gründe für die analoge Druckorgie des Senats zeigt mangelnde Bereitschaft zur Digitalisierung: So erklärt der Tschentscher-Senat u. a. lapidar, dass "eine technische Schnittstelle zum Kundenzentrum noch nicht besteht" oder "ein Portal für einen digitalen Austausch nicht zur Verfügung steht." Der Senat macht in Einzelfällen sogar Rückschritte: Bei der digitalen Parkraumbewirtschaftung der städtischen "Sprinkenhof AG" für Gewerbeimmobilien bekommt Kappe mitgeteilt, dass "die digitale Plattform aufgrund von Schnittstellenproblemen vorübergehend eingestellt wird".
Dass es der Senat mit der Digitalisierung seiner Behörden trotz 60 Seiten bunt bedruckter Digitalstrategie aus dem Januar 2020 nicht wirklich ernst meint, zeigen die Zahlen hinter dem offensichtlichen Software-Chaos: Für das Jahr 2024 stehen laut Doppelhaushalt lediglich 67,38 Mio. € für Investitionen und 154,05 Mio. € IT-Projektmittel zur Verfügung. Dazu müssen u. a. allein 120 IT-Projektmanager im senatseigenen "Amt IT und Digitalisierung" unter Leitung des städtischen CDO Christian Pfromm bezahlt werden.
Digitalpolitiker Sandro Kappe findet klare Worte zu den Widersprüchen zwischen 350 Mio. gedruckten Seiten und den Hochglanz-Ansprüchen senatseigener PR-Broschüren: "„Die harten Fakten verdeutlichen die unzureichende Bilanz des Hamburger Senats im Bereich Digitalisierung.“ Der CDU-Abgeordnete fordert auf seiner Internetseite: "Konkrete Maßnahmen sind notwendig, um die Lücke zwischen digitalen Anträgen und ihrer Bearbeitung zu schließen und den Weg für eine nahtlose digitale Verwaltung zu ebnen."
Senatssprecher Marcel Schweitzer scheint unterdessen mit alten Fakten die kritische Berichterstattung des "Abendblatts" vernebeln zu wollen: Laut Tschentschers Chefsprecher sei Hamburg "der unangefochtene digitale Spitzenreiter im Ländervergleich". Dabei hat die Hansestadt im vergangenen Jahr ihren Spitzenplatz in den beiden Smart City-Indexen des "Bitkom" und der Unternehmensberatung "Haselhorst" an München verloren.
Statt kritisch mit dem Verlust in den meisten der Teilkategorien in Klausur zu gehen, spielte CDO Christian Pfromm beim Gratulations-Defilee zum "Bitkom"-Index im Rahmen der "Smart City Convention" im November '23 in Berlin den Gesichtsverlust einfach herunter: "Wir setzen dann in diesem Jahr einmal aus". Der Abstieg Hamburgs bei der städtischen Digitalisierung war nach beiden Smart City-Rankings bereits im Jahr 2022 vorhersehbar (HANSEVALLEY berichtete).
-
VW will 22 nagelneue ID 6 aus China zwangweise verschrotten lassen, um den Markt zu kontrollieren.
 |
Die günstige China-Version des VW ID6 ist Dorn des Anstosses.
(Foto: JustAnotherCarDesigner, CC BY SA 4.0)
|
Wolfsburg, 20.12.2023: Der "Volkswagen"-Konzern will 22 nagelneue Elektro-Fahrzeuge vom Typ "ID 6" in Deutschland zerstören lassen. Dazu hat der Hersteller mit einstweiliger Verfügung des Hamburger Landgerichts vorläufig den Verkaufsstopp und die Beschlagnahmung erzwungen. Begründung: Mit den von einem unabhängigen Online-Händler aus China importierten SUVs seien die Markenrechte von "VW" verletzt worden. Damit dürfe "VW" den Verkauf der Fahrzeuge kontrollieren und auch verbieten.
Der international aktive Autohändler Grigory Brudny mit Niederlassung in Berlin hatte insgesamt 22 Fahrzeuge vom Typ "ID 6 X" und "ID 6 Cross" nach Deutschland importiert, verzollt, auf europäische Standards umrüsten lassen, in Berlin korrekt zugelassen und auf einem Online-Automarktplatz eingestellt. Die variablen SUVs wurden in Shanghai vom Joint Venture "VW-FAW" für den inländischen Markt produziert und von der "China FAW Group" nach Europa verkauft.
Mit den populären Modellen will "VW" allerdings nur im Inland punkten. Für Europa ist das Modell nicht vorgesehen. Folge: Die 22 "ID 6" wurden auf Anweisung des Gerichts beschlagnahmt. Die von "VW" geforderte Vernichtung kostet den Händler im Falle eines Falles als Eigentümer 15.000,- € pro Stück - plus 8.000,- € Aufbewahrung.
Laut Gerichtsbeschluss darf der Händler "Gregory's Cars" bis zur endgültigen Entscheidung in letzter Instanz auch die Marke "VW" nicht zur Vermarktung seiner Autos benutzen. „Der Konzern will uns in die Pleite treiben, um andere abzuschrecken“, meint der russischstämmige Autohändler. Er hat durch seine Anwälte Befangenheitsanträge gegen die Zivilkammer des Hamburger Landgerichts stellen lassen.
Offen ist, ob "VW" mit dem Versuch der Verschrottung in Verbindung mit der Argumentation des "Kundenschutzes" aufgrund ursprünglich chinesischer Software den deutschen Hochpreis-Markt von günstigen China-Importen abschotten und den Verkauf weiter auch mit juristischen Mitteln kontrollieren kann, um damit Profite zu maximieren.
-
CDU fordert sofortigen Stopp des Bargeldverbots in Hamburger Linienbussen.
 |
Auch diese Hochbahn-Busfahrerin darf ab 1.1. kein Bargeld mehr annehmen.
(Foto: Hochbahn) |
Hamburg, 19.12.2023: Die zum Jahreswechsel geplante Abschaffung des Barverkaufs von Fahrscheinen in den Hamburger Linienbussen der städtischen Busbetreiber "Hochbahn" und "VHH" entwickelt sich zum Politikum. Zum Jahreswechsel zwingt der zuständige Hamburger Verkehrsverbund "HVV" alle Kunden ohne App, Deutschlandticket oder Zeitkarte, ihre Einzel-, Tages- und Gruppentickets in den rd. 150 Metro- und Stadtbus-Linien im Hamburger Stadtgebiet bargeldlos zu bezahlen.
Die zuständige Verkehrsbehörde argumentiert gegenüber der größten Oppositionsfraktion - CDU - in einer durchgegenderten Antwort, dass weniger als 6 % aller Fahrscheine in den Hamburger Bussen heute noch bar gekauft würden. Dies sind trotz der geringen Prozentzahl weiterhin Tausende Fahrgäste am Tag. Die CDU argumentiert dagegen: Vor allem Besucher der Stadt und ältere Menschen würden durch den Zwang zu digitalen Zahlungsmitteln benachteiligt.
Der Senat lässt keine Gelegenheit offen, die Bezahlung von Fahrscheinen in den Bussen negativ erscheinen zu lassen: So koste der Verkauf von Tickets extra Zeit und sorge für verspätete Abfahrten der städtischen Nahverkehrsbusse. Über die "HVV-Seniorenberatung" würden Schulungen zur Nutzung der Prepaid-Karte angeboten werden. Zudem würde der Prüfdienst angewiesen, zu Beginn der bargeldlosen Zeit kulant gegenüber Fahrgästen ohne einem gültigen Ticket zu sein.
Der Senat versucht mit seinen Antworten zugleich, seine "HVV-Switch"-App zu vermarkten und geht davon aus, dass diese künftig von den meisten Fahrgästen genutzt werden würde. Alternativ verweist die Grüne Behörde von Verkehrssenator Anjes Tjarks auf die am Automaten aufzuladende Prepaid-Karte zur Bezahlung in den insgesamt rd. 1.850 Bussen der zur Stadt gehörenden Busbetriebe. Brisant: Bis Ende Oktober d. J. waren die gut 660 Fahrkarten-Automaten zum Aufladen der Karten mehr als 4.100-mal kaputt. Das betrifft jeden der Automaten bei "Hadag", "HVV", "VHH" und S-Bahn im Schnitt sechsmal pro Monat.
Die stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende in der Bürgerschaft - Anke Frieling - fragte die Hamburger Verkehrsbehörde, wie sie mit Menschen umgehen wolle, die entweder kein Smartphone besitzen oder sich zu unsicher mit digitalen Zahlungsmitteln fühlen. Weder die Handy-App "HVV-Switch" noch die angepriesene Prepaid-Bezahlkarte hält die Abgeordnete für sinnvolle Alternativen.
Das Thema kocht nach der ersten Bekanntmachung auch emotional bei den Hamburgern erneut hoch. In über 70 Kommentaren auf "mopo.de" kritisieren Betroffene u. a., dass der Monopolist "HVV" die Einwände von Fahrgästen ignoriere. Eine breite Mehrheit der Kommentatoren wünscht sich eine Lösung ohne Zwang zur digitalen Bezahlung von "HVV-Tickets".
Zu den Gegenargumenten gehört u. a. die Angst einer Reihe von Senioren, auch mit Handy in der Tasche digital zu bezahlen. Zudem gebe es an den meisten Bushaltestellen keine "HVV-Automaten", um Prepaid-Karten aufzuladen. Weitere Kritik: Für eine einzelne Fahrt eine Guthabenkarte aufzuladen, lohne sich nicht. Damit würde man den Verkehrsbetrieben unfreiwillig ein Guthaben als zinslosen Kredit zur Verfügung stellen.
Europas größter kommunaler Bus- und Bahnbetrieb - die Berliner "BVG" - hat Mitte Januar d. J. die Barzahlung in ihren gut 1.500 Berliner Bussen wieder eingeführt, nachdem diese aus hygienischen Gründen zu Beginn der Corona-Pandemie im März 2020 eingestellt worden war. Die "BVG" will wie die linke Gewerkschaft Verdi am liebsten das Bargeld abschaffen. CDU-Verkehrssenatorin Manja Schreiner und der Fahrgast-Verband IGEB wollen dagegen niemanden ausschließen. Auch in Berlin kaufen vor allem Senioren und Touristen Fahrscheine direkt beim Fahrer auf einer der 200 Buslinien.
Offensichtlich wollen die Hamburger Verkehrsbetriebe "Hochbahn" und "VHH" mit der Abschaffung des Bargelds vor allem Kosten einsparen. Das Zählen und Sichern der Bargeldbestände gehört zu den teuersten Arbeitsschritten beim Bezahlen von Produkten und Dienstleistungen. Damit reiht sich der "Digitalzwang" ein in die fortlaufende Kritik an den beiden Hamburger Busbetrieben im Zusammenhang mit einem finanziellen Hintergrund.
Anfang August d. J. griff die Linksfraktion der Bürgerschaft unhaltbare Zustände beim Linienverkehr von "Hochbahn" und "VHH" sowie beim U-Bahn-Schienenersatzverkehr durch den privaten Hamburger Busbetrieb "Umbrella" auf. Die verkehrspolitische Sprecherin der Fraktion - Heike Sudmann - reagierte damit auf die zunehmende Kritik seitens "HVV-Kunden".
Danach glänzte "Umbrella" mit abgewirtschafteten Fahrzeugen, fehlenden Klimaanlagen im Sommer, kaputten Richtungsanzeigern, fehlenden Deutschkenntnissen der Fahrer, pampiger Kommunikation der migrantischen Fahrer mit Fahrgästen und unhaltbaren Reaktionen auf Fahrgastfragen. Einzelne Fahrer gingen während ihrer Tour sogar privat Einkaufen.
Die Linke brachte das Verhalten des "Hochbahn"- und "VHH"-Dienstleisters mit Kritik am Anheuern eines "Billiganbieters" auf den Punkt. Erst die öffentliche Kritik nach Thematisierung durch die Opposition brachte den Senat dazu, zu reagieren. So würden die ausländischen Fahrer in Deutschkurse geschickt und Manieren in Sachen Kundendienst beigebracht.
-
Versandhändler Otto droht nach schwachem Weihnachtsgeschäft weiterer Geschäftseinbruch.
 |
Schon im vergangenen Jahr blieb Otto auf seiner Kleidung sitzen.
Foto: HANSEVALLEY |
Berlin/Hamburg, 11.12.2023: Die Deutschen geben dieses Jahr zu Weihnachten erneut weniger Geld im Internet aus, als im Vorjahr. Daran ändern laut Bundesverband E-Commerce auch starke Verkaufszahlen rund um "Black Friday" und "Cyber Monday" wenig. Unter dem Strich lagen die Gesamtumsätze mit Warenbestellungen von Anfang Oktober bis Ende November d. J. über alle Branchen laut BEVH 7,7 % niedriger, als 2022.
Zwar fällt die Konsumbereitschaft zum Fest nicht ganz so schlecht aus, wie mit Blick auf den bisherigen Jahresverlauf zu erwarten war. Das von Januar bis zum "Cyber-Weekend" aufgelaufene Umsatzminus liegt jedoch bei 12,5 % und deutet für das Gesamtjahr auf eine noch schlechtere Gesamtentwicklung hin, als im schwierigen Geschäftsjahr 2022.
In den Clustern Bekleidung und Unterhaltung (inkl. Elektronikartikel) fiel das Umsatzminus mit minus 4,1 bzw. minus 8,0 % zu den Vorquartalen einstellig aus. Keine zusätzlichen Konsumimpulse brachte das Weihnachtsgeschäft unter anderem bei Möbeln (minus 7,1 %). Die Umsätze konnten nicht aus dem negativen Umsatztrend des laufenden Jahres ausbrechen.
„Einerseits ist die Konsumlaune im Weihnachtsgeschäft des Onlinehandels zurückgekehrt“, so Martin Groß-Albenhausen, vom Bundesverband E-Commerce und Versandhandel e.V.. „Andererseits haben die Verbraucher sich noch im Oktober zurückgehalten und dann bei stark rabattierten Produkten zugegriffen. Selbst hohe Bestellzahlen führen dann unterm Strich immer noch nicht zu realem Wachstum.“
Der Hamburger Meinungsforscher "Appinio" hatte bereits im Juni d. J. nach einer Verbraucherumfrage die Einsparungen der Verbraucher im Bereich Mode prognostiziert: Danach planten 47 % der bundesweit befragten Konsumenten weniger Kleidung zu kaufen, rd. 36 % sogar deutlich weniger - vor allem aufgrund der anhaltenden Inflation mit hohen Lebensmittel- und Energiepreisen.
Dies betrifft besonders Frauen (42 % vs. 30 % der Männer). Fast drei Viertel (73 %) wollten als Konsequenz häufiger zu günstigere Bekleidungsmarken für Sommermode zurückgreifen. Der aktuelle Spartrend bei Bekleidung geht zu Gunsten von Billig-Marken im Internet und vor Ort, wie "Bonprix" ("Otto-Konzern"), "Kik" ("Tengelmann") "Shein" (China) oder "Takko" ("Tengelmann").
Weitere Umsatzeinbrüche bei About You, Bonprix, Otto & Co. zu erwarten
Mitte Oktober d. J. hatte der größte Online-Händler des "Otto-Konzerns" - der Hamburger Distanzhändler "Otto.de" - noch mit einer leichten Erholung des Geschäfts zu Weihnachten gerechnet. Vorstand Marc Opelt ging von einem leichten Zuwachs des Geschäfts aus. Als Grund nannte "Otto.de" vermeintlich 14 % höhere Bestellzahlen. Allerdings: Auch bei "Otto" brach der Umsatz um weitere 7 % ein.
Der Hamburger Handelskonzern "Otto Group" hatte das Geschäftsjahr 2022/2023 mit 413 Mio. € Schulden abgeschlossen. Im Vorjahreszeitraum 2021/2022 erreichte das Firmenkonglomerat um "Otto.de", "Hermes" und "EOS" noch einen Gewinn von 1,8 Mrd. €. Der Familienkonzern stürzte zudem insgesamt in eine Gesamtverschuldung i. H. v. 2,81 Mrd. €.
Aufgrund der massiven Kaufzurückhaltung über das gesamte Jahr 2023 ist mit erheblichen Minuszahlen in den drei Kern-Bereichen des Versandhandels - Bekleidung, Elektroartikel und Möbel - und damit mit einer weiteren z. T. massiven Verschlechterung der Geschäftsentwicklung des "Otto-Konzerns" im Bereich Handel für Deutschland zu rechnen.
Nach einem Einstellungsstopp in seinem internationalen Geschäft stehen mit Jahresabschluss zum 29. Februar 2024 womöglich auch Entlassungen bei "Otto" in Hamburg zur Disposition. Auf dem "Otto-Campus" in Hamburg-Bramfeld arbeiten allein rd. 6.000 Mitarbeiter im Bereich Versandhandel. Weniger gefährdet werden die rd. 2.000 Arbeitsplätze in den Bereich IT und Digitalisierung sein.
-
Hanse-Merkur liefert kaputte Service-App an 1,6 Mio. Krankenversicherungs-Kunden aus.
 |
Die Hanse-Merkur-App: Außen hui, innen pfui.
Screenshot: HANSEVALLEY |
Hamburg, 08.12.2023: Die Ende Oktober d. J. von Hanse-Merkur veröffentlichte neue Service-App für Kranken- und Zusatzversicherte sowie Tierhalter ist in Teilen mit erheblichen Mängeln an allein 1,6 Mio. Krankenversicherte ausgeliefert worden. Gut einen Monat nach der Veröffentlichung und einer Aktualisierung weist die App weiterhin schwere Fehler auf. So lädt die App zum Einreichen von Rechnungen erst nach mehrfachen Versuchen und Wartezeit überhaupt die Kundendaten.
Die mobile Anwendung in Verantwortung der Hanse-Merkur-Krankenversicherung und IT-Vorstand Eberhard Sautter fordert Nutzer zur Eingabe eine E-Mail-Adresse auf, wenn diese ein Problem mit der App melden wollen (siehe Foto). Makaber: In den gespeicherten Kundendaten der App ist die E-Mail-Adresse korrekt hinterlegt. Wollen Versicherte aus dringendem Grund mit der Hanse-Merkur Kontakt aufnehmen, ist dies über die App trotz entsprechend hinterlegter Funktion nicht möglich. Die App meldet, dass es gar keinen Vertrag gibt.
Der Hamburger Versicherungskonzern war in der vergangenen Woche in die Schlagzeilen geraten, da er seine Mitglieder zwar Mitte Oktober d. J. über die alte Service-App formal über eine neue Applikation zum Einreichen von Rechnungen informiert hatte, entgegen der offiziellen PR-Aussagen seitens der Pressestelle jedoch Kunden nicht per E-Mail oder Briefpost über die wichtige Änderung in der Kunden-Kommunikation informiert hatte.
Mit Einwilligung wickelt der zweifelhafte Versicherungskonzern den Schriftverkehr komplett über das Postfach in der Service-App ab. Kunden, die über einen Wechsel der App nicht informiert wurden und nur wenige Male im Jahr zum Einreichen von Rechnungen nutzten, wurden so nicht über die Änderungen in der Kunden-Kommunikation informiert. Offenbar hat der Hamburger Versicherer entgegen eigener Bekundungen seine digitalen Services nicht im Griff.
Aufgrund eigener negativer Erfahrungen von Redaktionsmitgliedern mit der neuen Service-App sowie zweifelhaften Aussagen der Pressestelle zum Wechsel der Service-Anwendung kann das Hanse Digital Magazin einen Abschluss von Kranken-, Zusatz- oder Tierversicherung bei Hanse-Merkur nicht empfehlen. Die Produkte des Hamburger Konzerns werden u. a. über die Hamburger Sparkasse Haspa vertrieben.
-
Hanse-Merkur informiert Krankenversicherte nicht über neue Service-App für die Kunden-Kommunikation.
 |
Hat Kunden nicht immer im Blick: Zentrale der Hanse-Merkur in Hamburg.
Foto: Hanse-Merkur |
Hamburg, 04.12.2023: Die Krankenversicherung "Hanse-Merkur" hat größere Probleme mit ihrer Ende Oktober d. J. aktualisierten Kunden-App für Versicherte in den Bereichen Kranken-, Tier- und Zusatzversicherungen. Ein Redaktionsmitglied von HANSEVALLEY erfuhr erst nach Kündigung einer Zusatzversicherung vom Service-Center, dass eine neue Handy-App für die Abrechnung von Leistungen und Kundendienst-Anfragen gelauncht wurde.
Zugleich bestätigte der telefonische Kundendienst eine Vielzahl von telefonischen Beschwerden seitens "Hanse-Merkur"-Kunden, die von der neuen App und der Notwendigkeit einer erneuten Registrierung bei der Krankenversicherung nicht informiert wurden. Offiziell sollen Flyer zur neuen App an Kunden verschickt worden sein.
"Hanse-Merkur" teilte auf Nachfrage mit: "Alle Nutzer der bisherigen App wurden umfangreich über die Umstellung informiert. Dies geschah zum einen in der App-Postbox, zum anderen haben wir unsere Kunden u.a. per Push-Benachrichtigung, E-Mail und Briefpost - also über vielfältige Kanäle - hierzu kontaktiert."
Der Fall ist brisant, da mit Einwilligung über die App auch der gesamte Schriftverkehr abgewickelt wird. Da die bisherige App nicht mehr in Betrieb ist und von einer Neuregistrierung nichts mitgeteilt wurde, erfuhr der Kunde in diesem Fall auch nichts zu seiner Kündigungsbestätigung. Offenbar ist der privaten Krankenversicherung gleichgültig, ob Kunden den digitalen Kunden-Service einwandfrei nutzen können und vertragsrelevante Informationen erhalten oder nicht.
Zu allen Unzulänglichkeiten kommt die Notwendigkeit einer Pro-Forma-Buchung über das Girokonto des Kunden, um via Kontoauszug eine PIN zur Aktivierung und damit Nutzung der App zu bekommen. Eine einfache Registrierung über Abfrage bestehender Sicherheitsmerkmale reicht "Hanse-Merkur" nicht aus. So wird die Re-Aktivierung des digitalen Kunden-Kanals bis zur Buchung über mehrere Tage verzögert.
Das laut Homepage achtköpfige Presseteam hielt es in den Wochen und Monaten vor dem Launch der aktualisierten Service-App laut Pressearchiv nicht für notwendig, Kunden über Presseinformationen zu informieren. Zwar bewarb die Pressestelle am Hamburger Dammtor ihren mit dem Kaffee-Röster "Tchibo" vermarkteten, von Experten scharf kritisierten "Krebs-Scan". Informationen zur Neueinführung der hauseigenen Kunden-App mit dazu erforderlichen Schritten gab es nicht.
-
Xing versucht vom Business-Netzwerk zur relevanten Recruting-Plattform zu werden.
 |
Der Innenhof des Unilever-Hauses - der New Work-Zentrale in Hamburg.
(Foto: New Work SE) |
Hamburg, 01.12.2023: Der Anbieter des ehemaligen Business-Netzwerks "Xing" - die zum Münchener Medienkonzern "Burda" gehörende "New Work SE" - setzt seinen Umbau zur B2B-Personal-Recruiting-Plattform fort. Die Zahlen des 3. Quartals hinter 227,4 Mio. € Gesamtumsatz zeigen die Veränderungen in den B2B- und B2C-Geschäftsfeldern des in der Hafencity gemanagten "Linkedin"-Erzrivalen.
Der größte und für die "Burda"-Tochter wichtigste Geschäftsbereich "HR Solutions & Talent Access" konnte sein Neun-Monats-Ergebnis um 7 Prozent auf 161,4 Mio. € steigern. Damit ist klar, wo "Xing" heute und in Zukunft sein Geld verdienen will. Auf der anderen Seite ging das Endkunden-Geschäft u. a. mit Premium-Accounts für "Xing" um 17 Prozent auf 56,4 Mio. € zurück.
Weil die Werbe-Klicks durch Verlagerung der Aktivitäten von Endkunden (B2B) auf Geschäftskunden (B2B) deutlich zurückgegangen sind, sank auch der Umsatz des kleinsten Geschäftsbereichs "Marketing" Solutions" in den ersten neun Monaten des Jahres um 22 Prozent auf 9,6 Mio. €. Damit ist auch die bisherige Strategie von "Xing" Geschichte, sich durch kommerzielle Medienkooperationen bei seinen Mitgliedern zu verankern.
Xing hat im ersten 3/4 Jahr '23 die Zahl seiner Mitglieder trotz der Markt- und Meinungsführerschaft von "Linkedin" auf 22 Mio. weiter erhöht. Das sind in etwa so viel, wie das zu "Microsoft" gehörende US-Netzwerk "Linkedin" allein in der DACH-Region ausweist. Weltweit sind aktuell rd. 850 Mio. Menschen Mitglieder des deutlich Community-orientierteren "Linkedin" - auch ohne Premium-Mitgliedschaft.
"Xing" gilt seit Jahren als schwerfälliges Netzwerk ohne Mehrwert. Das 2003 in Hamburg von Lars Hinrichs als "OpenBC" gegründete Unternehmen hat in den vergangenen Jahren u. a. durch Schließung seiner beliebten Xing-Gruppen weite Teile von Fach- und Führungskräften als aktive Nutzer verloren. In der international ausgerichteten Tech- und Startup-Szene ist "Xing" seit mehr als 10 Jahren abgeschrieben.
Der Pro-Forma-Gewinn des Konzerns mit "Xing", "Kununu" und "Onlyfy" vor Zinsen, Steuern und Abgaben nahm um 14 Prozent ab - auf 68,9 Mio. €. "New Work" beschäftigt rd. 1.900 Mitarbeiter u.a. an den Standorten Barcelona, Berlin, Boston, Hamburg, Porto, Wien, Valencia und Zürich.
Zu den größten Wettbewerbern im Geschäft mit Dienstleistungen rund um Personalwesen gehören die "Microsoft"-Tochter "Linkedin" mit rd. 13,8 Mrd. € weltweitem Umsatz in 2022 und der zu "Axel Springer" gehörende "Stepstone"-Konzern mit rd. 1,4 Mrd. €. Alle Geschäftsberichte von "New Work" können hier heruntergeladen werden. -
SPD will Scholz-Beweis-Mails Hamburger Cum-Ex-Ausschuss vorenthalten.
 |
Die Abgeordneten der Hamburgischen Bürgerschaft gerieten sich am Freitag in die Haare.
Foto: HANSEVALLEY |
Hamburg, 28.11.2023: Die SPD in der Hamburgischen Bürgerschaft versucht offenbar mit allen Mitteln, die Sichtung von rd. 730.000 E-Mails des ehemaligen Ersten Bürgermeisters Olaf Scholz, seiner früheren Büroleiterin im Bundesfinanzministerium, Jaenette Schwamberger, des damaligen Finanzsenators Peter Tschentscher und hochrangiger Hamburger Finanzbeamter durch die Mitglieder des Cum-Ex-Untersuchungsausschusses zu verhindern.
Nach dem Entwenden von zwei Laptops durch den U-Auschuss-Stabsleiter Steffen Jänicke Ende Oktober d. J. wollen die Sozialdemokraten die Sichtung der durch die Staatsanwaltschaft Köln Anfang Oktober d. J. bereitgestellten E-Mails nur zwei ihnen genehmen Stabsmitarbeitern zulassen - und damit versuchen, die Kontrolle über die für die Hamburger SPD-Politiker womöglich brisanten E-Mails behalten.
Dies erzwangen die Regierungsvertreter von SPD und Grüne am vergangenen Freitag per Beschluss in einer Sondersitzung des Cum-Ex-Untersuchungsausschusses. Auch die Obleute der Fraktionen sollen zunächst keinen Zugriff auf die von dem SPD-Funktionär Jänicke in einem Tresor seines Büros gelagerten Computer bekommen. Das zwei genehme Mitarbeiter des Arbeitsstabes die Mails vorab sichten dürften, sei bereits ein Kompromiss, so der immer wieder auffällige SPD-Obmann Milan Pein.
Die Linksfraktion in der Bürgerschaft legte am Montag d. W. (27.11.2023) einen eigenen Zwischenbericht unter dem Titel "Korruption liegt in der Luft - Die SPD und der Fall Warburg“ vor. Laut Linkspartei wurden alle Berichte über die Machenschaften des 176 Mio. € schweren versuchten Cum-Ex-Steuerraubs rund um rot-grünem Senat, Hamburger Finanzverwaltung und der Warburg-Bank aus dem Jahr 2020 durch den Ausschuss bestätigt.
Norbert Hackbusch, Obmann der Linken im U-Ausschuss brachte auf den Punkt: „SPD und Grüne betreiben im Ausschuss organisierte Arbeitsverweigerung. Vor allem die SPD-Mitglieder des Ausschusses sehen ihre wesentliche Aufgabe darin, das Handeln der Finanzverwaltung reinzuwaschen und – schon panikartig – jede Untersuchung des Handelns der politisch verantwortlichen Personen zu verhindern."
Der CDU-Obmann im Cum-Ex-Untersuchungsausschuss - Richard Seelmaecker - kündigte Klage gegen die Machenschaften von Rot-Grün im U-Ausschuss an, unterstützt von der Linkspartei im Hamburger Parlament. Grund: Mit dem Vorenthalten der E-Mails werden Rechte der Parlamentarier beschnitten. Die AfD erklärte sich ebenfalls bereit, juristisch gegen die SPD-Machenschaften vorzugehen.
SPD-Obmann Milan Pein - Ehemann von SPD-Stadtentwicklungssenatorin Karen Pein - polterte im Ausschuss, dass die Ausschussmitglieder streng genommen überhaupt kein Recht hätten, Einsicht in die E-Mails zu nehmen. Mit Einsicht in die E-Mails der Parteifreunde Scholz und Tschentscher könnten Grundrechte „irreversibel verletzt“ werden.
Der Ausschuss über die Verwicklungen des damaligen SPD-Bürgermeisters Olaf Scholz ("ich kann mich nicht erinnern") und seines damaligen SPD-Finanzsenators Peter Tschentscher wird von dem SPD-Ausschuss-Vorsitzenden und Ex-SPD-Landesvorsitzenden Mathias Petersen geleitet, begleitet von dem - bereits aus der versuchten "Dressel-Lumma-Millionenschieberei" um einen 9 Mio. € teuren und aus Corona-Mitteln geplanten Fintech-Accelerator - aufgefallenen SPD-Obmann Milan Pein.
In dieser Woche wird nach 3 Jahren und 1 Monat der offizielle Zwischenbericht des Cum-Ex-Untersuchungsausschusss veröffentlicht. Auf 1.000 Seiten und nach 50 Zeugenaussagen kommt der Bericht zu dem Zwischenfazit, dass Warburg-Banker Christian Olearius bei dem versuchten Steuerraub Hamburger Finanzbeamte hinters Licht geführt hat.
Der Ausschuss wird von einem staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahren gegen SPD-Spitzenpolitiker und gegen eine Hamburger Finanzbeamtin begleitet. Dadurch war es möglich, Einsicht in staatsanwaltschaftliche Akten zu bekommen. Die Staatsanwaltschaft äußert den bestürzenden Verdacht, dass Kommunikation innerhalb der Finanzbehörde zum Thema Cum-Ex bei Warburg zum Teil gelöscht oder bewusst gar nicht zu den Akten gegeben wurde.
-
Hamburger Datenschützer rügt Verweigerungshaltung der städtischen HHLA unter Ex-Postlerin Angela Titzrath.
 |
Machte sich schon bei der Post unbeliebt: HHL-Chefin Titzrath.
Foto: HANSEVALLEY |
Hamburg, 16.11.2023 *Update*: Der Datenschutzbeauftragte der Hafenmetropole hat die mehrheitlich zur Stadt Hamburg gehörende Container-Terminal-Gesellschaft HHLA wegen grundsätzlichen Verstoßes gegen die Informationsrechte nach dem Hamburgischen Transparenzgesetz öffentlich gerügt. Die bisher zu 69 % zur Hansestadt gehörende Hafengesellschaft unter Leitung der als selbstherrlich geltenden Vorstandschefin Angela Titzrath wiegelt die Auskunftspflicht generell mit der Begründung ab, keine öffentlichen Aufgaben wahrzunehmen und daher keine Auskünfte erteilen zu müssen.
Der Datenschutzbeauftragte widerspricht der sich auch in ihrer Pressearbeit verweigernden Aktiengesellschaft: Mit dem Betrieb des Container-Umschlags im Hamburger Hafen erfülle die HHLA eine öffentliche Aufgabe. Dies ergebe sich bereits aus der Präambel der Verfassung Hamburgs sowie der Rechtsprechung des Hamburgischen Oberverwaltungsgerichts. Die Behörde stellt fest: "Die Hafenentwicklung ist ein zentraler Teil der öffentlichen Aufgaben, die der Hamburger Hafen dem Gemeinwesen als Welthafenstadt nach der Präambel seiner Verfassung stellt".
Darüber hinaus gehört es zu den Aufgaben der HHLA, das UNESCO-Weltkulturerbe der Speicherstadt und den denkmalgeschützten Hamburger Fischmarkt zu verwalten und zu erhalten. Auch dies diene dem Gemeinwohl, so der Datenschützer. Nach dem HmbTG hat jede Person einen Anspruch auf Auskunft gegenüber Unternehmen, die von der Stadt kontrolliert werden. Nur soweit diese im Einzelfall keine öffentlichen Aufgaben erfüllen, können öffentliche Unternehmen ihre Auskünfte einschränken.
Die HHLA, deren Hafensparte zum Zeitpunkt der Rüge zu fast 70 % und deren Immobiliensparte zu 100 % von der Freien und Hansestadt Hamburg kontrolliert werden, ist der Öffentlichkeit damit nach dem Hamburger Transparenzgesetz rechenschaftspflichtig. Mit der Beanstandung hat der Datenschutzbeauftragte die HHLA aufgefordert, ihre Informationspflicht grundsätzlich zu akzeptieren. Sollte die HHLA dem nicht nachkommen, kann der Datenschützer gegen sie Klage vor dem Verwaltungsgericht erheben und gerichtlich dazu verpflichten, Auskünfte zu erteilen.
Die Beteiligungsunternehmen der Stadt Hamburg stehen in Fragen der Informationsfreiheit immer wieder im Fokus der Datenschutzbehörde. Bislang hat die unabhängige Einrichtung dreimal Betriebe der Stadt öffentlich gerügt - zuletzt den Flughafen Hamburg, der ebenfalls mehrheitlich zur Stadt gehört. Der Datenschutzbeauftragte fordert die Senatsvertreter in den Aufsichtsräten der öffentlichen Unternehmen auf, darauf hinzuwirken, dass die von der Stadt kontrollierten Unternehmen ihren gesetzlich festgelegten Informationspflichten nachkommen.
Die Hamburger Hafen- und Logistik-AG ist in den vergangenen Jahren immer wieder aufgrund selbstherrlich wirkender Verhaltensweisen aufgefallen. So verweigert die Presseabteilung der HHLA dem Hanse Digital Magazin seit Jahren die Übersendung von aktuellen Meldungen - offensichtlich aufgrund einer persönlichen und als unprofessionell zu bewertenden Ablehnung der unabhängigen Medienberichterstattung seitens des bisherigen Pressesprechers Hans-Jörg Heims und seiner Stellvertreterinnen.
HANSEVALLEY hatte sich vor einem Jahr mit den z. T. zweifelhaften Bemerkungen der HHLA-Chefin zu streikenden Terminalarbeitern und fragwürdigen PR-Aktivitäten um das Hamburger Container-Terminal Altenwerder (CTA) beschäftigt. Das HANSESTATEMENT mit dem Titel "Was erlauben Titzrath?" kann hier nachgelesen werden. Branchenkenner gehen davon aus, dass die auch in der Hamburger Wirtschaftsbehörde in Ungnade gefallene Titzrath mit dem Einstieg der Container-Reederei MSC demnächst ihren Stuhl räumen muss. Die Einkommens-Millionärin war vor ihrer Tätigkeit als "Hamburgs teuerste Azubine" Personalvorständin für den Konzern "Deutsche Post DHL". Hier wurde sie aufgrund eines eigenwilligen Verhaltens gegenüber den Konzerngesellschaften im Juli 2014 "aus persönlichen Gründen" verabschiedet.
-
Ralf Dümmel kauft Anteil der DS-Gruppe von Koflers Social Chain AG zurück.

Einst dicke Freunde: DS-Macher Ralf Dümmel und TV-Manager Georg Kofler |
| (Foto: Jens Oellermann) |
Stapelfeld/Berlin, 13.11.2023: Die verantwortlichen Unternehmer der schleswig-holsteinischen Postenhandels-Gesellschaft "DS Produkte" - Hanno Hagemann und Ralf Dümmel - kaufen den 24,46 %-igen Anteil der "DS Beteiligung" für 6,5 Mio. € zurück. Ursprünglich hatte Unternehmer Dümmel das Paket 2021 für 220 Mio. € in Bar und Aktien an die mittlerweile in der Insolvenz steckenden Berliner Marketingfirma "The Social Chain AG" von Georg Kofler verkauft.
3,5 Mio. € der Rückkaufsumme sollen in die Auszahlung von Gläubigern der Firma von Ex-"VOX-Löwe" Georg Kofler fließen. Mit den weiteren drei Millionen Euro sollen die Kredite von "DS" an "The Social Chain" bedient werden. Die Gläubigerversammlung der Marketing- und Social Media Business "Social Chain" haben dem Vorschlag bereits zugestimmt.
Zur "Übernahme" von "DS" durch "TSC" zitieren verschiedene Quellen eine Auslagerung von ursprünglich 24,46 % der "DS Holding" im Jahr 2000 an die "DS Beteiligung". Diese Gesellschaft wurde im Jahr 2021 als Dach von "Gesellschaften des DS-Teilkonzerns" für 220,5 Mio. € an die "The Social Chain AG" nach Berlin verkauft, wovon 100 Mio. € in bar an Ralf Dümmel geflossen sein sollen sowie weitere 120 Mio. € in Form von 2,8 Mio. neuer Aktien.
Die operativ verantwortliche "DS Produkte" und deren Muttergesellschaft "DS Holding" in Stapelfeld gehörten auch in den vergangenen Jahren zu rd. 75 % der verantwortlichen Segeberger Unternehmerfamilie Hagemann und sind vom Konkurs nicht betroffen gewesen. Die Gruppe wird von der Tochter des DS-Gründers Dieter Schwarz (DS), Daniela Hagemann (geb. Schwarz) geführt.
-
SPD-Funktionär versteckt Beweis-Laptops aus Cum-Ex-Ausschuss in seinem Privattresor.
 |
In der Hamburger Bürgerschaft macht die SPD womöglich, was sie will.
Foto: HANSVALLEY |
Hamburg, 06.11.2023: Der vor rund drei Jahren von der Hamburger Bürgerschaft eingerichtete Cum-Ex-Untersuchungsausschuss zur Aufklärung von rd. 280 Mio. € Kapitalertragssteuer, die die hanseatische Privatbank "M. M. Warburg" womöglich mit Unterstützung oder Billigung des damaligen Ersten Bürgermeisters Olaf Scholz und des früheren Finanzsenators Peter Tschentscher zu Unrecht erstattet bekommen haben soll, ist mit einem handfesten Skandal konfrontiert.
Aus einem Tresor in einem besonders gesicherten und für die Allgemeinheit verschlossenen Raum der Bürgerschaftskanzlei im Hamburger Rathaus sind zwei von der Kölner Staatsanwaltschaft als Beweismittel bereitgestellte Laptops mit insgesamt rd. 700.000 z. T. womöglich brisante E-Mails des damaligen Ersten Bürgermeisters, seiner früheren Büroleiterin Jaenette Schwamberger, des damaligen Finanzsenators Peter Tschentscher und hochrangiger Hamburger Beamter zunächst verschwunden.
Nach Recherchen von "Stern" und "Westdeutscher Allgemeiner Zeitung" hat der Leiter des Arbeitsstabs des Untersuchungsausschusses, Steffen Jänicke, die Laptops aus dem Tresor entwendet und versteckt diese nach jüngsten Informationen seit rd. zwei Wochen im persönlichen Tresor seines Büros. Den Obleuten der Parteien im U-Ausschuss teilte der SPD-Funktionär mit, er habe „verfügt, dass die Akteneinsicht sowie die Arbeit des Arbeitsstabes mit den Asservaten zunächst ausgesetzt wird“.
Die Oppositionsparteien in der Hamburger Bürgerschaft befürchten, dass sich die Sozialdemokraten durch das Entwenden der Laptops aus den Räumen des U-Ausschusses einen unfairen Vorteil verschaffen wollen, in dem sie ohne öffentliche Kontrolle die E-Mails auf den Laptops vorab sichten, ob es darin brisante Informationen zur Vorteilsnahme durch Scholz und seinen Hamburger Nachfolger Tschentscher geben könnte. Möglich ist auch, dass die für ihren "roten Filz" bekannte Hamburger SPD Kopien der Festplatten gemacht haben könnte.
Dabei spielt der Hamburger Verwaltungsjurist Steffen Jänicke eine besondere Rolle: Der Verfassungsschutz gab für den SPD'ler keine Unbedenklichkeitserklärung im Zusammenhang mit der Tätigkeit für den Untersuchungsausschuss ab. Alle mit vertraulichen Unterlagen im Zusammenhang mit dem Ausschuss werden zuvor routinemäßig vom Landesamt überprüft. Für Jänicke ein Problem:
Auf Grund familiärer Kontakte nach Russland und häufiger Reisen nach Moskau warnten die Verfassungsschützer Bürgerschaftspräsidentin Carola Veith, recherchierten "Manager Magazin" und "NDR" bereits zu Beginn des Jahres. Die SPD-Parteifreundin unternahm gegen den verdienten Genossen auf dem Posten des Chefermittlers im U-Ausschuss jedoch nichts. Die Abgeordneten im U-Ausschuss und die Mitarbeiter des Arbeitsstabes wussten nichts von den fragwürdigen Tatsachen um den Chefermittler. Jänicke selbst mauerte auf Journalistenanfrage.
Der Hamburger CDU-Bundestagsabgeordnete Christoph de Vries erklärte gegenüber dem Online-Nachrichtenmagazin "NIUS": "Es erhärtet sich einmal mehr der Verdacht, dass die Aufklärung über die Rolle von Olaf Scholz in diesem Steuerskandal mit allen Mitteln verhindert werden soll.“
Hintergrund: Die Laptops wurden von der Staatsanwaltschaft im Rahmen ihrer Ermittlungen gegen eine Hamburger Finanzbeamtin und zwei führende Genossen beschlagnahmt. Der Hamburger Cum-Ex-Ausschuss hatte die Rechner mit den E-Mails bereits im Jahr 2022 aus NRW angefordert. Der Grüne Justizminister Benjamin Lembach blockierte die Aushändigung jedoch über Monate, um Scholz und die Ampel-Koalition in Berlin zu schützen.
Der Hamburger Untersuchungsausschuss wurde eingerichtet, nachdem drei Treffen des damaligen Hamburger Bürgermeisters Scholz mit dem aktuell in Bonn wegen Steuerhinterziehung vor Gericht stehenden Privatbankiers Christian Olearius und dem Warburg-Miteigentümer Max Warburg aus den Jahren 2016 und 2017 durch die Tagebücher von Olerarius bekannt wurden.
Nach den ersten Spitzentreffen 2016 hatte das Finanzamt für Großunternehmen nach Eintreten der Verjährungsfrist zunächst auf 47 Mio. € Kapitalertragsteuer der "Warburg-Bank" verzicht. Der U-Ausschuss will klären, ob Scholz, Tschentscher & Co. um die Cum-Ex-Deals der "Warburg-Bank" wussten und diese womöglich deckten bzw. durchwinkten. Olaf Scholz konnte sich im Rahmen der Befragungen durch die Hamburger Abgeordneten zu keinem Zeitpunkt an irgendetwas erinnern.
-
Hamburger Leistungsvergleich "KERMIT" versagt bei digitalen Tests.
 |
Digitale Bildungstest sind in Hamburg dank Dataport kaum möglich.
(Foto: Deutsche Hospitality/John Schnobrich) |
Hamburg, 30.10.2023: Die an staatlichen Hamburger Schulen seit dem Schuljahr 2012/2013 in den Jahrgangsstufen 2 bis 9 jährlich durchgeführten Leistungstests zum Stand der schulischen Bildung werden bis heute kaum digital durchgeführt. So wurden im Schuljahr 2022/2023 an Alster und Elbe die regionalen Tests unter dem Titel "KERMIT" gerade einmal an 20 Klassen online gemacht. Dabei wurden in fünf Fällen die Tests auch noch abgebrochen. Im aktuellen Schuljahr liegt die Zahl bei stadtweit 57 digital getesteten Schulklassen - mit 17 technischen Ausfällen.
Zu den IT-Problemen gehörten u. a. ein komplett abgestürzter Server bei landeseigenen IT-Dienstleister "Dataport", nicht erreichbare Testseiten, unüberwindbare Jugendschutzfilter auf genutzten PCs der Schulen, nicht vorhandene Logindaten und Speicherprobleme der Online-Seite. Die Schulbehörde versucht sich in Ihrer Antwort auf eine Anfrage der Linksfraktion damit zu entschuldigen, dass es sich der Onlinetest noch in der Testphase befinde. Dieser läuft seit 2019 und damit bereits seit vier Jahren.
Konsequenz: In den 17 Fällen des Schuljahres 2022/2023 wurden die Tests in der sich gern als digitale Stadt verkaufenden Hansestadt mit Schulheften fortgesetzt. Laut Schulbehörde werden die Probleme bei den digitalen Leistungstests derzeit vom zuständigen Institut für Bildungsmonitoring und Qualitätsentwicklung untersucht. Dabei seien die Planungen zur Optimierung - sprich Vermeidung der technischen Pannen - für das kommende Schuljahr "noch nicht abgeschlossen". Somit müssen Schüler und Lehrer bis zur Sommerpause 2023 weiterhin mit fehlerhafter IT-Infrastruktur arbeiten oder den Test händisch durchführen.
Sabine Boeddinghaus, bildungspolitische Sprecherin der Linksfraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft ein Vollversagen der Bildungsbehörde:„Eine Ausfallquote von 20 bis 30 Prozent ist eine Blamage für die Schulbehörde. Dass Kermit seit Jahren als digitales Prüfungsformat erprobt wird, macht die Sache nicht besser, sondern schlimmer. Wo sind die Gelder aus den vielen Digitalpakten geblieben? Bei schulischen Tests haben sie offenbar nur bedingt zu einer verlässlichen Praxis geführt.“
Unter dem Titel "KERMIT" werden in allen Hamburger Grundschulen, Gymnasien und Stadtteilschulen in den Jahrgangsstufen 2, 3, 5, 7, 8 und 9 Tests durchgeführt, die ermitteln, ob die schulischen Leistungen der Hamburger Schülerinnen und Schüler den Anforderungen der nationalen Bildungsstandards und der Hamburger Bildungspläne entsprechen. Neben dem Test auf Papier gibt es seit vier Jahren auch die Möglichkeit, "KERMIT" online zu testen.
-
Förderralley sorgt im rot-grünen Niedersachsen für Schulen ohne Tablets, Notebooks und Whiteboards.
 |
Eine Reihe von Schulen in Niedersachsen bekommt keine Digitalmittel.
(Foto: Fancycrave, Pixabay) |
Hannover, 25.10.2023: In Niedersachsen erhebt sich Widerstand gegen eine Vergabepraxis der Landesregierung in Hannover für Fördermittel im Rahmen des "Digitalpakts Schule". Danach stehen den Schulen plötzlich keine Mittel mehr zur Verfügung, die über das Bildungsministerium vergeben werden. Dies sind 90 % Bundesmittel, ergänzt um 10 % Kofinanzierung durch das Land. Seit 1. Juli '23 ist das Programm überzeichnet, haben Schulen plötzlich keine Chance mehr.
Hintergrund: Um die im kommenden Jahr wegfallenden Gelder loszuwerden, führte das grün geführte Ministerium ein "Windhundverfahren" ein, sprich "wer zuerst kommt, malt zuerst." Deadline: zunächst 15. Mai, anschließend noch einmal verlängert bis zum 30. Juni 2023. Daraufhin gab es innerhalb weniger Wochen und Monaten 3.508 neue Anträge.
Unschön: Schulen, die bereits Gelder bewilligt bekommen hatten, aber ihr Budget noch nicht ausgeschöpft hatten, stellten ebenfalls Anträge. Das Programm war daraufhin innerhalb weniger Wochen überzeichnet, eine Reihe von Schulen gehen nun offenbar komplett leer aus. Noch vor einem halben Jahr waren rd. 40 % der 465 Mio. € für das größte norddeutsche Flächenland von den Schulen nicht abgerufen worden. Das waren rd. 279 Mio. €.
Der "Digitalpakt 1" wurde von Schwarz-Rot für die Jahre 2019 bis 2024 mit insgesamt 6,5 Mrd. €. finanziert, die allerdings in vielen Fällen von den Ländern nicht abgerufen wurden. Während der Corona-Pandemie wurden Anfang 2020 drei zusätzliche Fördertöpfe mit jeweils 500 Mio. € bereitgestellt. Dazu gehört ein Programm für Sofortausstattungen, eines für Leihgeräte für Lehrer und eines zur Finanzierung von IT-Administratoren in Schulen.
Das Kultusministerium der Grünen von Julia Wille Hamburg zeigte sich zufrieden mit den zusätzlichen Anträgen auf Grund des veränderten Verfahrens. Zur Überzeichnung bietet das Ministerium den betroffenen Schulen im Land keine konkrete Lösung an. Die Stellungnahme des Ministeriums kann hier nachgelesen werden. -
Hamburger CDU fordert Bündelung aller Digitalaktivitäten in der Wirtschaftsbehörde.
 |
Jens Unrau (links) zieht die Drähte einer erfolglosen Hamburger Kreativförderung.
(Foto: Senatsbehörde BKM) |
Hamburg, 23.10.2023: Die Kritik an der mehrfach umstrittenen Digitalpolitik des Senats hat nun auch den Breitbandausbau erreicht. Die CDU-Fraktion in der Hamburger Bürgerschaft fordert, die Zuständigkeit für Glasfaser-Leitungen an Alster und Elbe der Kultur- und Medienbehörde unter SPD-Senator und Scholz-Vertrautem Brosda zu entziehen und den weiteren Ausbau durch die Wirtschaftsbehörde steuern zu lassen.
Der CDU-Digitalpolitiker Sandro Kappe zweifelt eine priorisierte und engagierte Politik zur Breitband-Vernetzung in der Elbmetropole unter Leitung des für Kultur und Medien zuständigen Ressorts an. In der vergangenen Legislatur-Periode lag auch die Förderung von Tech-Startups mit Internet-Geschäftsmodellen in dem u. a. vom langjährigen Hamburger Berufsbeamten Jens Unrau (Foto links) mitgeleiteten Amt Medien - ohne ersichtlichen Erfolg.
Unter der Mitverantwortung von Unrau wurde stattdessen ein Personalmolloch mit rd. 50 Mitarbeitern für die Bereiche Medien-, Games-, Musik-, Design- und Kreativförderung geschaffen. Unter dem Dach der staatlichen "Kreativgesellschaft" verlor Hamburg in den vergangenen Jahren weiter seine Bedeutung als Medien- und Kreativstandort. Statt hoffnungsvolle Technologie-Ansätze mit ausreichender Förderung zu Keimzellen neuer Branchen zu entwickeln, versorgt die Behörde unter Funktionär Unrau ihre politische Klientel, wie den SPD-Funktionär Lumma mit "NMA".
"Die Bündelung sämtlicher Digitalisierungsthemen in der Wirtschaftsbehörde würde eine Vielzahl von Vorteilen mit sich bringen", sagte CDU-Poltiker Kappe. Der Bramfelder Abgeordnete begründet die in digital erfolgreichen Bundesländern wie Schleswig-Holstein übliche Bündelung der Digitalförderung: "Angefangen bei der Expertise und den Ressourcen, über eine gesteigerte Effizienz bis hin zu einer kohärenten Strategie und einer stärkeren Wirtschaftsförderung."
Am 8. November will die Union mit einem entsprechenden Antrag in der Bürgerschaft den Versuch unternehmen, die zersplitterte Digitalförderung in der Wirtschaftsbehörde zu bündeln.
-
Hamburger VW-Fahrdienst MOIA verweigert Fahrern den Gang zur Toilette.
 |
Außen "hui", innen einen ziemlich unsoziale "VW"-Tochter.
Foto: MOIA |
Hamburg, 23.10.2023: Der zum "Volkswagen"-Konzern gehörende, mehrfach in die Kritik geratene Sammel-Fahrdienst "MOIA" verbietet seinen Fahrern - davon 900 in Hamburg - im Ernstfall den Gang zu Toilette. Die bereits Ende September d. J. für ordentliche Arbeitsbedingungen in einen Warnstreik getretenen Fahrer müssen mit Stundenlöhnen kurz über dem Mindestlohn von Algorithmen abhängig arbeiten.
Das Problem: Die Fahrer werden durch ein eigenes Computerprogramm namens "Vehicle Guidance Assistance" gesteuert. Um zur Toilette gehen zu können, müssen sie einen digitalen Antrag stellen. Ob und wann die Genehmigung zur Pinkelpause gegeben wird, entscheidet der Computer. In Einzelfällen wurden dringend notwendige "Sonderpausen" einfach abgelehnt.
Brisant: Eine Reihe von Fahrern verzichtet während ihrer Schicht z. T. auf das Trinken, um nicht in Schwierigkeiten zu kommen. Eine kleine Anfrage der Linkspartei an den Senat zeigt, dass sich der Senat bei den sogenannten "Sonderpausen" auf die formale Position von "MOIA" zurückzieht. Der Senat erklärt lediglich: "MOIA" hat für die Durchführung von Sonderpausen neben den Pausenorten auf dem Betriebshof zusätzliche Pausenorte bei Partnerunternehmen im ganzen Stadtgebiet organisiert."
David Stoop, gewerkschaftspolitischer Sprecher der Hamburger Linksfraktion, kritisiert: "Der Senat kümmert sich wenig um die Arbeitsbedingungen und die Situation der Beschäftigten bei seinem Vertragspartner. Die Behauptung des Senats, Pinkelpausen seien für die Fahrer jederzeit möglich, steht im Widerspruch zu deren Aussagen. Als großes Zukunftsprojekt von VW und der Stadt Hamburg sollte es selbstverständlich sein, dass bei MOIA gute Arbeit zum Standard wird."
"MOIA" beförderte im vergangenen Jahr 1,4 Mio. Fahrgäste in der Hansestadt. In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres sind es laut offiziellen Angaben bereits 2 Mio. Kunden gewesen. Zum Jahresbeginn erweiterte die "VW"-Konzerntochter ihr Geschäftsgebiet auf Bereiche südlich der Elbe in Harburg. Das Geschäftsgebiet umfasst heute 200 Quadratkilometer mit 12.500 virtuellen Haltestellen. Damit erreicht "MOIA" bis zu 1,3 der 1,9 Mio. Einwohner Hamburg - vor allem im Osten und Westen der Stadt.
Das Berliner Unternehmen mit Fahrdiensten in Hannover und Hamburg hat im September d,. J. in der Spitze bis zu 330 umgebaute "VW-Crafter" rund um Alster und Elbe gleichzeitig im Betrieb gehabt. Im Durchschnitt sind es rd. 100 Kleinbusse im App-basierten Sammelfahrdienst. "MOIA" war in der Vergangenheit bereits auf Grund fehlerhafter Software in die Kritik geraten. HANSEVALLEY berichtete. -
Hansa-Taxi darf seinen Mitgliedern keine Fahrten über Free Now untersagen.
 |
Taxi-Zentralen versuchen immer wieder, Free Now auszubremsen.
Foto: Free Now |
Hamburg, 20.10.2023: Der Altonaer Taxi-Vermittler "Free Now" hat sich in letzter Instanz vor dem Bundesgerichtshof gegen die Hamburger Taxi-Zentrale "Hansa-Taxi 211 211" durchgesetzt. Nach dreijährigem Versuch der regionalen Funkvermittlung, ihren Mitgliedsbetrieben neben "Hansa-Taxi" die Nutzung von "Free Now" zu verbieten, ist damit vom Tisch. Vor Landgericht, Oberlandesgericht und Bundesgerichtshof holte sich "Hansa-Taxi" durchgehend Ablehnungen, ihr in der Genossenschaftssatzung verankertes "Doppelfunkverbot" durchzudrücken.
Während Fahrdienste von "Bolt", "Free Now" oder "Uber" selbstverständlich gleichzeitig oder wechselnd mit zwei oder mehr Vermittlern unterwegs sind, wollte "Hansa-Taxi" mit einem Verbot ihren angeschlossenen Betrieben monopolartig verbieten, neben der Funkzentrale Fahrten über "Free Now", "Sixt Taxi" oder "Uber X" vermittelt zu bekommen. Dagegen ging "Free Now" juristisch vor. Sämtliche Gerichts- und Anwaltskosten tragen nun die Mitglieder der Hamburger Genossenschaft.
In Bremen versuchte der dortige Vermittler "Taxi-Ruf 14 0 14", seinen Mitgliedern Werbung an den Fahrzeugen für Vermittlungs-Dienste wie "Free Now" zu verbieten. Diese Vorschrift hat die Vereinigung Bremer Kraftdroschkenbesitzer bereits 2014 in die allgemeine Betriebsordnung geschrieben. Nachdem sich die Verantwortlichen von "14 0 14" verweigerten, eine Unterlassung abzugeben, sah sich "Free Now" genötigt, mit einer einstweiligen Verfügung das Werbeverbot zu beenden.
Der bremische "Taxi-Ruf" ging gegen die Maßnahme von "Free Now" nicht weiter vor, so dass das Landgericht die einstweilige Verfügung - wie andere Gericht in Deutschland zuvor bereits - bestätigte. Damit dürfen organisierte "Kraftdroschkenbesitzer" an der Weser sich über die "14 0 14" Fahrten vermitteln lassen und gleichzeitig mit "Free Now"-Werbung unterwegs sein.
-
Gescheiterte Millionen-Schieberei für Fintech-Accelerator kostet Hamburger Steuerzahler fast 650.000,- €.
 |
Ist für die versuchte Millionen-Schieberei verantwortlich: SPD-Finanzsenator Andreas Dressel
Foto: HANSEVALLEY |
Hamburg/Berlin, 18.10.2023 *Update*: Der von Hamburgern als "roter Filz" kritisierte Versuch des SPD-Finanzsenators Andreas Dressel, neun Millionen Euro Corona-Mittel an seinen Parteifreund Nico Lumma für einen Fintech-Accelerator ohne Ausschreibung zu vergeben, kostet die Steuerzahler an Alster und Elbe trotz Absage der "Millionen-Schieberei" unter dem Strich 649.500,- €. Das kritisiert der Bund der Steuerzahler in der aktuellen Ausgabe 2023 des "Schwarzbuches" zur Steuerverschwendung durch den Staat.
Von den neun Millionen Euro Steuergeldern sollte der umstrittene Parteifunktionär Nico Lumma mit seinem "Next Media Accelerator" allein 1,3 Mio. € als Honorar erhalten und damit die durch die Corona-Pandemie im Jahr 2021 mit mehr als 200.000,- € in die roten Zahlen gerutschte Firma auf Steuerzahlerkosten retten. Lumma ist mit seiner "Lumma Enterprises UG" Gesellschafter am Accelerator-Programm "NMA".
Der Parteifunktionär hat nach aktuellen Informationen seit Sommer 2020 an dem Projekt für ein öffentlich gefördertes Startup-Programm gearbeitet – "ohne Auftrag, ohne Vertrag und ohne Ausschreibung", so der Steuerzahlerbund. Erst ein Jahr später teilte die Finanzsbehrde im Juli 2021 in einer verpflichtenden „Ex-ante-Bekanntmachung“ mit, dass man das Projekt ohne Ausschreibung an Lumma und seinen Partner Christoph Hüning vergeben wolle.
Die EU-Kommission und der Wissenschaftliche Dienst des Bundestags nahmen den Fall unter die Lupe. Laut Medienbericht kritisierte die EU-Kommission: „In dem dargelegten Fall ist es nicht ersichtlich, weshalb es nur einen bestimmten Anbieter geben könne, der die gewünschte Leistung erbringen kann.“ Nach regelmäßiger Berichterstattung von "Mopo" und "HANSEVALLEY" sowie Kritik von Linkspartei und der CDU gab SPD-Finanzsenator Dressel das Projekt Mitte Januar '22 auf.
Die SPD-Vertreter im zuständigen Haushaltsausschuss der Bürgerschaft schoben die Schuld für das Scheitern auf die Medienberichterstattung: Wegen der öffentlichen Debatte würden die privaten Kofinanzierungsmittel nicht mehr zusammenkommen. Daraufhin forderte die Firma von Genosse Lumma die Erstattung ihrer Kosten. Das Unternehmen berief sich auf einen inzwischen bestehenden Vertrag.
Auf Basis eines Schiedsspruches wurde der Schadenersatz für "NMA" und Lumma auf 370.000,- € festgesetzt. Kosten von weiteren 55.000,- € entstanden der Finanzbehörde bei "Werbemaßnahmen" für den Accelerator sowie für das Schiedsgericht. Hinzu kommen Rechtsberatungskosten in Höhe von 224.000,- €. Der Steuerzahlerbund stellt abschließend fest: "Unterm Strich zahlt der Steuerzahler also 649.500 Euro für – nichts."
Der Bund der Stauerzahler kommentierte zu den mehr als einer halben Million Euro Kosten für die Aktion der SPD-Parteigenossen: "Der Fall zeigt, dass das Einhalten gesetzlicher Vorgaben auch überwacht werden muss. Der finanzielle Verlust der Stadt Hamburg ist gravierend und der Imageschaden beträchtlich." HANSEVALLEY hatte auf Initiative der Linkspartei und zusammen mit der "Hamburger Morgenpost" öffentlichen Druck auf den Senat ausgeübt, um die "Millionen-Schieberei" zu unterbinden.
Mittlerweile hat die staatliche Wirtschaftsförderung unter SPD-Wirtschaftssenatorin und Parteichefin Melanie Leonhard den umstrittenen Parteifunktionär mit einem lukrativen Beraterauftrag für ein städtisches Startup-Förderprogramm zur Ansiedlung ausländischer Jungunternehmen versorgt ("Scaleup Landing Pad Hamburg"). Die Hansestadt ist als einst zweitgrößter Fintech-Standort auf einen bundesweit 5. Platz abgerutscht. An Alster und Elbe gibt es laut des letzten veröffentlichten "German Fintech Report" mit Stand Juli '21 lediglich 55 junge, schnell wachsende Unternehmen der Finanzbranche.
-
Senat verweigert digitale Abstimmung zur Volksabstimmung gegen das Gendern.
 |
Der Senat kümmert sich nicht um eine digitale Lösung für Volksbegehren.
(Foto: Liggraphy2, Pixabay) |
Hamburg, 17.10.2023: Der rot-grüne Senat der Hansestadt ist aktuell nicht in der Lage, das Volksbegehren gegen das Gendern in Verwaltungen und Schulen auch online durchzuführen. Der ideologisch geprägte Senat bremst durch Nichtstun eine erfolgversprechende Durchführung der Abstimmung mit einer Mindestzustimmung von 66.000 bzw. 5 % stimmberechtigten Hamburgern aus.
Die Stadtregierung erklärte auf eine Anfrage der CDU-Fraktion in der Bürgerschaft: „Eine nähere Ausgestaltung in der Volksabstimmungsverordnung sowie die Entwicklung und Implementierung eines technischen Verfahrens ist bisher nicht erfolgt.“ Damit ist die Initiative "Verein Deutsche Sprache e. V." gezwungen, den Antrag für das Volksbegehren bis Mitte Januar '24 zu beantragen.
Jens Jeep, einer der Vertrauensleute der Hamburger Initiative, übersetzt die abwiegelnde Antwort des Senats: „Einfach ausgedrückt: Haben wir nicht. Machen wir nicht.” Der Notar sieht die verfassungsmäßigen Grundrechte gebrochen: „Damit verstößt der Senat gegen das Volksabstimmungsgesetz. Dieses sieht die Online-Unterstützung eines Volksbegehrens als Bürgerrecht vor.“ Jeep kündigt eine Beschwerde vor dem Landesverfassungsgericht an.
Die Union kritisiert in ihrem Antrag die Verzögerung der gesetzlich ausdrücklich berücksichtigten Digitallösung zur Durchführung von Volksabstimmungen: "Das Volksbegehren würde dann ab dem 10. Juli 2024 mit der Briefeintragung starten. Die Hamburger Sommerferien starten kurz darauf am 18. Juli 2024. Das Volksbegehren fände daher fast vollständig während Hamburger Sommerferien statt."
Im Juli dieses Jahres übergab die Initiative mehr als 10.000 Unterschriften von Hamburgern, die sich für eine Volksabstimmung zur Beendigung des Genderns in öffentlichen Einrichtung an Alster und Elbe aussprachen. Ob der Senat die Entwicklung einer digitalen Lösung für Abstimmungen vorsätzlich verschleppt, bleibt offen.
-
Hamburger CDU fordert umfassende Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks.
 |
Der Newsroom von ARD aktuell beim NDR-Fernsehen.
(Foto: NDR/Sker Freist) |
Hamburg, 12.10.2023 *Update*: Der öffentlich-rechtliche Rundfunk soll jünger und digitaler werden. Das fordert die CDU-Fraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft. Die Christdemokraten haben einen umfassenden Antrag zur Reform des ÖRR erarbeitet. Dieser enthält insgesamt acht Punkte, wie das als staatsnah geltende Radio und Fernsehen für breite Bevölkerungsgruppen wieder attraktiver wird. Prof. Götz Wiese, medienpolitischer Sprecher der CDU-Bürgerschaftsfraktion: „Wir wollen den ÖRR, eine Säule unserer freiheitlichen Demokratie, stärken, die regionale Berichterstattung ausbauen und das gesamte Programm jünger, frischer und digitaler machen. Dazu gehört eine benutzerfreundliche Mediathek. Es gibt zig Apps für den ÖRR, aber nur einen YouTube- oder Netflix-Button. Hier muss radikal umgedacht werden."
Der Hamburger CDU-Politiker fordert ein radikales Abspecken: "Sämtliche Doppel- und Mehrfachstrukturen gehören auf den Prüfstand, die Sender müssen besser zusammenarbeiten und Programme weglassen, wenn man diese von einem anderen Sender übernehmen kann. Dies setzt Mittel für die Redaktionen vor Ort frei. Hier müssen die Parlamente im Programmauftrag klare Leitlinien vorgeben. Nur so lassen sich die Kosten in den Griff bekommen."
Statt für alte Filmer 4,99 € pro Quartal mehr kassieren zu wollen, sollen ARD, ZDF und DLF neue, junge Formate entwickeln: "Das durchschnittliche Alter der Fernsehnutzerinnen und -nutzer liegt bei rund 60 Jahren. Die Frage ist erlaubt, warum dann 20-Jährige dafür bezahlen sollen. Digitale Formate sind entscheidend, um den ÖRR für junge User so attraktiv zu machen wie andere Angebote im Netz. Ohne Nachwuchs kein ÖRR, so einfach ist das."
Zusammenfassend platziert Wiese eine Schelte zur Einseitigkeit in öffentlich-rechtlichen Redaktionen: "Das Thema Nachwuchs gilt auch für die Redaktionen. Diese sollen sich nicht weit überwiegend aus städtischen, akademischen und (links-)liberalen Milieus rekrutieren, sondern die ganze Breite abdecken: Stadt und Land, die ganze demokratische Gesellschaft, 360 Grad.“
Die Linken in der Hamburger Bürgerschaft wollten das Thema bei der Sitzung am Mittwoch (11.10.2023) gern im zuständigen Ausschuss für Kultur- und Medienfragen weiter erörtern. Rot und Grün schmetterten den Antrag mit der Begründung ab, dass eine Reihe von Maßnahmen bereits in der Umsetzung seien und man doch die Vorschläge des Zukunftsrates zur Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks abwarten solle. Der in Hamburg beheimatete NDR gilt als SPD-freundlich.
Details gibt es im Antrag der CDU-Fraktion der Hamburgischen Bürgerschaft (Word-Download). -
Anhörung im Landtag macht für MV unzureichende Förderung der Wissenschaft öffentlich.
 |
Im Landtag wurde kritisch zur Wissenschaftsförderung in MV diskutiert.
Foto: Landtag MV |
Schwerin, 10.10.2023: Im Wissenschaftsausschuss des Landtags von Mecklenburg-Vorpommern gab es in der vergangenen Woche eine Anhörung zum geplanten Doppelhaushalt 2024/2025. Die wissenschaftspolitische Sprecherin der CDU-Fraktion, Katy Hoffmeister, äußert sich nach der Ausschuss-Sitzung zu den äußerst kritischen Schilderungen von Experten zur Situation der Wissenschaft im Nord-Osten:
„Die Anzuhörenden haben heute ein dunkles Bild vom Wissenschaftsstandort Mecklenburg-Vorpommern gezeichnet. Die Förderung von Wissenschaft und Forschung durch die Landesregierung sei nicht im Ansatz ausreichend. Schlimmer noch, die Hochschul- und Wissenschaftslandschaft in Mecklenburg-Vorpommern fühle sich noch nicht einmal ausreichend wahrgenommen."
Die Kühlungsborner Juristin weiter: "So fehle es an einem deutlichen Bekenntnis der Landesregierung zu Forschung und Wissenschaft und dies spiegle sich im Entwurf des Doppelhaushalts auch wider. Im bundesweiten Vergleich und auch im Vergleich der norddeutschen Hochschulen sei Mecklenburg-Vorpommern unterdurchschnittlich ausgestattet. Eine Anzuhörende äußerte sogar deutlich, dass Mecklenburg-Vorpommern Spitzenforschung verschenke."
Die langjährige leitende Mitarbeiterin der Universitätsmedizin Rostock fordert: "Wir werden deshalb während der Haushaltsberatungen einfordern, dass die Grundsatzfinanzierung des Wissenschaftshaushaltes komplett überarbeitet wird. Dazu gehört, dass die globalen Minderausgaben nicht erneut aus dem Haushalt der Hochschulen erwirtschaftet werden dürfen, der Hochschulbaukorridor erhöht und die Landeszuschüsse an die Inflation angeglichen werden müssen. Ambitionierte Investitionen in unseren Wissenschaftsstandort Mecklenburg-Vorpommern bringen eine Bildungsrendite, die wir nicht unterschätzen und im Sinne einer Fachkräftegewinnung auch nicht brach liegen lassen dürfen."
-
Hamburger Finanzbehörde hinkt bei neuer Grundsteuer-Berechnung bundesweit hinterher.
 |
Die Finanzbehörde hat sich wohl einmal mehr "schön geredet".
Foto: HANSENVALLEY |
Hamburg, 09.10.2023: Die von SPD-Finanzsenator Andreas Dressel geführte Finanzbehörde hat offenbar massive Probleme mit der Bearbeitung von Grundsteuer-Erklärungen. Danach wurden an Alster und Elbe bislang lediglich 42 Prozent der Grundsteuer-Erklärungen bearbeitet. Im Vergleich der 16 Bundesländer ist dies der letzte Platz.
Grund für das Versagen der Behörde sind laut "Spiegel" Schwierigkeiten bei einer Softwareumstellung. Zugleich redet sich die Dressel-Behörde die rote Laterne bei der Bearbeitung von Grundsteuer-Erklärungen schön. So sei man "grundsätzlich im Zeitplan".
Hamburg verfolgt ein eigenes, grundsätzlich einfacheres Grundsteuer-Modell, als der Bund. Allerdings ist dies bei der Ersterfassung aufwändiger, so eine Behörden-Sprecherin gegenüber dem "Spiegel". Dahinter stehe der Umstand, dass nur wenige Prüfungen automatisch erfolgen.
Zugleich versucht die Finanzbehörde, sich einen fiktiven Erfolg zuzuschreiben. So sei die Abgaben-Quote bei rechnerisch 98 %, wenn man doppelt abgegebene Erklärungen rausgerechnet. Immobilienbesitzer rufen ihrerseits dazu auf, gegen die Grundsteuer-Wertbescheide Einspruch einzulegen, da es verfassungsrechtliche Bedenken gibt.
Bundesweit am weitesten ist laut Spiegel-Erhebung im Zeitraum 31.08. bis 30.09.23 die Freie Hansestadt Bremen mit 92 % Bearbeitungsquote. Im Norden folgt Niedersachsen auf Platz vier mit 82,9 % fertigen Bescheiden. Schleswig-Holstein folgt auf dem siebenten Platz mit 70,2 %. Selbst Mecklenburg-Vorpommern kann auf dem 12. Platz mit 62,9 % Bearbeitungsquote zufrieden sein.
-
Rechnungshof kreidet Landesregierung in Schwerin schleppende Digitalisierung an.
 |
Der Rechnungshof legt den Finger in die digitale Wunde der rot-roten Landesregierung.
Foto: LRH MV |
Schwerin, 06.10.2023: Der Landesrechnungshof von Mecklenburg-Vorpommern hat in seinem Jahresbericht für das Haushaltsjahr 2021 auf 200 Seiten die rot-rote Landesregierung massiv für eine schleppende Digitalisierung der Verwaltung kritisiert. Die Präsidentin der Aufsichtsbehörde spricht offen von einem "Organisationsversagen" der Landesregierung.
Makaber: Dem nord-östlichen Bundesland fehlt es nicht etwa an Geld. Im Haushalt 2021 stand beispielsweise 395 Mio. € für die digitale Verwaltung zur Verfügung. Doch davon wurden nur 151 Mio. € abgerufen. Ein Trend der seit 2019 anhält. Folge: Von 3.421 Bürgerservices auf Kommunal- und Landesebene sind nur gut 160 heute digital verfügbar.
Die Kritik richtet sich gegen die SPD-Staatssekretärin im Schweriner Innenministerium, Ina-Maria Ulbrich. Sie gilt als Hauptverantwortliche für die Digital-Misere in MV. Die Juristin ist seit Jahren zuständig für die Digitalisierung in der Verwaltung in Mecklenburg und Vorpommern.
Ulbrich verteidigte sich gegenüber NDR MV und wirft dem Rechnungshof vor, alte Zahlen zu veröffentlichen: Heute seien 245 Verwaltungsleistungen online verfügbar, 187 davon flächendeckend, z. B. Wohngeldanträge. Im Ländervergleich liege Mecklenburg-Vorpommern damit auf Platz 6, vor Bundesländern wie Baden-Württemberg oder Nordrhein-Westfalen.
Die Rechnungsprüfer von Mecklenburg-Vorpommern gehen noch weiter: Vom landeseigenen IT-Dienstleister wurde ein eigener Computer-Arbeitsplatz names "Vita 3.0" entwickelt. Der Deskop-Client mit für klassische PCs lässt die Nutzung von Cloud-Services weitgehend außen vor. Dafür müssen die Behörden als Kunden jedoch bis zu 1.500,- € pro Jahr zahlen.
Schließlich kommt das IT-Zentrum DVZ des Landes selbst in die Schusslinie: In der Landesverwaltung seien oft Uralt-Rechner im Einsatz. Der landeseigene Dienstleister beschäftige auch Software-Entwickler "rechtswidrig und unwirtschaftlich". Die angebotenen Leistungen gegenüber dem Land seien schließlich oft zu teuer und das Land prüfe nicht die Wirtschaftlichkeit.
"Es ist dramatisch, dass das Land bei der Digitalisierung nicht in die Gänge kommt", pointierte Rechnungshof-Präsidentin Martina Johannson am Donnerstag in Schwerin. "Es hapert an der Umsetzung und das geht an manchen Stellen schon in Richtung Organisationsversagen", so die oberste Finanzaufseherin des Landes gegenüber dem NDR.
-
Online-Kfz-Anmeldung verzögert sich in Schleswig-Holstein bis Anfang 2024.
 |
In Zukunft sollen Kfz-Anmeldungen weitgehend online möglich sein.
Foto: Kroschke Gruppe |
Kiel, 15.09.2023: Die flächendeckende Internet-KfZ-Zulassung in Schleswig-Holstein verschiebt sich nach aktuellen Informationen auf Januar 2024. Eigentlich sollte die digitale Möglichkeit, sein Auto online an- oder ummelden zu können, nach den Sommerferien zum 1. September d. J. starten. Die FDP-Opposition im Kieler Landtag kritisierte umgehend Digitalisierungsminister Dirk Schrödter.
Laut Informationen aus Kieler Regierungskreisen verlautete, dass der zuständige IT-Verbund für Schleswig-Holstein mit der Komplexität des digitalen Prozesses überfordert gewesen sein soll. Der ITV.SH ist zuständig für die kommunale Verwaltungsdigitalisierung in den 11 Kreisen zwischen Nord- und Ostsee.
Ein Grund ist offensichtlich die unterschiedliche Geschwindigkeit bei der Umsetzung von "iKFZ" in den Kreisen: Die Kieler Stadtamtsleiterin Jutta Schlemmer erklärte zur aktuellen Situation: „Wir waren schnell und stehen mit der Umsetzung an der Ziellinie.“ Jörn Klatt, Chef der Zulassungsstelle im Kreis Rendsburg-Eckernförde, erwidert: „Wir hoffen, dass die Einführung so schnell wie möglich gelingt.“
Eigentlich kann die An- und Ummeldung bereits seit 2019 online durchgeführt werden. Bisher mussten Fahrzeughalter anschließend drei bis fünf Tage auf die per Post von den Zulassungsstellen per Post verschickten Unterlagen. Neu ist ein zehn Tage gültiger, digitaler Zulassungsbescheid, der direkt ausgedruckt werden kann, um sofort loszufahren. Dieser Dienst ist auch für Autohäuser und Flottenbetreiber verfügbar.
Voraussetzung für die Nutzung der digitalen Kfz-Anmeldung ist die Nutzung der Online-Funktion auf dem Personalausweis (eID). Laut Lübecker Nachrichten ist bislang die Datensicherheit und die Akzeptanz von Bezahlverfahren nicht allumfassend geklärt.
-
Ratten im Lebensmittel-Lager. Juristen, die Arbeitnehmer niedermachen. Und jetzt neu: Apps, die Gutscheine nicht einlösen und Supporter, die nur abwimmeln dürfen. Willkommen bei FLINK - dem "Elite"-Absolventen-Startup mit den flinken Fingern in fremden Brieftaschen.
 |
Lassen nicht nur engagierte Fahrer über die Klinge springen ...
Grafik: Flink |
Sie sind vermeintliche "Elite"-Absolventen teurer Privat-Hochschulen, wie der EBS in Oestrich-Winkel im teuren Taunus oder der WHU in Vallendar bei Koblenz im Wald. Ihre Karrieren sind so glatt wie ihre von prekären Arbeitnehmern zum Mindestlohn gebügelten weißen oder hellblauen Oberhemden - wahlweise auch unter scheinbar demokratisch wirkenden Werbe-Hoodies. Ihr Lebenslauf beginnt bei Unternehmensberatungen oder Investmentgesellschaften, wie Bain & Company, KPMG oder SoftBank. Ihre Karriere in Berliner Startups starten Sie nicht selten in Rocket Internet-Firmen, wie Foodora oder Home24. Gelernt ist gelernt.
Die Generation CxO vornehmlich Berliner Jungunternehmer hat in Studium, Beratung und Traineeprogramm vor allem eines verinnerlicht: "more for less", sprich: mehr Output für weniger Input. Oder wie es ihre übervorteilten Kunden auf den Punkt bringt: "Abzocker, Betrüger, Räuber". Davon kann jeder Kunde eines der bekannten Consumer-Startups mindestens ein Lied singen: Mal wird nicht geliefert, was bestellt war, mal spielt der Kundendienst mit einer Junior-Praktikantin "toter Käfer". Mal ist das Herauspressen des letzten Euro teil des Geschäftsmodells - inkl. Apps. Beispiel: Der Berliner Schnell-Lieferdienst "Flink". Genau, die mit den gewerkschaftsfeindlichen Manieren.
-
Warnhinweis: Dieser Beitrag kann auf Grund qualifizierter Schilderungen unhygienischer Umstände deutliche Würgereize hervorrufen. Empfindliche Leser werden gebeten, besser in hygienische Hotels wie Motel One oder Premier Inn einzuchecken. Dies ist keine Werbung.
 |
Außen "so lala", innen dafür richtig zum Kotzen: das 25hours The Trip.
Foto: HANSEVALLEY |
-
Digitalstrategie der Bundesregierung ein Jahr nach Veröffentlichung in alle Einzelteile zerlegt.
 |
Der Bikom zerlegt die Digitalmaßnahmen der Bundesregierung.
Grafik: Bitkom |
Berlin/Köln: Ein Jahr nach Vorstellung der Digitalstrategie der Bundesregierung ist das Zwischenergebnis ernüchternd: Von 334 geplanten Einzelvorhaben der 16 Bundesministerien laut Koalitionsvertrag vom Dezember '21 und Digitalstrategie aus August '22 sind aktuell gerade einmal 38 Vorhaben (11 %) umgesetzt worden, 219 (66 %) sollen sich in der Umsetzung befinden, veröffentlicht der Digitalverband Bitkom die aktuellen Zahlen aus dem Berliner Regierungsviertel: Erschreckend: 77 Vorhaben (23 %) wurden noch gar nicht begonnen. Damit schweben rd. 1/4 alle geplanten Digitalprojekte bis heute in der Luft.
Der Stillstand in der Digitalpolitik kommt mit voller Wucht bei den Deutschen an: 86 % sind der Meinung, die aktuelle Digitalpolitik passe nicht zu dem im Koalitionsvertrag formulierten Vorsatz der Ampel-Koalition, Deutschland zu einem Vorreiter in Sachen Digitalisierung zu machen, stellt der Internet-Branchenverband Eco e. V. fest. So sieht die überwiegende Mehrheit der Deutschen (70 %) keine Fortschritte in wichtigen Bereichen der digitalen Transformation in Deutschland. Großen Entwicklungsbedarf sehen die Deutschen vor allem in den Bereichen Digitalisierung von Behörden und Verwaltung (63 %), Ausbau der digitalen Infrastruktur (54 %) und Cybersicherheit (32 %).
„Dieses harte Urteil der überwiegenden Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland überrascht leider nicht wirklich. Selbst wir als Vertreter der Internetwirtschaft haben immer wieder die fehlende Konsistenz in den Umsetzungsvorhaben und eine Verantwortungsdiffusion in strategisch relevanten Bereichen der digitalen Transformation in Deutschland kritisiert“, so Eco-Geschäftsführer Alexander Rabe, Mitglied des von der Bundesregierung einberufenen Beirats Digitalstrategie. Ursächlich für den schleppenden Fortschritt seien laut Rabe vor allem mangelhafte Koordination und eine Verantwortungsdiffusion in der Bundesregierung, wenn es um Themen der digitalen Transformation geht.
Aktuelle Streitpunkte: Für einen neuen "Digitalpakt 2.0" ab 2024 für die digitale Ausstattung der Schulen stehen im Haushalt für das kommende Jahr keinerlei Mittel zur Verfügung. Der Digitalpakt 1 wurde von Schwarz-Rot für die Jahre 2019 bis 2024 mit insgesamt 6,5 Mrd. €. finanziert, die allerdings in vielen Fällen von den Ländern nicht abgerufen wurden. Auch das geplante "Digitalbudget" der Bundesregierung existiert aktuell nur auf dem Papier. Weder im laufenden Haushalt 2023 noch im Entwurf für 2024 ist ein einziger Euro für wichtige, Ressort-übergreifende Digitalprojekte eingeplant.
Auch beim "Online-Zugangsgesetz" (OZG) zur Digitalisierung der Verwaltung auf Bundes, Landes- und Kommunalebene gibt es kaum Fortschritte. Das Ziel, bis Ende 2022 insgesamt 575 Verwaltungsleistungen zu digitalisieren, ist krachend gescheitert. Mit Stand August '23 sind laut offiziellem OZG-Dashboard in Hamburg lediglich 215, in MV 180, in SH 178, in Niedersachsen 160 und in Bremen 152 Leistungen digital verfügbar.
Nicht genug: Auch bei der Digitalisierung des Gesundheitswesens hinkt Deutschland weiterhin massiv hinterher: Theoretisch können gesetzlich Krankenversicherte seit Anfang 2021 ihre Gesundheitsdaten digital in einer "Elektronischen Patientenakte" (ePA) abspeichern. Bisher haben lediglich 1 % der 73 Mio. € Versicherten die Handy-App eingerichtet. Künftig sollen dies zwangsweise automatisch passieren, um auf 80 % Nutzerschaft zu kommen.
-
Bremens Finanzsenator fällt Digitalisierungschaos für Beihilfeanträge auf die Füße.
 |
Beim Bremer Dienstleister "Performa Nord" klappt es nicht mit der Beamten-Beihilfe.
Foto: SK Bremen |
Bremen, 28.08.2023: Der landeseigene Verwaltungs-Dienstleister der Freien Hansestadt - "Performa Nord" - gerät zunehmend in die Kritik. So warten laut Medienbericht Beamte über Monate, um ausgelegte Leistungen im Rahmen der Beihilfe-Krankenversicherung rückerstattet zu bekommen. In Einzelfällen sollen die Außenstände mehrere tausend Euro betragen.
Laut der Bremer Nachrichten-Sendung "Buten und Binnen" stapeln sich beim Verwaltungs-Dienstleister tausende von Akten mit unbearbeiteten Erstattungsanträgen. Für Beobachter soll die Digitalisierung bei dem bundesweit für rd. 200 Kunden tätigen Service-Unternehmen hinter den Erwartungen hinterherhinken.
"Performa Nord" kümmert sich u. a. um Abrechnungen für Mitarbeiter von Verwaltungen, die Beihilfe und Versicherungsleistungen sowie Jobtickets und Dienstreisen von Beamten, das Bürgertelefon in Bremen und Bremerhaven sowie weitere Dienstleistungen u. a. für die Bremischen Senatsressorts.
Der Bremer FDP-Bürgerschaftsabgeordnete Marcel Schröder weist auf den Rückstand im Landesbetrieb des Finanzsenators im Vergleich zu anderen Bundesländern hin. So können im benachbarten Niedersachsen Beamte seit rd. einem Jahr Beihilfe-Anträge per App stellen. Rund die Hälfte der Anträge werden dort digital gestellt.
Auch beim Erzrivalen Hamburg und in Schleswig-Holstein können Beamte Beihilfe-Anträge bereits digital eingeben. Nun soll dies eventuell auch in Bremen möglich werden. Am kommenden Jahr sollen die Anträge an der Weser ebenfalls per App gestellt werden können. Die Genehmigung selbst kann aber erst ab 2025 digital werden.
Begründung des Senats auf Anfrage der CDU in der Bremischen Bürgerschaft: Dem zentralen norddeutschen IT-Dienstleister "Dataport" fehle das notwendige Personal. Doch "Dataport" hat offenbar gar kein Personalproblem. Der IT-Dienstleister arbeitet seit einem Jahr an dem digitalen Beihilfeverfahren für Bremen. Die Kieler parieren die Schuldzuweisung aus Bremen mit der Information, dass der Senat sich noch gar nicht für eine App entschieden habe.
Das Bremische Beihilfe- und Digitalisierungschaos scheint nicht neu zu sein. Der Landesrechnungshof monierte bereits vor sechs Jahren, dass die Bearbeitung von Beihilfe-Anträgen für die Beamten im Stadtstaat modernisiert werden müsse. Der Sprecher des Bremer Finanzsenators spielt den jetzt eskalierenden Fall runter: Alles laufe seit 2017 so, wie geplant.
-
Open-Source-Desktop aus Kiel läuft bundesweit auf 40.000 Arbeitsplätzen.
 |
Die dPhoenixSuite wird Grundlage für den OSS-Desktop des Bundes.
(Foto: Dataport/Screenshot: HANSEVALLEY) |
Kiel, 03.08.2023: Der IT-Dienstleister der norddeutschen Bundesländer - "Dataport" - hat gegenüber dem Themen-Newsletter "Background" des Berliner "Tagesspiegels" Zahlen zur Kritik an dem 2019 initiierten Open-Source-Desktop "Phoenix-Suite" geliefert. Danach laufen in verschiedenen Pilotprojekten bundesweit z. Zt. rd. 40.000 Desktops auf Grundlage quelloffener Software. Allein in der Landesverwaltung von SH laufen derzeit testweise rd. 4.400 Instanzen.
Dazu kommen Testläufe auf Bundesebene. So wird der "Phoenix"-Desktop im Berliner Digitalisierungsministerium auf rd. 350 Desktops ausprobiert und im Bundesinnenministerium auf 330 Rechnern. Im Hamburger Amt für IT und Digitialisierung - wie Bremen, MV, Sachsen-Anhalt und SH Partnerland von "Dataport" - sind es rd. 100 Suiten. Dazu kommen im Berliner Robert-Koch-Institut im Rahmen des Projekts "Agora" 200 Instanzen - mit dem Ziel des Ausbaus auf 19.000.
Neben der kompletten Desktop- oder Cloud-Suite mit Nextcloud (Datenspeicherung und -Austausch), Matrix (sicheres Chatprotokoll), Jitsi (sichere Videochats), Collabora (professionelle Office-Suite auf Basis von OpenOffice.org) und UCS - Univention Corporate Server (Infrastruktur- und Identitätsmanagement für Server laufen in der Verwaltung von SH auch einzelne Bestandteile von "Phoenix".
So nutzen rd. 37.000 User rund um das Kieler Bildungsministerium mit Schulen und Hochschulen die Mail-Funktion von "Phoenix". Mit 1.600 Mitarbeitern für das Kollaborations-Tool ist das Justizministerium von NRW mit an Board, ebenso wie 27.000 Nutzer verschiedenster öffentlicher Einrichtungen bundesweit. Ein auf der Cloud-Version "dPhoenixSuite" basierender "digitaler Arbeitsplatz" soll ab Herbst d. J. bei bis zu 5.000 Lehrern in Baden-Württemberg arbeiten. Damit reagiert "Dataport" auf die Kritik des Linux-Spezialisten Markus Feilner in der Juli-Ausgabe des "Linux-Magazin".
So stelle "Dataport" keinen Quellcode aus seiner Produktentwicklung der Open-Source-Entwickler-Community zur Verfügung. Eine Zusammenarbeit mit der Open-Source-Community gebe es praktisch nicht. In der Konsequenz wirft Feilner "Dataport" "Openwashing" vor. Zudem sei man bei "Dataport" weitgehend "beratungsresistent". Das Rechenzentrum für die angeschlossenen Verwaltungen sei sicherheitstechnisch nur "auf niedrigem Niveau zertifiziert". Die für Online-Services der Verwaltungen erstellte Plattform "OSI" verstoße weitgehend gegen DS-GVO-Vorschriften.
Der "Tagesspiegel" erläutert, dass das neue "Zentrum für digitale Souveränität - Zendis" - den Quellcode ab 1. Quartal 2024 über die "Open Code"-Plattform als "souveräner Arbeitsplatz" bereitstellen und verwalten soll. Damit können Bundesländer und ihre Behörden die Suite für ihre Anwender selbst implementieren und managen - unabhängig von "Dataport" in Kiel. Anfang Juli dieses Jahres sollen bereits erste Teile des Quellcodes bereitgestellt worden sein, bis Jahresende sollen weitere folgen.
"Dataport" baut die "Phoenix"-Suite auf Grundlage quelloffener Software. Die Open-Souce-Officesuite wird für rd. 20,- € pro öffentlichem Anwender bereitgestellt. Allerdings lässt sich der öffentliche Dienstleister der norddeutschen Bundesländer die Einführung mit einer Installations-Pauschale für knapp 1.000, € je Desktop und einem Einführungs-Workshop für 800,- € bezahlen. Weitere Informationen zum Geschäftsmodell der Cloud-basierten "dPhoenixSuite" gibt es in einer aktuellen Preisliste von "Dataport". Eine Zusammenfassung der aktuellen Kritik an "Dataport" und die Konsequenzen können hier nachgelesen werden. Weitere Informationen zur "dPhoenixSuite" gibt es auf den Seiten von "Dataport". -
Dataport gerät für Openwashing beim Open-Source-Desktop in die Kritik.
 |
Soll eigentlich längst in den Behörden von SH im Einsatz sein: Die dPhoenixSuite
Foto: Dataport/Screenshot: HANSEVALLEY |
Kiel, 02.08.2023: Der norddeutsche IT-Dienstleister "Dataport" gerät wegen der langsamen Entwicklung des Open-Source-Desktops "dPhoenixSuite" für die schleswig-holsteinische Verwaltung öffentlich in die Kritik. Grund: Drei Jahre nach der ersten Vorstellung des Behörden-Desktops wird dieser immer noch nicht zwischen Nord- und Ostsee eingesetzt.
Das "Linux Magazin" berichtet in seiner Juli-Ausgabe von "Openwashing" des in Altenholz bei Kiel beheimateten, von den norddeutschen Bundesländern und Sachsen-Anhalt getragenen, öffentlichen IT-Dienstleisters. "Dataport" habe kein Verständnis für die Grundsätze von "Freier Software" und die hauseigene Entwicklung geschehe im Schneckentempo.
Linux-Experte und IT-Journalist Markus Feilner geht mit seiner Kritik noch weiter: "Dataport" stelle keinen Quellcode aus seiner Produktentwicklung zur Verfügung. Eine Zusammenarbeit mit der Open-Source-Community gebe es praktisch nicht. In der Konsequenz wirft Fellner "Dataport" "Openwashing" vor. Obendrein gebe es ein ungeklärtes Verhältnis zum parallel vom Bundesinnenministerium beauftragten, OSS-basierten "Souveränen Arbeitsplatz" für den Bund.
In dem ausführlichen Beitrag im führenden deutschen Open-Source-Magazin wird der IT-Dienstleister auch grundsätzlich kritisiert: So sei man in Altenholz und Hamburg weitgehend "beratungsresistent". Das Rechenzentrum für die angeschlossenen Verwaltungen sei sicherheitstechnisch lediglich "auf niedrigem Niveau zertifiziert". Die für Service-Portale und Online-Services der Verwaltungen erstellte Plattform "OSI" verstoße weitgehend gegen DS-GVO-Vorschriften.
Die geplante Office- und Kolaborations-Plattform "dPhoenixSuite" integriert Freie Software-Komponenten, wie Nextcloud (Datenspeicherung und -Austausch), Matrix (sicheres Chatsprotokoll), Jitsi (sichere Videochats), Collabora (professionelle Office-Suite auf Basis von OpenOffice.org) und UCS - Univention Corporate Server (Infrastruktur- und Identitätsmanagement für Server).
2012 entschieden sich SPD, Grüne und Südschleswigscher Wählerverband in ihrem Koalitionsvertrag für eine Open-Source-Strategie, um die Abhängigkeit von Microsoft mit seinen Office-, Authentifiaktions- und Cloud-Produkten zu reduzieren. Das Ziel: Ein Open-Source-Desktop mit allen wichtigen Programmen für den Verwaltungs-Schreibtisch.
Eine Zusammenfassung der aktuellen Kritik an "Dataport" und die Konsequenzen können hier nachgelesen werden. Weitere Informationen zur "dPhoenixSuite" gibt es auf den Seiten von "Dataport" -
Drogeriemarkt-Kette Budni verweigert Rabatte und hat seit Monaten IT-Probleme mit App-Rabatten.
 |
Gutscheine sind bei Budni für die Füße - und werden einfach verweigert.
Screenshot: HANSEVALLEY |
Berlin, 01.08.2023: Der Hamburger Drogeriemarkt-Betreiber "Budnikowski" hat nach mehrfachen Kundenerlebnissen erkennbar erhebliche Probleme mit der korrekten Reduzierung von Produktpreisen, die als "persönliche Angebote" in der aktuellen "Budni-App" ausgewiesen werden. Ein Redaktionsmitglied des Hanse Digital Magazins musste dies in den vergangenen Wochen mind. dreimal persönlich erleben. Dabei gaben unfreundliche Mitarbeiterinnen der Berliner "Budni"-Filiale an der Gedächtniskirche zudem falsche Auskünfte und forderten den Kunden auf, die Angebote aus der App am Service-Point auszudrucken. Erst eine Intervension sorgte für eine Korrektur des Rechnungsbetrags.
Offensichtlich nimmt es das zur Hamburger Unternehmer-Familie "Wöhlke" um die beiden Jung-/Unternehmer Christoph Wöhlke (Hamburg) und Nicolas Wöhlke (Stapelfeld) mit dem korrekten Einräumen von Rabatten nicht so ganz genau: Eine in der vergangenen Woche nach Paket-Abholung erhaltene Rabattkarte aka "Paket-Sparschein" über 10 % Ersparnis verweigerte die zum Stammunternehmen "Iwan Budniskowski" gehörende Filiale in der Berliner CIty keine sieben Tage später mit Verweis der Filialleitung auf ihre Geschäftsführung. Der Rabattcoupon hat eine Laufzeit bis 31.12.2023 und besitzt keine Einschränkung in Bezug auf die Laufzeit.
Doch nicht nur Kunden mit der von "Budni" hochgejubelten "Budni-App" und einem Rabatt-Gutschein müssen sich an den Kassen von "Budnikowski" wundern. Mehrfach musste unser Redaktionsmitglied feststellen, dass an den Regalen ausgeschilderte Angebotspreise nicht in der Kasse vorhanden waren und den reklamierenden Kunden zunächst deutlich höhere Preise abverlangt wurden. Ob es sich um versehentlich nach Angebotspreisen nicht ausgetauschte Preisschilder handelt, oder der mit "EDEKA" verbundene Drogeriehändler vorsätzlich Kunden übervorteilt, kann nicht endgültig gesagt werden.
"Budni" versucht seit 2018 zusammen mit "EDEKA" eine bundesweite Expansion und geht dabei in direkte Konkurrenz gegen die beiden deutschen Marktführer "DM" (Karlsruhe) und "Rossmann" (Burgwedel/Hannover). Allein im hart umkämpften Berliner Markt betreibt "Budni" zusammen mit der regional zuständigen "EDEKA"-Genossenschaft Hannover-Minden mittlerweile 12 Filialen inkl. Potsdam. Dabei sind "Budni"-Filialen oft leer und werden nur von Touristen aufgesucht. Der Hamburger Marktführer betreibt zusammen mit "EDEKA" bundesweit fast 200 Filialen mit rd. 2.000 Mitarbeitern.
-
About You macht virtuellen Metaverse-Modeladen "Hyperwear" dicht.
 |
About You versuchte, mit virtueller, nicht existenter Mode Geld zu machen.
Foto: About You |
Hamburg, 27.07.2023: Der angeschlagene "Otto-Konzern"-Händler "About You" hat im Rahmen seines massiven Kostenspar-Programms das Projekt "Hyperwear" mit Verkauf virtueller Markenkleidung als digitale Güter "NFT" dicht gemacht. Die dazu gehörende Website ist ein Jahr nach dem Launch im Juni '22 offline.
Digital affine Kunden fanden auf der Metaverse-Plattform eine Reihe von digital präsentierten Luxusmarken sowie Streetwear von 3D-Fashion Brands und Grafik-Designern. Anlässlich der Eröffnung des virtuellen Mode-Shops ohne reale Kleidung verkaufte der Hamburger Online-Marketer, "Otto"-Zögling und "About You"-Vorstand Müller die nicht-reale Welt als ein Stück echter Zukunft:
"Mit Hypewear holen wir unsere Brand in die digitale Welt und ermöglichen ab sofort jedem, Teil davon zu sein. Unsere Vision ist es, dass alle physischen Fashion-Pieces in Zukunft auch als digitale Assets genutzt werden können. Wir wollen die Destination für digitale Fashion und die Mainstream-Wardrobe des Metaverse werden".
Auf Grund der durch Ukraine-Krieg und Energie-Krise ausgelösten Inflation reduzierten die vornehmliche jungen Kunden der Hamburger "Otto-Konzern"-Beteiligung nach Weihnachten massiv ihre Aussagen für neue Kleidung. "About You" musste seine Saison-Ware - wie "Otto.de" und andere Online-Shops - mit hohen Rabatten verkaufen.
Die von Müller zusammen mit "Otto-Konzern"-Erbe Benjamin aufgezogene "Zalando"-Copycat beendete das Geschäftsjahr am 28.02.2023 mit mehr als 137 Mio. € Verlust. Daraufhin verkündete der Bekleidungshändler, seine Marketing-Kosten um 50 % zusammenzustreichen und keine neuen Mitarbeiter mehr einzustellen. Im Zuge des Cost-Cut-Programms fällt auch "Hyperwear" der wirtschaftlichen Entwicklung zum Opfer.
-
Deutsche Manager betreiben Machterhalt durch Datensilos.
 |
Deutsche Manager mauern und lügen für den Machterhalt.
Grafik: Sopra Steria |
Hamburg, 27.07.2023: Mehr als ein Drittel (39 %) der Entscheider in deutschen Unternehmen würden hauseigene Daten nicht einmal innerhalb ihrer eigenen Organisation teilen, um effizienter und innovativer arbeiten zu können. Das Teilen eigener Daten mit externen Partnern kommt sogar nur für 12 % der Führungskräfte in Frage. Die zentralen Gründe sind fehlendes Vertrauen in den Nutzen und eine generelle Skepsis, sich zu öffnen.
Um mit dem technischen Fortschritt mithalten zu können, arbeiten Organisationen zunehmend mit Startups und Konkurrenten zusammen. Kooperationen wie in der Automobilindustrie zwischen "VW" und "Ford" funktionieren allerdings nur, wenn die Partner Markt- und anonymisierte Kundendaten sowie nützlichen Software-Code teilen. Dazu sind wenige Unternehmen bereit.
Nur 12 % der im Auftrag der Technologie- und Managementberatung "Sopra Steria" befragten Entscheider würden interne Daten mit anderen Unternehmen oder Behörden teilen, um Prozesse zu verbessern oder Innovationen voranzutreiben. Mit der Bereitstellung von Kompetenzen haben hingegen die wenigsten Organisationen Probleme. Auch Wissen und Ideen werden von 41 % extern und 78 % intern geteilt.
"Die Zahlen zeigen, wie zurückhaltend Organisationen in Deutschland sind und dass Open Innovation und Zusammenarbeit an eine Grenze stoßen, wenn es um das Teilen von Daten geht", sagt Torsten Raithel, Experte für Data & Analytics bei "Sopra Steria". "Daten sind für Unternehmen immer noch ein gut gehütetes Geheimnis". Sowohl die Wirtschaft als auch der öffentliche Sektor seien gefordert, die passenden Voraussetzungen zu schaffen", so Raithel.
Nachholbedarf sieht der Berater beim Aufbau einer Datenkultur: "Daten zu teilen heißt, sich ein Stück weit zu offenbaren und die puren Zahlen ohne Filter und ohne Möglichkeit zur Beschönigung offenzulegen. Offenheit erfordert zudem ein Bewusstsein, dass Daten zu teilen keinen Know-how-Verlust bedeutet", so der Experte.
Dieses Verständnis ist bei Unternehmen und Behörden in Deutschland kaum ausgeprägt. 48 % der Befragten führen in der Studie fehlendes Vertrauen und Angst vor Missbrauch der geteilten offizieren einen Datenverlust. Das geht aus der "FAZ Research"-Studie "Managementkompass Survey Open Company" für "Sopra Steria" hervor.
"Um die Vorteile von Open Companies künftig stärker nutzen zu können, braucht es in Unternehmen und Verwaltungen zügig eine Transformation in den Köpfen", betont der Datenexperte. Handlungsbedarf besteht zunächst vor allem in den Unternehmen und Behörden selbst. Es werden zwar intern mehr Daten geteilt, allerdings längst nicht in der Breite. Vor allem öffentliche Verwaltungen (44 %) und Finanzdienstleister (43 %) stellen ihre Daten nicht teamübergreifend zur Verfügung.
"Mitarbeiter sind häufig besorgt darüber, dass jemand in ihren Kompetenzbereich eingreift, sie fühlen sich kontrolliert oder fürchten, dass ihre Arbeit im nächsten Schritt automatisiert wird. Aufgabe des Managements ist es, Mitarbeitenden diese Ängste zu nehmen", erklärt Unternehmensberater. 37 % der Befragten bemängeln selbst eine fehlende Kultur der Offenheit in ihren Unternehmen oder Verwaltungen.
-
Postenhändler Ralf Dümmel kommt aus Social Chain-Pleite mit kräftigen Verlusten aber einem blauem Auge davon.
 |
Sein Stammbetrieb DS Produtke wird überleben.
Foto: Stevan Groenfeld |
Hamburg, 26.07.2023: Der Segeberger Postenhändler Ralf Dümmel verliert durch den Konkurs der Berliner "The Social Chain AG" aus seinem Anteil von 5 % der Aktien voraussichtlich rd. 38,5 Mio. € vom ursprünglichen Handelswert. Sein Aktienpaket ist seit der Listung am 12.11.2021 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse von ursprünglich 38,72 Mio. € Buchwert auf heute nur noch 275.000,- € zusammengeschmolzen. Die Aktie startete mit einem Verkaufspreis von 54,- € und liegt aktuell bei rd. 0,48 €.
Der Konkursantrag der seit 2022 in finanziellen Schwierigkeiten steckenden Social Media Marketing-Firma "The Social Chain" des früheren SAT.1-Managers Georg Kofler tangiert die zur Gruppe zählende "DS Produkte GmbH" und deren Muttergesellschaft "DS Holding GmbH" unterdessen nicht. Grund: Der Stapelfelder Firmenverbund gehört zu den Segeberger Unternehmerfamilien Hagemann und Schwarz. Eigentlich verantwortliche Unternehmerin ist die Bad Segebergerin Daniela Hagemann, geborene Schwarz.
Zur "Übernahme" von "DS" durch "TSC" berichten verschiedene Quellen über eine Auslagerung von 24,46 % der "DS Holding" im Jahr 2000 an die "DS Beteiligung". Diese Gesellschaft wurde im Jahr 2021 als Dach von "Gesellschaften des DS-Teilkonzerns" für 220,5 Mio. € an die "The Social Chain AG" nach Berlin verkauft, wovon 100 Mio. € in bar an Ralf Dümmel geflossen sein sollen sowie weitere 120 Mio. € in Form von 2,8 Mio. neuer Aktien.
Die operativ verantwortliche "DS Produkte" und deren Muttergesellschaft "DS Holding" in Stapelfeld gehören folglich zu rd. 75 % weiterhin der verantwortlichen Segeberger Unternehmerfamilie Hagemann und sind vom Konkurs direkt nicht betroffen. Die Gruppe wird von der Tochter des DS-Gründers Dieter Schwarz (DS), Daniela Hagemann (geb. Schwarz) geführt.
"DS Produkte"-Geschäftsführer und Ehemann Hanno Hagemann gilt in der Stapelfelder Handelsgruppe als "Innenminister", der bekannte "VOX-Löwe" Ralf Dümmel als "Außenminister". Dümmel selbst hat 1998 als Verkaufsassistent und 11. Mitarbeiter bei DS-Gründer Dieter Schwarz gestartet. Der Realschul-Absolvent hat seine berufliche Karriere als Einzelhandels-Azubi bei "Möbel Kraft" in Bad Segeberg (heute "KHG" Berlin-Schönefeld) begonnen.
-
Dümmel-Holding "Social Chain AG" von der Finanzaufsicht gerügt.
 |
Beim Zusammenschluss waren die "Löwen" Dümmel und Kofler noch guter Hoffnung.
Foto: Social Chain AG/Jens Oellermann |
Hamburg, 17.07.2023: Die vom Segeberger Postenhändler Ralf Dümmel mitgeführte "Social Chain AG" hat Ärger mit der Finanzaufsicht BaFin und wurde von dieser öffentlich gerügt. Grund sind z. T. schwerwiegende Fehler in der Jahresbilanz 2021 des Handelsunternehmens. Die BaFin rügt "Social Chain" für das Verbuchen eines 50 Mio. €-Kredits als Betriebsausgabe, berichtet "Startup Insider". Das Darlehen muss allerdings als Finanzierungstätigkeit verbucht werden.
Nicht genug: Die Aktiengesellschaft hat für das Jahr 2021 9,3 Mio. € aus dem Verkauf von Anteilen als Cashflow gebucht. Ein gravierender Fehler: Das Unternehmen hätte den Betrieb als "Cashflow aus Investitionstätigkeit" verbuchen müssen. Glück im Unglück: Die BaFin hat zunächst keine weiteren Konsequenzen aus den falschen Buchungen angekündigt.
Allerdings müssen die Anteilseigner der "Social Chain AG" offen und umfassend über die Fehler in der Bilanzbuchhaltung informiert werden. Nach eigenen Angaben hat "Social Chain" die Fehler bereits korrigiert und die Aktionäre auf ihrer diesjährigen Hauptversammlung Ende Juni '23 informiert. Der Konzern steckt aktuell in einer schweren Finanzkrise.
Seit dem Zusammenschluss der "Social Chain AG" von Ex-Pro Sieben-Chef Georg Kofler und der "DS Gruppe" von Posthändler Ralf Dümmel im November '21 hat der Börsenwert der Aktie 96 % verloren und liegt aktuell bei rd. 2,- €. Der Firmenwert liegt nach Berechnungen von Experten nur noch bei 32,5 Mio. €.
Der Konzernumsatz brach allein im 1. Quartal des laufenden Jahres von 117,5 Mio. € (Q1 '22) auf 58,4 Mio. €. ein. Der EBITDA liegt bei -3,5 Mio. €. Die AG hat aktuell mehr als 254 Mio. € Schulden - u. a. einen 120 Mio. € Kredit über "DS Produkte". Der Handelsverbund will durch eine Reduzierung des Warensortiments um 20-30 % sowie um bis zu 30 % niedrigere Personal- und Strukturkosten perspektivisch wieder erfolgreicher werden.
-
Oberverwaltungsgericht weist Löschung von 17 Terabyte Fotos und Videos vom G20-Gipfel an.
 |
Nach den G20-Krawallen in Hamburg sammelte die Polizei massenweise Fotos und Videos.
(Foto: Hinrich Schultze - Umbruch Bildarchiv - CC BY SA 2.0) |
Hamburg, 06.07.2023: Die massenhafte Durchsuchung von Foto- und Videomaterial im Nachgang der schweren Krawalle während des G20-Gipfels 2017 in Hamburg findet sein vorläufiges Ende: Das Oberverwaltungsgesetz Hamburg hat entschieden, dass die Polizei mit ihrer Spezialeinheit insgesamt 17 Terabyte Foto- und Videomaterial unwiderruflich löschen muss. Ursprünglich wurden sogar 100 TB Bilddaten gespeichert.
Ex-Datenschutzbeauftragter Johannes Caspar hatte im Dezember 2018 gegen die massenhafte Speicherung und Auswertung von Fotos und Videos geklagt. Seit Juli 2018 wird nach einer öffentlichen Beschwerde von Caspar darüber gestritten, ob die Polizei die Fotos und Videos aus öffentlichen und privaten Quellen auslesen und verwenden darf. Die Polizei hatte mit ihrer "Soko Schwarzer Block" wiederholt geäußert, dass deren Einsatz auch für andere Großereignisse in Hamburg in Betracht kommt.
Der Fall reicht bis in den November 2017 zurück. Damals hatte die Polizei im Rahmen Ihrer Ermittlungen begonnen, aus privaten Aufnahmen, polizeieigenen Videos sowie Bild- und Videomaterial von S-Bahnstationen und aus den Medien per Gesichtserkennungssoftware Gesichter aller im Material feststellbarer Personen automatisch auszumessen und mit Hilfe dieser Informationen maschinenlesbare Templates zu erstellen.
Durch den Abgleich tausender Bilder aus den Überwachungskameras vom Hauptbahnhof, von S- und U-Bahnhöfen, aus U-Bahnen und Bussen, von einem BKA-Bürgerportal mit 14.000 Dateien und der G20-Medienberichterstattung wird erheblich in die Rechte und Freiheiten Unschuldiger eingegriffen. Die Auswertung betrifft massenhaft Personen, die nicht tatverdächtig sind und dies zu keinem Zeitpunkt waren, erklärte die Behörde.
-
Otto-Inkassodienst EOS will von säumigen Schuldnern weiterhin zusätzliche Gebühren kassieren.
 |
Die Zentrale des Otto-Inkassodienstes EOS in Hamburg-St. Georg
Foto: HANSEVALLEY |
Hamburg, 16.06.2023 *Update*: Der zum "Otto-Konzern" gehörende Inkasso-Dienst "EOS" will vor dem Bundesgerichtshof durchsetzen, entgegen einer aktuellen Entscheidung des Hanseatischen Oberlandesgerichts weiterhin zusätzliche Gebühren von säumigen Schuldnern kassieren zu dürfen. Dabei geht es um Forderungen der "EOS Investment GmbH", die als sogenanntes "Konzerninkasso" durch die Schwester "EOS Deutscher Inkasso-Dienst" eingetrieben werden.
Das höchste Hamburger Gericht hat am Donnerstag d. W. (15.06.2023) einer Klage des Bundesverbandes der Verbraucherzentralen recht gegeben, wonach "EOS" Schuldnern keine weitergehenden Inkassokosten in Form von Rechtsanwaltsgebühren aufbürden darf, wenn eine Konzerngesellschaft die Forderungen an eine weitere Gesellschaft weiterreicht. Im konkreten Fall geht es um 15 Gläubiger, denen "EOS" zusätzliche Mahngebühren abgeknöpft hatte, obwohl die Forderungen nur an eine andere Konzerngesellschaft abgegeben wurden.
Begründung des OLG in Hamburg: Durch einen Zahlungsverzug der Schuldner ggü. "EOS" ist kein echter Schaden entstanden. Deshalb darf der Inkasso-Konzern auch keine zusätzlichen Gebühren kassieren. Neben den 15 "Otto-Fällen" haben sich weitere 680 Verbraucher für die Musterfeststellungsklage beim Bundesamt für Justiz in die Klageliste eintragen lassen, da die mehrfach erhobenen Gebühren bei verschiedenen Inkasso-Diensten Gang und Gebe sind. „Unternehmen dürfen sich nicht auf dem Rücken von Verbrauchern bereichern“, erklärte die Vorstandsvorsitzende der Verbraucherzentralen, Ramona Pop.
„Aus unserer Sicht hat das OLG Hamburg im Verfahren wesentliche Punkte außer Acht gelassen“, argumentiert Hendrik Aßmus, Chefjustiziar bei "EOS". „In allen behandelten Musterfällen lag unstrittig ein Zahlungsverzug vor. Bei der Bearbeitung dieser Forderungen sind Kosten entstanden, die nach unserem Rechtsverständnis der säumige Zahler zu tragen hat." Interessant: Der aktuelle Konzern-Geschäftsbericht der "Otto Group" bezeichnet den Ausgang der Klage selbst als "erhebliches Geschäftsrisiko". Damit ist dem "Otto-Konzern" und seiner Inkasso-Firma "EOS" bewußt, dass die zusätzlichen Gebühren gekippt werden können.
"EOS" ist der Inkasso-Dienstleister des "Otto-Konzerns". Das Unternehmen kauft Forderungen von Privatschuldnern und Unternehmen auf und treibt diese über Jahre ein. Der in Hamburg St. Georg beheimatete Konzern kauft unter anderem Schulden von Verbrauchern in den Bereichen E-Commerce (Online-Einkäufe u. a. von "Otto.de" und anderen konzerneigenen Online-Shops), Telekommunikation (z. B. Handy-Rechnungen), Strom- und Gasrechnungen sowie Immobilien (z. B. Immobilienfinanzierungen) auf und treibt diese mit rd. 6.000 Mitarbeitern in 25 Ländern ein.
Während der "Otto Konzern" wie der größte Online-Shop "Otto.de" im vergangenen Jahr Negativergebnisse in dreistelliger Millionenhöhe einfuhren, stieg bei "EOS" das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abgaben (EBIT) um 155,1 Mio. € auf 451,5 Mio. €. Der "Otto Konzern"-Jahresabschluss weist für das Geschäftsjahr 2022/2023 mehr als 1,1 Mrd. € aus, die für den Ankauf weiterer Forderungen für den "EOS"-Inkasso-Dienst bereitgestellt wurden - mehr als 500 Mio. € mehr, als im Jahr zuvor.
"EOS" gilt seit Jahren als einzig kontinuierlich und überdurchschnittlich wachsendes Profitcenter im "Otto-Konzern" mit jährlichen Wachstumsraten von 20 % und mehr. Während der Familienkonzern sich offiziell als sozial und fortschrittlich darstellt, verdient er einen beachtlichen Teil seiner Gewinne durch das Eintreiben von Schulden u. a. seiner E-Commerce-Kunden. Ohne die Inkasso-Sparte würde die "Otto Group" mit seinen E-Commerce-Shops und der Logistik-Sparte "Hermes" noch finanziell deutlich schwächer dastehen.
-
Kriselnde Finanzbranche lässt sich ihr Marketing ab sofort vom Hamburger Steuerzahler bezahlen.
 |
Das "Haus im Haus" der Handelskammer ist Treffpunkt für den neuen Subventionsverein.
(Foto: HK Hamburg/Daniel Sumesgutner) |
Hamburg, 15.06.2023: Heute Vormittag wird in der Handelskammer am Adolphsplatz ein neues, staatliches Cluster-Netzwerk offiziell vorgestellt. Die Finanzbehörde des umstrittenen SPD-Senators Andreas Dressel und die Handelskammer starten mit dem privaten Banken- und Versicherungsverein "Finanzplatz Hamburg" die "FCH Finance City Hamburg GmbH".
Mit dem bereits im Rahmen einer 1,3 Mio. €-Anschubfinanzierung im Frühjahr 2021 geplanten Wirtschaftscluster lässt sich die seit Jahren schrumpfende Banken- und Versicherungsbranche an Alster und Elbe fällige Marketing-Aktivitäten nun direkt mit einer millionenschweren Subvention durch den Steuerzahler finanzieren.
Geschäftsführerin von "FCH Finance City Hamburg" wird die Hamburger Unternehmensberaterin Britta Stövesand-Ruge. Die Handelskammer hat sie bereits im August 2022 als Projektmanagerin "Masterplan Finanzwirtschaft" angestellt. Zuvor arbeitete die Volkswirtin u. a. 14 Jahre bei einer Hamburger Beratungsgesellschaft für Versicherungen.
Im Rahmen des "Masterplans Finanzwirtschaft" wurde im Jahr 2021 durch SPD-Finanzsenator Andreas Dressel versucht, seinem Parteifreund Nico Lumma einen Neun-Millionen-Auftrag für den Aufbau eines Fintech-Accelerators zuzuschieben. Erst nach massiver Kritik seitens Opposition und Stadtmedien ließ Dressel die Millionen-Verschiebe-Aktion fallen.
Lumma und sein "NMA"-Accelerator kassierten nach Absage des Fintech-Programms dennoch 370.000,- € Aufwandsentschädigung. Mittlerweile hat die staatliche Wirtschaftsförderung der Wirtschaftsbehörde unter SPD-Senatorin Melanie Leonhard den umstrittenen Parteifunktionär mit einem lukrativen Beraterauftrag für ein städtisches Startup-Förderprogramm zur Ansiedlung ausländischer Jungunternehmen versorgt.
Pikant im Zusammenhang mit der erneuten Beteiligung der Handelskammer an einem staatlichen Wirtschaftscluster: Präses Norbert Aust warnte bei der Jahresabschlussveranstaltung der "Versammlung Eines Ehrbaren Kaufmanns" vor der Einflussnahme der Hamburger Politik auf die Wirtschaft der Stadt über die staatlich finanzierten Cluster-Netzwerke. Grund: Die Politik stelle die Cluster als repräsentative Wirtschaftsvertretungen dar, die durch die Finanzierung seitens des Senats aber die offizielle Politik von Rot-Grün vertreten würden.
Wie die Handelskammer Hamburg den Widerspruch zur Beteiligung an der städtisch bereits mitfinanzierten Vereinigung "Finanzplatz Hamburg", der "FCH Finance City Hamburg" und dem staatlichen Cluster-Netzwerk "Gesundheitswirtschaft Hamburg" auflösen will, bleibt Aust bis heute schuldig.
Mit der Gründung eines Finanzmarkt-Clusters unter Beteiligung von "Finanzplatz Hamburg" wird die Abhängigkeit der Hamburger Handelskammer mit ihren Banken und Versicherungen eher größer und eine von der Senatspolitik unabhängige Entwicklung der Branche deutlich erschwert.
Die Hansestadt ist als einst zweitgrößter Fintech-Standort auf einen bundesweit 5. Platz abgerutscht. An Alster und Elbe gibt es laut "German Fintech Report" mit Stand Juli '21 lediglich 55 junge, schnell wachsende Unternehmen der Finanzbranche.
-
Hochbahn versucht Ausfall des zentralen U-Bahn-IT-Systems kleinzureden.
 |
Am Montag standen die U-Bahn still - und die Hochbahn versuchte es kleinzureden.
Foto: Hochbahn AG |
Hamburg, 14.06.2023: Nach einer Präsentation von künftig autonom fahrenden U-Bahn-Zügen auf den Hochbahn-Linien 2 und 4 ist am Montag der Woche das gesamte IT-Steuerungssystem der Hamburger U-Bahn ausgefallen. Tausende Berufspendler steckten zu Wochenbeginn zeitweise in Zügen fest oder warteten vergebens auf ihre Bahn zur Arbeit.
Die Leitstelle der Verkehrsbetriebe musste über längere Zeit jeden einzelnen Zug händisch für den Fahrbetrieb freigeben. Die Hochbahn hielt es offenbar nicht für notwendig, die feststeckenden und vergebens wartenden Kunden über den IT-Ausfall zu informieren. Ebenso verschwieg die Pressestelle der städtischen "Hochbahn" den Vorfall gegenüber den Medien der Hansestadt.
Offenbar besitzt der zweitgrößte deutsche Bus- und Bahndienstleister im ÖPNV nicht über einen Kommunikationsplan in einer entsprechenden Krisensituation. Stattdessen behauptete "Hochbahn"-Sprecher Kreienbaum gegenüber dem NDR, in der Innenstadt einen Fünf-Minuten-Takt aufrechterhalten zu können. Allerdings: Erst im Laufe des Montag-Vormittags konnten die IT-Systeme wieder hochgefahren werden.
Der Hamburger Radiosender "NDR 90,3" hatte als Erstes über den erheblichen Zwischenfall bei der "Hamburger Hochbahn AG" berichtet, gefolgt von den Kollegen der "Hamburger Morgenpost".
-
Rechnungshof bescheinigt Landesregierung in Hannover Versagen bei der Digitalisierung.
.jpg) |
Das Hannoveraner Innenministerium ist für die Digitalisierung in der Schusslinie.
Foto: AxelHH, Lizenz: CC BY-SA 3.0 |
Hildesheim, 31.05.2023: Der Rechnungshof vom Niedersachsen hat die Landesregierung für das weitgehende Versagen bei der Digitalisierung der Verwaltung scharf gerügt. Die Hildesheimer Kontrollbehörde stellte fest, dass im vergangenen Jahr statt 6.913 Verwaltungs-Dienstleistungen ganze 333 online verfügbar waren - und damit gerade einmal fünf Prozent. Damit ist das Land seiner Verpflichtung gemäß Online-Zugangsgesetz (OZG) nicht nachgekommen.
Die rot-grüne Koalition unter SPD-Ministerpräsident Stephan Weil habe die selbst gesteckten Ziele bei der Digitalisierung nicht erreicht. Dringend notwendige Fortschritte sind laut eines extra erstellten, 38-seitigen Prüfberichts zur Digitalisierung nicht erkennbar. Ein "Weiter so" reiche nicht, stellt der Landesrechnungshof kritisch fest.
Neben dem Versagen bei digitalen Bürger-Services monieren die Aufseher einen "Wildwuchs" in der IT der Landesverwaltung mit unterschiedlichsten Rechnern, Servern und Programmen. Rechnungshof-Präsidentin Sandra von Klaeden monierte die zerstückelte und unkoordinierte IT-Zuständigkeit im Land: "Das Land muss die Steuerungs- und Entscheidungsstruktur für die IT und die Verwaltungsdigitalisierung endlich bündeln - zentral und ressortübergreifend."
Der Rechnungshof kritisiert in diesem Zusammenhang sowohl das zuständige Innenministerium in Hannover, als auch die Funktion des Chief Information Officers (CIO). Die IT-Ausgaben stiegen über 20 Jahre CIO im Land zwar von 236 auf 589 Mio. € im Jahr. Die zentralen Zuständigkeiten des CIO für die IT-Planung und -Steuerung wurden jedoch über die Zeit zu Gunsten der einzelnen Ministerin verschoben.
Bisher verfolge jedes Ministerium bei der IT oft eigene Interessen und Wünsche. Die Kleinteiligkeit setzt sich laut der Rechnungsprüfer bei der Wartung der IT fort. Die Führung des Landesrechnungshofes stellt eine klare Forderung, um das offensichtliche IT-Chaos zu beseitigen: "Das Land sollte die Steuerungs- und Entscheidungsstruktur für die IT und die Verwaltungsdigitalisierung beim CIO bündeln", bringt Vizepräsident Thomas Senftleben auf den Punkt.
2014 richtete das Land mit "IT Niedersachsen" einen eigenen Dienstleister für seine Informationstechnik ein. 2020 nutzten jedoch 39 von 70 Landesbehörden den IT-Dienstleister gar nicht oder nur teilweise. Präsidentin von Klaeden warnt weitergehend vor der 1:1-Automatisierung analoger Prozesse: "Schlechte analoge Prozesse werden durch die ihre Automatisierung nicht besser. Sie werden zwar digitalisiert, bleiben aber langsam und unwirtschaftlich."
-
Familienunternehmer fordern Digitalisierung der Verwaltung statt Schuldzuweisungen für Einnahmeverluste.
 |
Finanzsenator Andreas Dressel verärgert die Hamburger Familienunternehmer.
Foto: HANSEVALLEY |
Hamburg, 30.05.2023: Die Familienunternehmer an Alster und Elbe kritisieren den Versuch des Hamburger Finanzsenators Andreas Dressel, für erwartete Mindereinnahmen im Finanzhaushalt der Hansestadt FDP-Bundesfinanzminister Christian Lindner verantwortlich zu machen. Hintergrund ist die auf Bundesebene beschlossene Erhöhung der Freigrenze für den Spitzensteuersatz, die Schuld an geringeren Steuereinnahmen sein soll.
Der Regionalvorsitzende der Vereinigung Hamburger Familienunternehmer - Henning Fehrmann - sagte: "Die Aussagen des Finanzsenators sind polemisch und irreführend. Der Bund hat unter Mitwirkung der SPD die Auswirkungen der Inflation auf die Einkommensteuer abgefedert. Das war eine wichtige Entlastung des Mittelstandes in Krisenzeiten, denn Personengesellschaften werden mit der Einkommensteuer besteuert."
Der Unternehmer forderte: "Hamburg hat im Übrigen mit 470 Prozent bundesweit den höchsten Gewerbesteuer-Hebesetz – und das im Hochsteuerland Deutschland. Nach Jahren des heiteren Geldausgebens muss Hamburg nun endlich mit dem Sparen anfangen." Ein erste Möglichkeit wäre es, so Fehrmann, die ausufernden Ausgaben für Verwaltung, Bürokratie und Posten sowie Subventionen und Fördertöpfe zu reduzieren, die kaum Mehrwert schafften.
Gegenüber HANSEVALLEY erklärte er: "Eine wichtige Voraussetzung dafür ist die schnelle und umfassende Digitalisierung der Verwaltung, denn damit ließe sich die Effizienz der gesamten Stadt steigern. Wenn Online-Anträge in den Behörden doch wieder auf Papier bearbeitet werden, dann verzögert das nicht nur die Prozesse, sondern bindet auch unnötig Personal."
Die Hamburger Familienunternehmen stünden mit ihren Erfahrungen bei der Digitalisierung von Betrieben der Verwaltung bei der Umsetzung der Digitalisierung gerne als helfender Ansprechpartner zur Verfügung, so der Verbandsvertreter gegenüber dem Hanse Digital Magazin.
Laut aktueller Steuerschätzung des Hamburger Senats wird im laufenden Jahr mit Mindereinnahmen von 275 Mio. € gerechnet. In den darauffolgenden Jahren ergeben sich laut aktueller Hochrechnung geringere Steuereinnahmen von 38 Mio. € (2025), 15 Mio. € (2026) und 27 Mio. € (2027). Insgesamt reduzierten sich die Einnahmeerwartungen gegenüber der vorherigen Steuerschätzung um 231 Mio. €.
-
Otto-Konzern rutscht durch Umsatzeinbrüche und Rabatte in die roten Zahlen.
 |
Beim Familienkonzern Otto Group brennt's unterm Dach lichterloh.
Foto: Otto Group |
Hamburg, 25.05.2023: Der Handels-, Logistik- und Finanzkonzern "Otto Group" hat das Geschäftsjahr 2022/2023 mit 413 Mio. € Schulden abgeschlossen. Noch vor einem Vorjahr erreichte das Firmenkonglomerat um "Otto.de", "Hermes" und "EOS" einen Gewinn von 1,8 Mrd. €. Der Familienkonzern stürzte zudem insgesamt in eine Gesamtverschuldung i. H. v. 2,81 Mrd. €. Im Vorjahr hatte der "Otto-Konzern" seine Schulden auf 714 Mio. € reduzieren können.
Den Hamburger Konzern erwischte die massive Kaufzurückhaltung der deutschen Verbraucher in den vergangenen Monaten mit voller Wucht. So verloren die beiden Marktplatz-Anbieter "Otto" und "Abou You" durch die Inflation allein in Deutschland 6,2 % Umsatz. Die Online-Händler "Baur", "Limango", "MyToys" und weitere Shops mussten 7,2 % Federn lassen. Spezielle Zielgruppen-Anbieter, wie "Bonprix", "Heine" oder "Witt" sorgten dagegen für ein leichtes Wachstum von 2,3 %.
Das operative Ergebnis vor Abschreibungen, Zinsen und Steuern (EBITDA) halbierte sich in einem Jahr konzernweit von 1,2 Mrd. € auf 589 Mio. €. Am meisten kostete den "Otto-Konzern" der massive Abverkauf von vollen Warenlagern mit Saison-Mode. Hier hatte der Konzern nach zwei Jahren Wachstum "viel zu viel Ware vorgehalten", wie Finanzvorständin Petra Scharner-Wolff gegenüber der Presse zugab.
Die Gesamtverschuldung vervierfachte sich neben millionenschweren Rabattaktionen auch auf Grund ebenso teurer Investitionen in den Neu- und Umbau zweier "Hermes"-Logistikzentren" im polnischen Ilowa - 30 km westlich von Sachsen sowie am "Baur"-Standort im fränkischen Altenkunstadt, den Ankauf von Forderungen säumiger Verbraucher für das Geschäft der Inkassotochter "EOS" sowie die Beteiligung an drei Healthtech-Startups für 158 Mio. €.
Weltweit erzielte der Konzern mit 16,2 Mrd. € sogar 100 Mio. € mehr als im Vorjahr. Der Umsatz im E-Commerce lag global mit 12 Mrd. € ebenfalls auf Vorjahresniveau. Vor allem der US-Markt mit der E-Commerce-Tochter "Crate & Barrel" sorgte für gute Zahlen im internationalen Geschäft und ein Abfedern der inländischen Umsatzeinbrüche auf Grund der inflationsbedingten Kaufhemmung mit geringeren Warenkörben.
Um wieder in die schwarzen Zahlen zu kommen, hat der "Otto-Konzern" vor allem international einen Einstellungsstopp verhängt. Dazu kommen Kostenreduzierungen in Bereichen wie Transport und Logistik sowie eine defensivere Einkaufspolitik, um nicht wieder in eine Rabatt-Falle zu tappen. Zudem will "Otto" mit Hilfe schnellerer Lieferungen durch KI-gestützte Roboter in seinen "Hermes"-Logistik-Zentren in Haldensleben bei Magdeburg und Altenkunstadt die Kundenzufriedenheit erhöhen.
"Otto" gilt als besonders langsamer Online-Versender mit Zustellzeiten von bis zu zwei Wochen durch "Hermes". Erklärtes Ziel seitens Konzernchef Alexander Birken ist es, vor allem eine Next-Day-Delivery aufzubauen - vergleichbar des deutschen Marktführers "Amazon" mit seinem "Prime"-Lieferdienst.
Neben der E-Commerce-Sparte büßte die zum Konzern gehörende Logistiksparte mit "Hermes" im letzten Jahr 2,9 % ein. Lediglich die Inkasso-Sparte mit "EOS" konnte bei einem Umsatz von 983 Mio. € ein Plus von 24 % einfahren. Das Geschäft der "Otto Group" ist seit Jahren durch gemischte Zahlen im E-Commerce, negative Ergebnisse in der Logistik sowie hohe Gewinne im Inkasso-Geschäft geprägt.
-
Hamburger Generalstaatsanwalt sträubt sich gegen Digitalisierung von Gerichtsprozessen.
 |
Hamburgs Generalstaatsanwalt lehnt Videoaufzeichnungen in Prozessen ab.
Foto: HANSENVALLEY |
Hamburg, 24.05.2023: Der Generalstaatsanwalt der Freien und Hansestadt lehnt eine weitgehende Ausstattung von Gerichtssälen mit Kameras und Mikrofonen ab. Zur Unterstützung seiner ablehnenden Grundhaltung der Digitalisierung von Prozessen hat sich Jörg Fröhlich Rückdeckung von Generalstaatsanwälten aus anderen Bundesländern besorgt.
Die obersten Ankläger lehnen vor allem Filmaufnahmen vor Gericht ab und begründen dies u. a. Verschlossenheit von Zeugen in deren Aussagen, wenn diese mitgeschnitten werden. Die betreffe vor allem wichtige Details in Zeugenaussagen.
Das "jahrhundertealte System" der persönlichen Befragung und Augenscheinnahme habe sich bewährt, zitiert der "NDR" den Hamburger Chefankläger am Rande der Frühjahrstagung der Staatsanwälte in Berlin. Im Höchstfall solle eine Aufzeichnung auf Tonmitschnitte begrenzt werden.
Die Bundesregierung will die Digitalisierung von Gerichtsprozessen forcieren. Per Gesetz sollen alle Gerichte verpflichtet werden, Hauptverhandlungen aufzuzeichnen. Während der Corona-Pandemie hatte die Hamburger Justizbehörde bereits zahlreiche Gerichtssäle in den Gerichtsgebäuden im Sievekingplatz und in den Bezirken mit Video ausrüsten lassen.
-
USA-Reise von Hamburgs Bürgermeister Tschentscher offenbar Betriebsausflug Hamburger Behörden.
 |
Peter Tschentscher kommt mit seiner USA-Reise in Erklärungsnot.
Foto: HANSEVALLEY |
Hamburg, 23.05.2023: Die Delegationsreise des Ersten Bürgermeisters der Freien und Hansestadt in die USA ist offenbar mehr ein überdimensionierter Betriebsausflug von 20 vornehmlich lokalen Senatsvertretern nach Washington, Los Angeles und San Francisco gewesen, als eine politische Initiative des SPD-geführten Senats unter Peter Tschentscher. Das ergibt eine kleine Anfrage des wirtschaftspolitischen Sprechers der CDU-Fraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft, Prof. Götz Wiese.
Wiese kritisiert, dass für Vertreter von erfolgversprechenden Startups sowie mittelständischen Unternehmen an Alster und Elbe im Gegensatz zu Beamten, Geschäftsführern von Landesbetrieben und Senats-nahen Netzwerkern keinen Platz war: „Hamburger Startups, innovative Mittelständler oder Unternehmen aus der Metropolregion wurden nicht mitgenommen.“
Laut Senatsanwort waren u. a. folgende Vertreter von staatlichen Hamburger Organisationen Teilnehmer der Delegationsreise auf Kosten des Hamburger Steuerzahlers:
Johannes Berg, Geschäftsführer
Digital Logistics Hub Hamburg GmbH (Logistik-Initiative Hamburg, LIHH)
Harry Evers, Geschäftsführer
New Mobility Solutions Hamburg GmbH (Hamburger Hochbahn AG, HHA)
Suheil Mahayni, Geschäftsführer
Hamburg Port Consulting GmbH (Hamburger Hafen- und Logistik AG, HHLA)
Michael Otremba, Geschäftsführer
Hamburg Marketing GmbH (Behörde für Wirtschaft, BWI)
Jan Rispens, Geschäftsführer
Erneuerbare Energien
Hamburg Clusteragentur GmbH (Behörde für Wirtschaft, BWI)
Gesa Ziemer, Direktorin
City Science Lab (HafenCity Universität, HCU)
Der Senat entschuldigte sich in seiner schriftlichen Antwort: "Die Deutschland-Aktivitäten der besuchten Unternehmen waren regelmäßig Thema der Gespräche des Bundesratspräsidenten. Verhandlungen oder Vereinbarungen zu einzelnen Geschäftsaktivitäten waren nicht Gegenstand der Delegationsreise." Generell dienten Reisen des Bundesratspräsidenten "der parlamentarischen Diplomatie sowie der Aufnahme neuer und der Pflege bestehender Beziehungen", zitiert "DPA" den Senat.
Die einzige hochrangige US-Politikerin, die überhaupt Zeit für den Hamburger Bürgermeister hatte, war die ehemalige Sprecherin des US-Repräsentenhauses und Politikerin der Demokratischen Partei aus Baltimore, Nancy Palosi. Während seines Aufenthalts in Washington hatten kein US-Minister oder Gouverneure Zeit für den amtierenden Bundesratspräsidenten und Hamburger Bürgermeister. Wiese stellte nach der Senatsantwort fest: „Was für eine Verschwendung von Steuergeldern, welch eine verpasste Chance für den Wirtschaftsstandort Hamburg.“
Tschentscher erhoffte sich von der Delegationsreise eine Vertiefung der deutsch-amerikanischen Beziehungen. Die Neuausrichtung der internationalen Außen-, Sicherheits- und Handelsbeziehungen war nach Angaben des Hamburger SPD-Politikers eine wichtige Motivation für die Reise. Verhandlungen oder Vereinbarungen zu einzelnen Geschäftsaktivitäten waren laut Senatserklärung nicht Gegenstand der Delegationsreise.
Inwiefern die Beteiligung von Hamburger Verwaltungsmitarbeitern, Leitungspersonal der städtischen Hamburger Landesbetriebe und staatlicher Netzwerke sowie lokaler Journalisten zur Außenpolitik beigetragen haben soll, erklärte Tschentscher bis heute nicht. Die gesamte Meldung der Nachrichtenagentur "DPA" ist u. a. im "Hamburger Abendblatt" nachzulesen. Die kleine Anfrage an den Senat und die Antworten zur Beteiligung von Senatsvertretern an der Delegationsreise können in der Parlamentsdatenbank nachgelesen werden.
-
Rot-grüner Senat bricht eigene Digitalstrategie und legt freies WLAN in Hamburg zu den Akten.
 |
Der Hamburger Netzbetreiber "Willy.Tel" an einem Hotspot vor dem Rathaus.
Foto: Mobyklick |
Hamburg, 19.05.2023/Update 22.05.2023: Der rot-grüne Senat unter SPD-Medien- und Kultursenator Carsten Brosda wird die Hamburger Innenstadt entgegen der Versprechen aus dem Jahr 2016 nicht weitgehend flächendeckend mit freiem WLAN ausrüsten. "Eine nahtlose, flächendeckende Versorgung" könne in der City "nicht erreicht werden, unter anderem auf Grund von vorhandenen Beschränkungen", erklärte der Senat auf eine kleine Anfrage des CDU-Bürgerschaftsabgeordneten Sandro Kappe. Der Senat verweist auf das private "Mobiklick"-Netzwerk mit bis zu 2.500 Access-Points im Hamburger Stadtgebiet, u. a. auch in U- und S-Bahn-Stationen.
*Update*
Die zuständige Kultur- und Medienbehörde schiebt die Verantwortung für die Nicht-Umsetzung ihres Versprechens aus dem Jahr 2016 auf technische Schwierigkeiten - z. B. eine mangelnde Glasfaser- und Stromversorgung in Parkanlagen - ab. Der Stadtpark Norderstedt wurde vom "Mobyklick"-Partner "Wilhelm.Tel" der örtlichen Stadtwerke weitgehend mit freiem WLAN versorgt. Der Senat nimmt seinerseits die Betreiber von WLAN-Stationen in der Verantwortung, die ihre Access-Points auf Grund konkreter Nachfrage planen würden. Zudem ist sich die Hamburger Brosda-Behörde nicht zu schade, das Thema "Lieferkettenprobleme" für den Bruch des politischen Versprechens zu benutzen.
Ein Sprecher der SPD-Behörde verwies auf die zunehmende Versorgung mit Mobilfunk-Datenflatrates über die Landesgrenzen hinweg. Damit sinke die Notwendigkeit und Bedeutung öffentlich bereitgestellter WLAN-Zugänge. Der Sprecher verwies im Zusammenhang mit dem privat betriebenen "Mobiklick"-Netz auf die Bereitstellung öffentlicher Masten zur Montage der WLAN-Hotspots des Hamburger Betreibers "Willy.Tel". Der Senat hatte in der Vergangenheit im Rahmen von Presseterminen den Ausbau des "Mobiklick"-Netzwerkes mehrfach als eigenen Erfolg verkauft.
Sprecher Isermann lies es sich nicht nehmen, auf die kostenlosen WLAN-Zugänge in allen öffentlichen Verwaltungsgebäuden hinzuweisen, was für Kreuzfahrt- und andere Touristen nicht relevant ist. Mit der kleinen Anfrage des Senats wird allerdings offengelegt, dass die Ausstattung vieler Dienststellen mit freien WLAN-Hotspots z. B. in den Bezirksämtern Nord, Wandsbek und Eimsbüttel ebenso nicht vorhanden ist, wie im Landesvertrieb Verkehr. Auch die für Anwohner wichtigen Wochenmärkte bieten in Hamburg grundsätzlich kein freies WLAN der Stadt.
Am 14. April 2016 hatte der Internet-Anbieter "Willy.Tel" und die stadteigene "Stromnetz Hamburg" zusammen mit dem damaligen Staatsrat Brosda stolz die ersten kostenlosen WLAN-Hotspots an der Kreuzung Alstertor und Ferdinandstraße testweise freigegeben. Damit wurde ein kleiner Teil der Altstadt zwischen Ballindamm und Thalia Theater fürs kostenlose Surfen via Smartphone oder Tablet ausgeleuchtet. Noch im Jahr 2020 verkündete der SPD-geführte Senat in seiner ersten Digitalstrategie, ein "offenes und kostenfreies WLAN-Angebot im gesamten City-Bereich, an touristischen Hotspots und in den Bezirkszentren anzubieten". Mit dem aktuellen Rückzieher bricht der Tschentscher-Senat nach nur drei Jahren mit seiner eigenen Strategie.
*Update*
Das private WLAN-Netzwerk "Mobiklick" mit stadtweit bis zu 2.500 Hotspots und mehr als 100 Zugangspunkten innerhalb des Innenstadt-Rings basiert auf dem von den beiden Internet-Anbietern "Willy.Tel" (Hamburg) und "Wilhelm.Tel" (Norderstedt) gemeinsam aufgebauten und betriebenen Breitband-Netzes in Hamburg. "Mobiklick" wird u. a. von den ÖPNV-Anbietern "Hochbahn" und "S-Bahn-Hamburg" sowie von der "Haspa" für die Versorgung von Bahnhöfen bzw. Filialen genutzt, die für den Anschluss an das Netzwerk bezahlen.
Die Verkehrsbetriebe haben allerdings nur die Bahnhöfe mit WLAN ausgestattet. Auf den Strecken von U- und S-Bahn sind Fahrgäste auf die regulären Mobilfunk-Verbindungen angewiesen. Die Bahn-Tunnel wurden von "Vodafone" zentral im Auftrag aller drei heutigen Netzbetreiber mit Mobilfunk in 4G ausgeleuchtet. Laut Recherchen des HANSEVALLEY-Landeskorrespondenten gibt es gerade im S-Bahn-City-Tunnel nahe des Hauptbahnhofs massive Mängel in der Mobilfunk-Abdeckung mit fortlaufenden Verbindungsabbrüchen.
Der Hamburger CDU-Politiker Sandro Kappe bringt die aktuellen Zustände gegenüber den Kollegen der "Morgenpost" so auf den Punkt: "Der jetzige Zustand ist nicht weiter tragbar. Die digitale Stadt sieht anders aus".
-
Finanzsenator setzt Subvention der Hamburger Finanzbranche fort.
 |
Kreative Fintech-Sammlung einschl. Konzerntöchtern.
Grafik: Finanzplatz Hamburg |
Hamburg, 11.05.2023: Der für seinen Versuch der neun Millionen Euro schweren Corona-Mittel-Vergabe zugunsten eines Parteigenossen in die Kritik geratene SPD-Finanzsenator Andreas Dressel kündigte am Dienstag d. W. am Rande der Online-Marketing-Messe "OMR" die Gründung eines staatlich subventionierten Cluster-Netzwerkes für die Banken- und Versicherungsbranche Hamburgs an. Damit versucht der rot-grüne Senat der Freien und Hansestadt erneut, mit Steuergeldern politischen Einfluss auf eine Hamburger Branche zu bekommen.
Das geplante staatliche Wirtschaftscluster ist Teil des im Oktober 2021 veröffentlichen "Masterplans Finanzwirtschaft Hamburg" der Branchenvereinigung "Finanzplatz Hamburg", der die Vereinigung leitenden Handelskammer und der Hamburger Finanzbehörde. Die Regierungsfraktionen haben bereits im April 2021 insgesamt 1,3 Mio. € als Anschubfinanzierung für die Entwicklung des Masterplans und die Planung einer Cluster GmbH beschlossen. Der Aufbau des neuen staatlichen Clusters wird erneut Millionenbeträge aus dem Hamburger Steuersäckel kosten. Pikant: Handelskammer-Präses Norbert Aust warnte bei der Jahresabschlussveranstaltung der "Versammlung Eines Ehrbaren Kaufmanns" am 30.12.2022 vor der Einflussnahme der Hamburger Politik auf die Wirtschaft der Stadt über die staatlich finanzierten Cluster-Netzwerke. Grund: Die Politik stelle die Cluster als repräsentative Wirtschaftsvertretungen dar, die durch die Finanzierung seitens des Senats aber die offizielle Politik der Regierung vertreten würden. Aust wörtlich: "Interessenvertretung der Wirtschaft ist und bleibt Aufgabe von Kammern und Verbänden – aus guten Gründen!"
Wie die Handelskammer Hamburg den Widerspruch zur Beteiligung an der städtisch bereits mitfinanzierten Vereinigung "Finanzplatz Hamburg" und dem staatlichen Cluster-Netzwerk "Gesundheitswirtschaft Hamburg" auflösen will, blieb Aust beim "VEEK"-Event schuldig. Mit der Gründung eines Finanzmarkt-Clusters unter Beteiligung von "Finanzplatz Hamburg" wird die Abhängigkeit der Hamburger Handelskammer mit ihren Banken und Versicherungen eher größer und eine von der Senatspolitik unabhängige Entwicklung der Branche deutlich erschwert.
Die Hansestadt ist als einst zweitgrößter Fintech-Standort auf einen bundesweit 5. Platz abgerutscht. An Alster und Elbe gibt es laut "German Fintech Report" mit Stand Juli '21 lediglich 55 junge, schnell wachsende Unternehmen der Finanzbranche. Der Branchenverein "Finanzplatz Hamburg" listet selbst 85 vermeintliche Fintechs auf - darunter die fusionierte Commerzbank-Tochter "Comdirect" aus Quickborn, die etablierte Sparkassen-Software-Tochter "Starfinanz" sowie die digitalen Identity-Unternehmen "Nect" sowie "WebID" aus Berlin.
Bundesweiter Spitzenreiter ist nach der Studie des "German Fintech Reports" die Startuphauptstadt Berlin mit mind. 162 Fintechs, gefolgt von der Finanzmetropole Frankfurt/Main mit gezählten 118 Startups sowie der Technologieregion München und Bayern mit 109 registrierten Jungunternehmen. Auf Platz 4 folgt NRW mit den Startup-Hubs Köln, Düsseldorf und der Rhein-Ruhr-Region und 63 jungen Finanzfirmen. Damit ist Hamburg laut Erhebung nur sechs Fintechs vor dem bundesweiten Schlusslicht Stuttgart entfernt.
Hamburg gilt auch nach der Banken- und Finanzkrise von 2008 neben Frankfurt am Main mit rd. 10.000 Betrieben und bis zu 50.000 Beschäftigten weiterhin ein bedeutender Finanzplatz in Deutschland zu sein. An Alster und Elbe sitzen die 1558 gegründete älteste Wertpapierbörse Deutschlands, mit "Berenberg" Deutschlands älteste Privatbank von 1590, die durch ihre Cum-Ex-Geschäfte in Verruf geratene "Warburg"-Bank und die größte deutsche Sparkasse "Haspa". In der Kaufmannsstadt wurden die "Commerzbank" und die "Vereins- und Westbank" als Teil der späteren "HVB" aus der Taufe gehoben.
-
Rot-grüner Hamburger Senat gerät mit Immobilienankauf und Wirtschaftspolitik in die Kritik.
 |
119 Mio. € teurer Sanierungsfall: Die Hamburger Finanzbehörde am Gänsemarkt.
Foto: HANSEVALLEY |
Hamburg, 03.05.2023: Die Familienunternehmer in Hamburg und der Metropolregion kritisieren den rot-grünen Senat inkl. des umstrittenen SPD-Finanzsenators Andreas Dressel für den geplanten, millionenschweren Ankauf der Finanzbehörde am Hamburger Gänsemarkt. Die familiengeführten Unternehmen warnen vor Millionen-schweren Kosten und fordern, die Mittel stattdessen in Zukunftsprojekte zu investieren.
Familienunternehmer und Regionalvorsitzender Henning Fehrmann erklärte nach dem Beschluss des Senats am Dienstag, die Immobilie für rd. 119 Mio. € zurückzukaufen: „Vergleichbare Städte wie Kopenhagen, München oder Zürich investieren in Köpfe, Wissenschaft und Forschungsinfrastruktur und stärken damit ihre Wettbewerbsfähigkeit. Hamburg investiert offenbar lieber in teure Verwaltungsgebäude.“
Das Gebäude am Gänsemarkt mit rd. 20.000 qm Bürofläche gilt als Sanierungsfall und soll nach dem Rückkauf vollständig modernisiert werden. Unternehmer Fehrmann pointerte: „Der Rückkauf scheint insgesamt eher aus Prestige- als aus wirtschaftlichen Gründen zu erfolgen und fügt sich in einen gefährlichen Trend ein. Die Stadt Hamburg kauft immer mehr Gebäude, Grund und Boden an."
Laute Kritik an der Politik des Tschentscher-Senats gibt es auch für die Wirtschaftspolitik von Rot-Grün. Die CDU in der Bürgerschaft prangerte am Dienstag d. W. die Vorstellung eines vermeintlichen "Außenhandelskonzepts" der Freien und Hansestadt auf 84 Seiten als "alten Wein in neuen Schläuchen" an. Der wirtschaftspoltische Sprecher der Fraktion, Prof. Götz Wiese:
"Die Zeichen stehen an der Wand: Andere Wirtschaftszentren ziehen an uns vorbei und gehen zukunftsweisende Verbindungen ein - siehe Green & Digital Corridor zwischen den Port Authorities in Singapur und Rotterdam. Ganzen Branchen droht der Exodus. Innovative Startups und Wagniskapital zieht es in andere Städte als Hamburg."
Der Senat unter SPD-Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard solle sich auf neue Kooperationen, z. B. mit Häfen in den USA und Afrika fokussieren - und nicht nur mit chinesischen Containerterminals. Die USA-Reise des Ersten Bürgermeisters Tschentscher sei diesbezüglich ein Versäumnis, ebenso wie die überalterte "Hamburg Ambassadors"-Politik ohne einen einzigen Vertreter auf dem afrikanischen Kontinent.
-
Hamburger Senat lässt womöglich unsichere Vay Tele-Shuttles weiter fahren.
 |
Ein offensichtlich nicht 100% sicheres Tele-Shuttle in Bergedorf.
Foto: Vay |
Hamburg/Berlin, 21.04.2023: Der Senat der Freien und Hansestadt Hamburg hält weiter an einem laufenden Pilotprojekt des Berliner Carsharing-Startups "Vay" im Osten Hamburgs fest. Das Risikokapital-finanzierte Jungunternehmen hat im Dezember vergangenen Jahres von der Hamburger Innen- und Verkehrsbehörde eine Ausnahmegenehmigung zum Betrieb einer drei Kilometer langen Teststrecke mit einem ferngesteuerten E-Fahrzeug ohne Fahrer an Board im Bezirk Hamburg-Bergedorf erhalten.
Vor zwei Tagen veröffentlichte das Berliner Startup-Magazin "Gründerszene" im Verbund mit dem Wirtschaftsmagazin "Business Insider" einen Enthüllungsbericht, aus dem hervorgeht, dass der Fahrdienst "Vay" von eigenen Telefahrern als nicht 100 % sicher bewertet wird und den Genehmigungsbehörden im Rahmen des Verfahrens nur ausgewählte und nicht alle geforderten Daten geliefert wurden.
Ein Sprecher der Hamburger Verkehrsbehörde erklärte nach einer Krisensitzung der beteiligten Beamten mit der Geschäftsführung von "Vay" vom Mittwoch d. W.: "Wir haben Vay gebeten, uns gegenüber zum Sachverhalt Stellung zu nehmen. Vay hat der Behörde gegenüber dargelegt, dass bis dato im Rahmen der Testfahrten in Bergedorf keine besonderen Vorkommnisse verzeichnet wurden. Alle für das komplexe Genehmigungsverfahren erforderlichen Unterlagen wurden eingereicht und geprüft."
Die Verkehrsbehörde unter dem Grünen Senator Anjes Tjarks bleibt bei ihrer Position, den teleoperierten Fahrbetrieb auf Grund des ursprünglich vorgelegten Gutachtens des "TÜV Süd" als sicher zu bewerten und in der Konsequenz weiter laufen zu lassen: "Im Ergebnis gehen die beteiligten Genehmigungsbehörden von einem durch umfangreiche Bestimmungen, Bedingungen und Auflagen abgesicherten verkehrssicheren Betrieb der Erprobungsfahrten aus."
Die für die Straßenzulassung des Testbetriebs in Hamburg-Bergedorf zuständige Innenbehörde des mehrfach juristisch und politisch in die Kritik geratenen SPD-Senators Andy Grothe verweigerte auf Anfrage am Donnerstag d. W. eine Stellungnahme zur Entscheidung der ihr unterstellten Polizei zu Gunsten des offensichtlich nicht sicherheitsorientiert arbeitenden Jungunternehmens aus Berlin.
"Vay" versuchte in einer dreiseitigen Stellungnahme, die Vorwürfe von "Gründerszene" zu enthärten. Dabei stellte das 2018 von Thomas von der Ohe, Fabrizio Scelsi und Bogdan Djukic gegründete Startup auf über einer Seite lediglich sein Geschäftsmodell vor. Zu den konkreten Vorwürfen erklärte eine Sprecherin des Jungunternehmens:
"Wir stellen fest, dass wir zu keinem Zeitpunkt Daten zu Sicherheit und Zwischenfällen “geschönt” haben und uns somit auch keine Ausnahmegenehmigung “erschlichen” haben." Weiter erklärte die Firmen-Vertreterin: "Die Aussage, man sei noch nicht bereit, den/die Sicherheitsfahrer/in aus den Fahrzeugen zu nehmen, kann nicht in den Kontext mit der erlangten Ausnahmegenehmigung für Hamburg-Bergedorf gesetzt werden."
Auf die Kritik von Telefahrern entgegnet "Vay": "Der Artikel unterstellt darüber hinaus, dass wir Sicherheitsbedenken unserer Telefahrer/innen verschwiegen haben. Das ist nicht richtig. Die Befragungsergebnisse, auf die sich Gründerszene beruft, stammen überwiegend von Telefahrer/innen in der Ausbildung mit nur wenig Praxiserfahrung und nicht von vollständig ausgebildeten Telefahrer/innen."
Sollten sich die Verdachtsmomente gegen "Vay" im Zusammenhang mit mangelnder Sicherheit bei der Mobilfunk-basierten Fernsteuerung von Fahrzeugen weiter erhärten, dürfte die Zukunft des Jungunternehmens zur Disposition stehen und die Hamburger Senatoren Tjarks (Grüne) und Grothe (SPD) in Erklärungsnöte geraten, da die Sicherheit der Anwohner auf der Teststrecke in Hamburg-Bergedorf dann leichtfertig in Kauf genommen wurden.
Mit dem erstmals in Hamburg gestarteten ferngesteuerten Bringdienst will das Startup "Vay" in Zukunft einen serienmäßigen Tür-zu-Tür-Anfahrtsdienst für seine E-Carsharing-Fahrzeuge aufbauen. Das Unternehmen hat Niederlassungen in Berlin und Hamburg sowie in Portland, USA. "Vay" hat zuletzt 95 Mio. US-Dollar in einer Series-B-Finanzierungsrunde eingesammelt und steht mit seinen rd. 165 Mitarbeitern unter massivem Erfolgsdruck, seinen Dienst an den Start zu bringen.
-
"Otto" und "Baur" haben Rücksendungen und Gutschriften bis heute nicht im Griff.
 |
Große Eigen-PR, mangelhafte Retourenabwicklung bei "Otto" & Co.
(Foto: HANSEVALLEY) |
Hamburg/Burgkunstadt, Update: 18.04.2023: Die Online-Shops des Hamburger Handelskonzerns "Otto Group" - "Baur" und "Otto.de" - haben fortlaufend erhebliche Schwierigkeiten bei der Bearbeitung von Retouren und der daraus zu erfolgenden Gutschrift von Rechnungen. Wie aktuell aufgetretene Probleme mit den beiden Großversendern und eine daraus eingeleitete Recherche der HANSEVALLEY-Redaktion herausgefunden hat, bestehen die Probleme vor allem bei Rücksendungen über externe E-Commerce-Dienstleister, die im Auftrag von Herstellern, deren Paketversendern oder Abwicklungspartnern - wie der u. a. in Hamburg aktiven Softwarefirma "onQuality Deutschland" im Auftrag von "Baur" und "Otto Versand" - für Retouren zuständig sind.
Das Problem: Kaufen Kunden bei "Otto.de" oder der Schwesterfirma "Baur" auf Rechnung, wird diese 14 Tage nach dem Versand der Ware fällig. Wird dann - z. B. Bekleidung - zurückgeschickt, werden die Rechnungen bei nicht bearbeiteten bzw. korrekt gutgeschriebenen Retouren trotzdem fällig. Zwar verlängern die Versandhändler auf Kundenbeschwerde das Zahlungsziel um bis zu vier Wochen, eine korrekte Retourenabwicklung einschl. Gutschrift in der gesetzlich vorgeschriebenen Zeit erfolgt jedoch nicht.
Die Vorfälle bei "Baur" und "Otto.de" sind aktuelle Ereignisse aus den vergangenen zwei Monaten und bis heute offen - sprich bis zur Veröffentlichung nicht korrekt verbucht worden. Zudem sind vergleichbare Fälle mit nicht bearbeiteten und erst nach Kundenbeschwerden erfolgte Korrekturen in den vergangenen Jahren sowohl bei "Baur" als auch bei "Otto.de" mehrfach aufgetreten. Damit handelt es sich nicht um "bedauerliche Einzelfälle", sondern um systematische Probleme in der Verarbeitung von Retouren des Konzerns und seiner Online-Shops.
Zudem mangelt es bei beiden Großversendern - wie bereits in der Vergangenheit von HANSEVALLEY zu Recht kritisiert - an einem professionellen Kundendienst. Auch in den aktuellen Fällen zickten Supporter - hier bei "Baur" - unser Redaktionsmitglied als Betroffenen an. Die aktuellen Fälle legen nah, dass - im Gegensatz zu "Amazon" - keine kundenzentrierte Problemlösung im Vordergrund steht, sondern die Durchsetzung eigener, auch rechtlich angreifbarer Ziele. Die bekannten Fälle unprofessioneller Kundenbetreuung ergänzen die mehrfach verzögerte Abwicklung von Lieferungen durch die Konzerngesellschaft "Hermes" mit ihren Versandlagern u. a. für die Shops von "Otto" und "Baur", fünf eigenen Retourenbetrieben und zwei weiteren ausländischen Standorten.
Der Kundendienst von "Baur" wie "Otto" argumentiert seit Jahren auf Anfrage, dass die Retouren "in zwei bis drei Wochen" bearbeitet werden". Dies ist rechtlich angreifbar, da der Versender die Retoure nach geltendem Verbraucherschutz maximal zwei Wochen nach Einlieferung der Rücksendung beim Paketdienst (z. B. "DHL" oder "Hermes") bearbeitet haben muss. Der E-Commerce-Anbieter hat dann max. weitere zwei Wochen Zeit, dem Kunden die Rückerstattung oder Gutschrift auszuhändigen. Den Umstand der offensichtlich rechtswidrigen Retourenbearbeitung mit eigenen, gesetzeswidrigen Abwicklungszeiten wird HANSEVALLEY gegenüber der Verbraucherzentrale zur Abmahnung melden.
Offensichtlich haben weder "Otto.de" noch "Baur" ihre Retourenprozesse, insbesondere im Zusammenspiel mit externen Retourenabwicklern, im Griff. Zugleich zeigen die Online-Systeme beider Online-Shops auch bei gelieferten Artikeln durch die Konzernschwester "Hermes Fulfillment" massive Mängel: Sowohl die Lieferung als auch die Rücksendung gekaufter Artikel wird z. T. gar nicht, z. T. nur teilweise und mit veralteten Angaben angezeigt. Dies ist kein Einzelfall, sondern bei Käufen über die beiden genannten Online-Händler seit Jahren ein nicht behobener Mangel, wie die Kaufhistorie des hier betroffenen Kunden zeigt.
"Otto" hat allein am Standort Hamburg von insgesamt rd. 6.200 Mitarbeitern im E-Commerce-Bereich rd. 2.000 ITler und technische Mitarbeiter, allerdings gilt der Familienkonzern technisch als veraltet und rückständig. So brauchte "Otto.de" nach eigenen Angaben drei Jahre und mind. 166 Mio. €, um im Sommer 2020 stolz verkünden zu können, auch einen funktionierenden Online-Marktplatz anbieten zu können. Zuvor wurden Marktplatz-Händler mit ihren Produkten nach eigenen Angaben mit Faxen geboardet.
E-Commerce-Konzernvorstand Sebastian Klauke bestätigte bei der Konzern-Bilanzpressekonferenz im Februar d. J., dass der Umbau des monolithischen E-Commerce-Systems von "Otto.de" weiterhin pro Jahr Millionenbeträge koste. Im Konzern gibt zudem bis heute verschiedene Shop-Systeme, die von eigenen Töchtern und Beteiligungen - wie "Otto Group Solution Provider" in Dresden oder "About You Tech" in Hamburg entwickelt werden. Laufen bei "Otto" und "Baur" "Otto"-eigene Shop-Systeme, arbeitet "About You" wie die Konzerngesellschaften der "Witt-Gruppe" einschl. "Heine" auf "About You"-Systemen.
Zwar hat der "Otto"-Konzern mit "otto.de" am 1. September 1995 den ersten Online-Shop in Deutschland gelauncht, wie der Hamburger Handels-, Versand- und Inkassokonzern u. a. mit seinen Sparten "Otto.de", "Hermes" und "EOS" anlässlich des 80. Geburtstages von Aufsichtsratschef Michael Otto in der aktuellen Eigen-PR hervorhebt. Gleichzeitig haben die Hamburger mit ihrem Flaggschiff "Otto.de" gegen den 1998 in Deutschland angetretenen Erzrivalen und seit 2002 - und damit 16 Jahre vor "Otto.de" - mit eigenem Drittanbieter-Marktplatz präsenten US-Konzern "Amazon" jegliche Führungsrolle in Deutschland verloren.
Insbesondere der Online-Shop von "Otto.de" gilt unter Verbrauchern im Vergleich zu "Amazon", "Ebay" und anderen Shops und Marktplätzen als teuer und im Versand als äußerst langsam. Z. T. brauchten Sendungen über "Hermes" in der Vergangenheit bis zu zwei Wochen, während die Eigenwerbung auf "otto.de" eine "Lieferung in 2-3 Tagen" vorgaukelte. "Otto.de" erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2022/2023 nur noch 4,52 Mrd. € Umsatz, ein Einbruch von 600 Mio. € bzw. 12 %. "Amazon EU" erwirtschaftete mit seinem deutschen Ableger im vergangenen Jahr einen Umsatz von 33,6 Mrd. €, ein Rückgang von 3,7 Mrd. € zum Corona-Jahr 2021. Auf "Otto.de" gibt es laut Eigenreklame bis zu 5.000 Marktplatz-Händler, auf "Amazon.de" insgesamt rd. 300.000, davon rd. 100.000 Drittanbieter mit Sitz in Deutschland.
Der betroffene Kunde und Redaktionsmitglied wird bei weiterer Verzögerung der Retourenabwicklung und Rechnungsgutschrift rechtliche Mittel gegen die verantwortlichen Online-Shops einleiten. HANSEVALLEY rät auf Grund der seit Jahren unverändert festgestellten Mängel im Bereich Rücksendungen und Gutschriften und daraus bestehender Risiken für die Kunden von einem Einkauf bei "Baur" und "Otto.de" ab.
-
Hamburger Versandhändler Otto schreibt rote Zahlen.
 |
Bei Otto.de wackeln nach einem schlechten Jahr hinter den Kulissen die Stühle.
Foto: HANSEVALLEY |
Hamburg, 28.03.2023: Der größte deutsche Online-Händler - das Hamburger Versandhaus "Otto.de" - hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022/2023 rote Zahlen eingefahren und damit effektiv Verluste gemacht. Das gestand "Otto"-Bereichsvorstand Marc Oppelt in der vergangenen Woche im Rahmen der Bilanzpressekonferenz ein. Zwar hat der größte Online-Händler im "Otto Group"-Konzern beim Brutto-Umsatz nur 8,6 % eingebüßt und insgesamt 6,3 Mrd. € erreicht.
In dem Umsatz sind jedoch auch alle Einkünfte der aktuell laut Eigenangaben rd. 5.000 Marktplatz-Händler dabei. Mit diesen verdient "Otto" nur über Verkaufsprovisionen, Werbeplatzierungen auf "Otto.de" sowie die konzerneigene Versandlogistik von "Hermes". Nach Angaben von "Statista" ist der Außenumsatz von "Otto.de" effektiv von 5,12 Mrd. Euro im Vorjahreszeitraum auf nur noch 4,52 Mrd. € netto eingebrochen - und damit im Kern um 600 Mio. € bzw. 12 %.
Der Hamburger Online-Händler gilt in Branchenkreisen trotz seiner Größe als akut gefährdet. "Otto.de" hat erst im Jahr 2018 aktiv mit der Öffnung seiner Website zur Handelsplattform begonnen - und damit 16 Jahre nach dem Erzrivalen "Amazon". Aktuell sind bei "Amazon" schätzungsweise rd. 300.000 Marktplatz-Händler aktiv, davon rd. 100.000 mit Sitz in Deutschland. Bei "Otto.de" sind es insgesamt nur 5.000.
In der Konsequenz der katastrophalen Ergebnisse hat "Otto Group"-Vorstand Sebastian Klauke Entlassungen beim Hamburger Handelskonzern nicht ausgeschlossen. Allein in Hamburg-Bramfeld arbeiten für "Otto.de" und die Konzern-Mutter "Otto Group" rd. 6.000 Mitarbeiter im E-Commerce-Bereich - ohne die Hamburger Tochter "Bonprix" und die Beteiligung "About You".
Zudem hat der Konzern den Spielzeug-Händler "MyToys" mit 19 Filialen und Online-Shop bis Ende Februar 2024 zur Schließung freigeben. Allein bei "MyToys" mit der Schwestermarke "Mirapodo" bauten sich seit Übernahme insgesamt rd. 250 Mio. € Schulden auf, die bislang von der Muttergesellschaft getragen wurden. 2019 hatte der Konzern bereits seine verlustbringende Sportartikel-Tochter "Sportscheck" an die "Galeria Karstadt Kaufhof"-Eignerin "Signa Retail" verkauft.
-
Experten-Kommission bescheinigt Hamburger Informatik-Standort Mittelmäßigkeit.
.jpg) |
Nach dem abrupten Ende von "Ahoi Digital" demonstriete die Uni Hamburg gegen den Senat.
Grafik: Universität Hamburg |
Hamburg, 13.03.2023: Die Freie und Hansestadt muss massiv in den Ausbau der Informatik an ihren vier staatlichen Hochschulen investieren, wenn namhafte Unternehmen auf Grund des Mangels an IT-Fachkräften einzelne Firmenbereiche nicht in andere Städte und Regionen verlagern sollen. Davor warnt eine achtköpfige Expertenkommission im Auftrag der Hamburger Wissenschaftsbehörde. Es sei zudem nötig, dass ein "zusätzliches erhebliches finanzielles Engagement des Landes" u. a. den Exellenzstatus der Universität Hamburg sichere.
Laut der aktuell veröffentlichen Studie fehlt Hamburg in der Informatik ein Alleinstellungsmerkmal, heißt: Hamburg steht weder für Exzellenz im Bereich Künstlicher Intelligenz noch Quantencomputing. Das Expertengremium fordert in der Konsequenz neue Lehrstühle z. B. an der UHH und der TUHH für maschinelles Lernen und Datenwissenschaft. Außerdem sollten Brückenprofessuren als Verbindung der Informatik zu anderen Fachbereichen eingerichtet werden und die Zahl der Informatik-Studienplätze müsse erheblich wachsen.
Heute gehört Hamburg laut des im Auftrag des Senats erstellten Gutachtens durch anerkannte Experten in der "Kommission zur Begutachtung von Perspektiven der Hamburger Informatik im Prozess der Digitalen Transformation" in den IT-Bereichen Studium, Forschung und eingeworbene Forschungsgelder nicht zu den fünf führenden Informatik-Standorten in Deutschland. Hamburg spielt laut des Kommissionsvorsitzenden Prof. Wolfgang Wahlster zwar in der ersten Liga mit, jedoch lediglich im Mittelfeld.
Der Gründungsdirektor des rennomierten KI-Forschungszentrums DFKI und heutiger Chefberater nennt München, Karlsruhe, Saarbrücken und Aachen als führende Forschungsstandorte. Dazu kommt im Mittelfeld auch Oldenburg als Teil des DFKI-Standortes Niedersachsen. Das DFKI hat in Norddeutschland neben Bremen sowie Oldenburg und Osnabrück auch Lübeck als Forschungsstandort für Künstliche Intelligenz ausgewählt. Hamburg musste sich gegen den KI-Medizinstandort Lübeck geschlagen geben.
"Die Ergebnisse des Gutachtens bestärken uns in dem dringenden Appell, den Informatik-Standort endlich auf ein Niveau mit München und Berlin weiterzuentwickeln," kommentierte der Vorsitzende des "IT-Executive Clubs Hamburg" - Raphael Vaino - die kritischen Ergebnisse gegenüber dem "Abendblatt". Laut des Vorsitzenden der Vereinigung von IT-Chefs 120 Hamburger Unternehmen gelte es, einen großen Bedarf an IT-Fachkräften in Hamburg zu decken, um "in unserer Metropolregion nicht weiter zurückzufallen und Arbeitsplätze dauerhaft an andere Regionen zu verlieren."
Der IT-Chef des Hamburger Distanzhändlers "Otto" und Mitglied der Kommission - Michael Müller-Wünsch - sagte zu den erarbeiteten Ergebnissen: „Hamburg muss den Anspruch haben, ein Top-Standort für Zukunftstechnologien wie Informatik und Künstliche Intelligenz in Deutschland und Europa zu werden. Dafür braucht es signifikante, zusätzliche Investitionen in die Wissenschaft sowie die universitäre Ausbildung insbesondere an den staatlichen Hochschulen vor Ort."
Kommissionsvorsitzender Wahlster lobt im Zusammenhang mit den staatlichen Hochschulen in Hamburg die seit Gründung der Informatik-Initiative "Ahoi Digital" verbesserte Zusammenarbeit bei Berufungskomissionen, Lehrplänen und Prüfungsleistungen. Wahlster und die Komission fordern zur weiteren Verbesserung der Informatik jedoch millionenschere Zusatzinvestionen des Senats - und keine Umwidmungen bestehender Mittel für die Hochschulen.
Der Senat hatte mit der gemeinsamen Informatik-Initiative "Ahoi Digital" versprochen, mit Investitionen von bis zu 32,9 Mio. € - davon 13,6 Mio. € aus den laufenden Hochschul-Etats - bis zu 35 neue Professuren, 10 Junior-Professuren und 37 Stellen für neue Wissenschaftsmitarbeiter sowie in der Spitze 1.500 neue Informatik-Studienplätze schaffen zu wollen. Laut offiziellen Angaben der Wissenschaftsbehörde der Grünen Senatorin Katharina Fegebank wurden in den gerade drei Jahren Laufzeit jedoch nur 16 Professuren geschaffen.
Nach dem abrubten Ende der Finanzierung erklärte der frühere Chief Digital Officer der Hamburger Wirtschaftsbehörde und der Hafenverwaltung "HPA" - Sebastian Saxe - gegenüber HANSEVALLEY: "Ohne Forschung und Lehre gäbe es keine Menschen, die neue Erfindungen oder neue Ideen in die Praxis umsetzen. Statt 'Ahoi Aufbruch' steht 'Ahoi, wir gehen unter' auf der Tagesordnung! Wir dürfen Hamburgs Informatiklandschaft nicht schwächen, sondern müssen diese weiter stärken."
Senatorin Fegebank kündigte in einer ersten Stellungnahme an, sie wolle "im Schulterschluss mit den Hochschulen eine Informatik-Initiative schaffen." Dabei wolle sie "wichtige Impluse" der Studie mit aufgreifen. Ob die neue "Informatik-Initiative" im Stil der ersten z. T. scharf kritisierten Förderung geplant ist, bleibt offen. Als Entschuldigung betonte die Zweite Bürgermeisterin, in Abstimmung mit allen staatlichen Hamburger Hochschulen zunächst das Bachelor-Studium der HAW Hamburg stärken zu wollen. Daran sollten sich dann die Masterstudiengänge von HCU, TUHH und UHH anschließen können.
Eine weitergehende offizielle Erklärung zur Kritik der Kommission an der Mittelmäßigkeit des Informatik-Standortes Hamburg haben der Senat und die zuständige Grüne Senatorin bislang nicht abgegeben.
-
Hamburger Otto-Konzern macht MyToys-Spielzeugläden und den Online-Shop dicht.
 |
Der Spielzeughändler MyToys wird von der Otto Group geschlossen.
Grafik: MyToys |
Hamburg, 07.03.2023: Der Handelskonzern "Otto" schließt seine Berliner Tochtergesellschaft "MyToys" mit ihrer Verwaltung, die dazugehörenden 19 Spielwarengeschäfte und die beiden Online-Shop-Marken "MyToys" und "Mirapodo". Rund 800 Mitarbeiter sind von der Entscheidung des Hamburger Familienkonzerns betroffen und sollen bis Ende Februar 2024 über einen Sozialplan das Unternehmen verlassen.
Der 1999 gegründete Spielzeughändler fährt nach Medienangaben kontinuierlich rote Zahlen ein, die bislang vom Mutterkonzern und profitablen Geschäftsbereichen ausgeglichen wurden. In einer internen Mitteilung an die Belegschaft, die dem Fachmagazin "Internet Business" vorliegt, wird von erheblichen Risiken auf Grund eines "steigenden Margen-, Kosten- und Marktdrucks" im hart umkämpften Spielzeugmarkt gesprochen.
"MyToys" vertrieb neben Spielwaren unter anderem auch Babyausstattung, Kinderkleidung, Sportartikel, Kinderschuhe und Schwangerschaftskleidung. Die Produkte von "MyToys" sollen - wie bereits bisher - unter dem Dach von "Otto.de" weiterleben. Damit will der "Otto"-Konzern zugleich sein Sortiment im Spiezeugbereich ausbauen. Hierzu gehören auch zwei Eigenmarken von "MyToys".
Die bisherigen Marktplatz-Händler auf "mytoys.de" sollen künftig über die Plattform "otto.de" ihre Produkte vertreiben. Die vom "Baur"-Versand 2013 in den "MyToys"-Verbund eingebundene Schuhmarke "Mirapodo" wird vom Markt verschwinden. Von der Schließung nicht betroffen ist der 2009 gegründete und seit 2013 ebenfalls zur "MyToys"-Plattform gehörende Discountmarke "Limango". Der in München beheimatete Shopping-Club mit eigenem Marktplatz läuft profitabel und wird unverändert fortgeführt.
-
Misslungener Fintech-Accelerator kostet Hamburger Steuerzahler im Nachgang 370.000,- €.
 |
SPD-Finanzsenator Dressel hatte den Fintech-Accelerator versucht, durchzudrücken.
Foto: SK Hamburg |
Hamburg, 03.03.2023: Der durch Opposition und Regionalmedien in Hamburg im Januar vergangenen Jahres in letzter Minute gestoppte Startup-Accelerator für Fintech-Jungunternehmen kostet den Hamburger Steuerzahler im Nachgang 370.000,- € Entschädigung aus Landesmitteln. Damit sollen die im Vorfeld entstandenen Personal- und Beratungskosten des geplanten Fintech-Accelerators abgegolten sein.
Der Hamburger SPD-Funktionär Nico Lumma hatte nach dem Stopp des durch die Finanzbehörde, die Handelskammer und den Branchenverband "Finanzplatz Hamburg" geplanten Startup-Förderprogramms 1,9 Mio. € Schadensersatz gefordert und zog mit der Millionenforderung im Juni '22 vor ein Schiedsgericht. Nach Meinung Lummas hätte er gemäß des niemals unterschriebenen Vertrags Anspruch auf die volle Management- und Beratungs-Fee für 2022 von 1,3 Mio. € gehabt.
Im August letzten Jahres wurde Lumma und der "NMA" GmbH als ursprünglich geplantem Betreiber die 370.000,- € überwiesen. Der in die Kritik geratene SPD-Finanzsenator Andreas Dressel begrüßte die Einigung und erklärte, mit einem ersatzweise gestarteten Zuschussprogramm über 2,5 Mio. € im ersten Schritt die Ziele der Fintech-Förderung von Senat, Kammer und Branchenverband erreichen zu können.
Ursprünglich waren für das Fintech-Programm mit eigenen Accelerator 9 Mio. € aus Corona-Mitteln der Finanzbehörde geplant. Nachdem SPD-Finanzsenator Dressel versucht hatte, die Corona-Haushaltsmittel ohne öffentliche Ausschreibung dem Hamburger SPD-Funktionär Lumma und dessen "Next Media Accelerator" zuzuschieben, erntete der Versuch massive öffentliche Kritik der Hamburger Oppositionsparteien CDU und Linke sowie unabhängiger Medien, wie der "Morgenpost" und HANSEVALLEY. Daraufhin zog Parteigenosse Dressel die Reißleine und sagte die versuchte "Millionen-Schieberei" ab.
-
Filzverdacht: Tagesjournal ermöglicht Schleichwerbung für Wirtschaftsförderung Hamburg Invest.
 |
Der Hamburger Newsletter "Tagesjournal" fällt immer wieder durch Schleichwerbung auf.
Grafik: Hamburger Tagesjournal |
Hamburg, 01.03.2023: Der private Nachrichten-Newsletter "Hamburger Tagesjournal" hat erneut werbliche Inhalte in seinem täglichen Online-Überblick als journalistische Berichterstattung präsentiert und offenbar bewusst die verpflichtende Kennung als Werbung unterlassen. In dem aktuellen Fall vom Dienstag d. J. verweist der vom Berliner Medienunternehmer Egon Schmitt verantwortete Newsletter ohne jede Kennung auf einen gekauften Beitrag der Hamburger Wirtschaftsförderung "Hamburg Invest".
Unter der Schlagzeile "Positive Bilanz für Scaleup Landing Pad Hamburg" verweist der vom Hamburger Volkswirt und Ex-Mitarbeiter von "Axel Springer" und "Hamburg 1" Mathias Adler herausgegebene Newsletter auf einen Werbeartikel des Startup-Magazins "Deutsche Startups". Das Berliner Online-Magazin hat den Beitrag eindeutig erkennbar als "Anzeige" gekennzeichnet. Dagegen suggeriert die Verlinkung des "Tagesjournals" eine redaktionelle Berichterstattung zur gekauften Lobeshymne über das von "Hamburg Invest" betreute Startup-Programm.
Der aktuelle Fall ist nur einer von offensichtlich nicht zufälligen Verstößen des "Tagesjournals". So ist der neue Fall bereits der dritte offensichtliche Verstoß gegen die Kennzeichnung von Werbung, den allein das Hanse Digital Magazin HANSEVALLEY feststellen musste und der zuständigen Medienanstalt Hamburg/Schleswig-Holstein gemeldet hat. Aus gut unterrichteten Kreisen erfuhr HANSEVALLEY, dass der Herausgeber Mathias Adler zuvor bereits mehrfach von der Aufsichtsbehörde berechtigt abgemahnt wurde.
Das seit 2014 für Hamburg wochentags herausgegebene "Tagesjournal" wird nach eigenen Angaben u. a. regelmäßig von Hamburgs SPD-Bürgermeister Peter Tschentscher gelesen. Der Online-Newsletter wird zusammen mit den lokalen Online-Medien "Business on" und "Hamburg schnackt" vermarktet. Der Newsletter finanziert sich durch Textanzeigen u. a. öffentlicher Anzeigenkunden aus Kreisen des rot-grünen Hamburger Senats. Zu den Kunden zählt auch die Wirtschaftsförderung "Hamburg Invest" als Autor der verlinkten Werbung auf "Deutsche Startups".
-
Burda-Vorstand kritisiert RTL für „Kahlschlag“ bei Gruner + Jahr und fordert Subventionen für Verlage.
 |
Das traditionelle Verlagshaus am Hamburger Baumwall wird zerschlagen.
Foto: G+J |
Hamburg, 23.02.2023: Der Vorstand deutschen Medienmarken beim Münchener Zeitschriften-Verlag "Hubert Burda Media" - Philipp Welte - hat sich kritisch zum Aus für 23 Zeitschriften am Hamburger Standort von "Gruner + Jahr" durch den neuen Eigentümer "RTL Deutschland" geäußert. „Magazine einstellen zu müssen, ist Teil unseres Geschäftes. Aber das ist ein Kahlschlag, den es so noch nie gegeben hat“, sagte der Welte in der aktuellen Ausgabe der Wochenzeitung "Die Zeit".
„Ein wichtiger Teil des publizistischen Angebots in Deutschland wird verschwinden. Das schmerzt,“ so der langjährige Tageszeitungs- und Fernsehjournalist. Viele der betroffenen Zeitschriften, die ehemals zu "Gruner + Jahr" gehörten, waren Konkurrenten von "Burda"-Titeln. „Das fühlt sich an, als würde man für ein Fußballspiel ins Stadion einlaufen, aber die gegnerische Mannschaft verlässt die Arena gerade durch die Hintertür“, so Welte. „Jetzt ist da plötzlich niemand mehr.“
Welte, der zugleich Vorstandsvorsitzender des Medienverbands der freien Presse ist, sorgt sich vor allem um viele kleine und mittelständische Verlage: „Es ist eine harte Zeit, und wenn die Rahmenbedingungen so bleiben, kann bis zu einem Drittel der Magazine in den kommenden Jahren die Luft ausgehen.“ Die Branche investiere seit drei Jahrzehnten in die digitale Transformation.
Aber „viele Verlage erreichen durch die rasche Folge von Krisen die Grenzen ihrer wirtschaftlichen Kräfte.“ Im Gegensatz zu den Verlagen seien die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF ein „überdüngtes, bürokratisches System“. Welte fordert staatliche Hilfen für Verlage, die sich an der Auflage orientieren: „Wenn der Staat aber ein Interesse daran hat, die einzigartige Vielfalt unserer Presselandschaft auch in der digitalen Welt zu erhalten, dann sollte er sich Fördermöglichkeiten überlegen, um Verlage in ihrer Transformation zu unterstützen.“
Nach dem Bertelsmann-internen Verkauf des Hamburger Zeitschriften-Verlags "Gruner + Jahr" an das Schwesterunternehmen "RTL Deutschland" im August '22, hatte Bertelsmann-Vorstand Thomas Rabe im Februar '23 bekannt gegeben, dass allein bei "G+J" von insgesamt 1.900 Arbeitsplätzen 700 Jobs wegfallen werden, 200 davon durch den Verkauf von Titeln, die anderen 500 Arbeitsplätze sollen gestrichen werden.
Neben den 700 Stellenreduzierungen bei "G+J" trifft auch "RTL Deutschland" ein Stellenabbau. So sollen in den kommenden drei Jahren jeweils 100 Arbeitsplätze wegfallen, allerdings ohne Entlassungen. 23 Printtitel sollen in Hamburg eingestellt werden, weitere 23 an andere Verlage verkauft werden. RTL will u. a. die Titel "11 Freunde", "Art", "Beef", "Business Punk", "Essen und Trinken", "Flow" und die "P.M."-Ableger verkaufen.
Im Konzern verbleiben "Brigitte", "Capital", "Couch", "Gala“, "Häuser", "Schöner Wohnen", "Stern" und "Stern Crime". Der "Stern" könnte mit der TV-Redaktion in Köln zusammengelegt und im Rahmen eines gemeinsamen Newsrooms fortgeführt werden. Die bekannten Titel "Barbara", "Brigitte Woman", "Brigitte Mom", "Eltern", "Guido" und die "Stern"-Ableger "View" und "Gesund leben" sowie sämtliche "Geo"-Ableger werden eingestellt.
-
LKA Hamburg hat verfassungswidrig unschuldige Bürger ausspionieren können.
 |
Das höchste deutsche Gericht hat die Schnüffelattacken des LKA Hamburg gestoppt.
Foto: Flickr, Lizenz, CC BY-SA 2.0 |
Karlsruhe, 17.02.2023: Das Landeskriminalamt der Hamburger Innenbehörde in Verantwortung des mehrfach umstrittenen SPD-Innensenators Andy Grote ist - wie das Land Hessen - vom Bundesverfassungsgericht in die Schranken gewiesen worden. Danach darf das LKA die Datenanalysesoftware "Gotham" des US-Unternehmens "Palantir" nicht weiter beliebig zur Identifikation möglicher Straftäter einsetzen.
Konkret erklärte der erste Senat des BVG in Karlsruhe den Paragrafen 49 Abs. 1 Alt. 1 des Hamburgischen Gesetzes über die Datenverarbeitung der Polizei (HmbPolDVG) für verfassungswidrig. Damit darf die Grote-Behörde Daten aus unterschiedlichen Quellen nicht mehr wahllos ohne konkreten Verdacht zusammenführen und beliebig auswerten.
Die in Hamburg wie Hessen verfassungswidrige Nutzung von personenbezogenen Daten verstößt nach Urteil der Richter gegen die informelle Selbstbestimmung jedes Deutschen. Diese sind Teil des allgemeinen Persönlichkeitsrechts - verankert im Grundgesetz. Die Richter kritisieren, dass die ausgewerteten Daten kaum begrenzt wurden. Heißt: Es wurde praktisch alles zusammengeführt und abgeglichen, was möglich war. Damit ist der entsprechende Paragraph im Hamburgischen Poizeidatenverarbeitungsgesetz nichtig.
Der stellv. FDP-Landesvorsitzende Prof. Andreas Moring erklärte: „Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts bestätigt leider ein weiteres Mal, was wir schon vorher wussten. Die Verbrechensbekämpfung ist in Hamburg noch nicht im digitalen Zeitalter angekommen. Der Senat hat den Schutz vor Cyberkriminalität völlig verschlafen und jetzt zeigt sich auch noch, dass es der Innenbehörde an Sensibilität im Umgang mit dem Datenschutz fehlt."
Der innenpolitische Sprecher der Linken in der Hamburger Bürgerschaft - Deniz Celik - brachte auf den Punkt: “Bereits während des Gesetzgebungsprozesses wurde auf die Unvereinbarkeit der Regelung zur automatisierten Datenverarbeitung mit dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung hingewiesen. Der rot-grüne Senat hat trotzdem sehenden Auges diese grundrechtsfeindliche Regelung durchgesetzt und trägt jetzt die politische Verantwortung für die Klatsche vom Verfassungsgericht.”
Zum Innensenator und seiner das Urteil aktuell totschweigenden Innenbehörde betonte der Wissenschaftler Moring: "Senator Grote braucht dringend eine Digitalstrategie bei der Kriminalitätsbekämpfung. Dazu gehört auf der einen Seite eine zeitgemäße Ausstattung der Polizei und auf der anderen ein sorgfältiger Umgang mit den Daten der Bürger.“
Celik wurde noch deutlicher: “Nun müssen alle Regelungen auf den Prüfstand. Hamburg braucht ein freiheitlich orientiertes und grundrechtsfreundliches Polizeigesetz. Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts sollte daher Anlass für eine grundlegende Evaluation und eine Überwindung des repressiven Polizeirechts in Hamburg sein.”
Die Gesellschaft für Freiheitsrechte (GFF) hatte die Überprüfung in Karlsruhe juristisch angestoßen. Einen ausführlichen Überblick zur Entscheidung gibt es u. a. bei den Kollegen des "Spiegel". -
Immer wieder gefeiertes Hamburger-Ticket-System "Check-in/Be-out" kommt mit vollen fünf Jahren Verspätung zu den HVV-Kunden.
 |
Sieben Jahre brauchte die Hochbahn für die neue, automatische Fahrkarten-Funktion.
Foto: Hochbahn |
Hamburg, 08.02.2023: Mit einer Verspätung von vollen fünf Jahren seit dem geplanten Starttermin im Jahr 2018 haben der Hamburger Verkehrs-Verbund und die technisch verantwortliche Hamburger Hochbahn AG die Nutzung der Ticket-Funktion "Check-in/Be-out" für die lokale und regionale Nutzung von Bussen und Bahnen im HVV-Gebiet freigeschaltet. Zunächst müssen interessierte Nutzer jedoch die eigens entwickelte Mobile App "HVV Any" für Android oder iOS herunterladen und sich dort mit einem HVV-Konto einloggen, um das schnelle und einfache Nutzen von Bussen und Bahnen in Hamburg und der Umgebung ausprobieren zu können.
Bei "Check-in/Be-out" wurden die Eingangsbereiche aller Busse und Bahnen mit Sensoren ausgestattet. Nachdem sich die Kunden einmal mit der nun zwingend notwendigen "HVV Any"-App eingecheckt haben, registriert das Smartphone alle genutzten Busse und Bahnen innerhalb von 24 Stunden. Am nächsten Tag stellt der "HVV" eine Rechnung aus, die alle Fahrten zum günstigsten Tagespreis abrechnet. Nicht bekannt ist, ob wie bei anderen elektronischen Tickets des HVV per App ebenfalls 3 % Rabatt abgezogen werden.
Das Ticketsystem kann ab sofort fast im gesamten Hamburger Verkehrsverbund über die drei Bundesländer Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein, in insgesamt sieben Landkreisen und bei knapp 30 beteiligten Bus- und Bahnunternehmen genutzt werden. Neben allen Stadt- und Überlandbussen von Hochbahn und VHH, den U- und S-Bahnen in Hamburg und im Umland kann "Any" auch in allen Zügen von AKN und Nordbahn und von DB Regio und Metronom sowie auf den HADAG-Fähren im Hamburger Hafen benutzt werden.
Das als "ITS-Ankerprojekt" hochgejubelte Fahrgast-Registrierungssystem auf Beacon-Basis hat einen unbekannten Millionen-Betrag verschlungen - u. a. im Rahmen des im Umfeld des internationalen Transport-Kongresse "ITS" vom Bund mit 21 Mio. € geförderten "RealLabHH". Die für die Umsetzung verantwortliche Hochbahn verweigert bis heute die Auskunft über die Kosten des Millionen-Grabs um das bereits vor sieben Jahren vom damals neuen Hochbahn-Chef Henrik Falk ausgerufene Großprojekt.
Das ticketlose Fahren im "HVV" hatte der damals neue "Hochbahn"-Chef Henrik Falk 2016 als Zukunftsziel ausgegeben. Die neue "HVV"-Geschäftsführerin Anna-Theresa Korbutt nannte das verspätete Vorzeigeprojekt unter Leitung der "Hochbahn" bei Vorstellung des neuen "HVV-Logos" Anfang Oktober '21 eine "Revolution im Markt". International nutzen führende Millionenmetropolen wie Amsterdam, Stockholm oder Hong Kong bereits seit Jahren funktionierende Systeme nach dem Prinzip "Check-in/Be-out".
-
Flixbus spielt nach weiterem Zwischenfall mit polnischem Linienbus toter Käfer.
 |
Mit Totschweigen versucht das Flix-Management den Kopf aus der Schlinge zu kriegen.
Foto: Flix SE |
Hamburg/München, 01.02.2023: Der führende deutsche Linienbus-Anbieter "Flixbus" nimmt anscheinend beschädigte und damit gefährliche Reisebusse auf seinen Linien u. a. zwischen Berlin und Hamburg in Kauf. Nach dem schweren Unfall mit einem polnischen Reisebus auf der A24 zwischen den Anschlussstellen Wöbellin und Hagenow mit 18 Verletzen am 29.12.2022 musste ein Redakteur von HANSEVALLEY einen weiteren Zwischenfall erleben.
Am Mittwoch, den 18. Januar '23 verunglückte erneut ein polnischer Reisebus von "Flixbus" - dieses Mal auf der Nachtbus-Linie N1360 von Bremen über Hamburg nach Berlin und weiter nach Katowice und Krakow. Der Bus musste keine Stunde nach Abfahrt in Hamburg wegen eines Motorschadens auf der Raststätte Gudow-Süd in MV stoppen. Eine Stunde lang reparierten die beiden Auftragsfahrer den Schaden am voll besetzten Reisebus.
Auf Nachfrage zu den offenbar wiederholten Mängeln an polnischen Linienbussen im Auftrag von "Flixbus" reagierte die Münchener Zentrale des Bus- und Bahnanbieters mit Totschweigen: Sowohl der zuständige Kundendienst, als auch die Pressestelle der "Flix SE" sind anscheinend der Meinung, den Fall unter den Tisch kehren zu können, indem sie jegliche Stellungnahme gegenüber der Öffentlichkeit verweigern.
"Flixbus" sieht sich mit seiner Münchener Holding "Flix SE" lediglich als Vermittler von Fahrten und weist jegliche Verantwortung für Personen-/Schäden auf seinen Linien ab. Grund: Die Fahrten werden von selbstständigen Busbetrieben im Auftrag der jeweiligen Landesgesellschaften, z. B. "Flixbus DACH" in Berlin oder "Flixbus Poland" in Warschau durchgeführt. Offensichtlich kontrolliert die Zentrale die Busse ihrer Auftragnehmer nicht und riskiert damit womöglich auch Menschenleben. "Flix" betreibt selbst lediglich einen einzelnen Reisbus als Alibi.
Auf Grund des Zwischenfalls in Zusammenhang mit dem schweren Unfall auf der A24 kurz vor dem Jahreswechsel unterrichtet HANSEVALLEY die zuständige Ermittlungsbehörde der Polizeidirektion Ludwigslust sowie die Aufsichtsbehörde für den Fernbusverkehr, das Eisenbahn-Bundesamt in Bonn. Sollte "Flix" weiterhin jegliche Stellungnahme verweigern, informiert HANSEVALLEY die Gesellschafter der "Flix SE".
-
Tödlicher Bahnunfall von Allermöhle löst Debatte über Tiktok-Mutproben aus.
 |
Social Media werden für Jugendliche häufig zu einer digitalen Parallelwelt.
Grafik: Gerd Altmann, Pixabay |
Hamburg: Die Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank fordert eine gesellschaftliche Auseinandersetzung mit den lebensbedrohlichen Folgen jugendlicher Challenges auf dem chinesischen Videonetzwerk "Tiktok". Kritische Entwicklungen auf dem Social-Media-Netzwerk, wie "PainTok" und "SadTok", bei denen Jugendliche Videos über Depressionen, Selbstverletzungen und Suizidversuche posten, können psychische Erkrankungen und ein gestörtes Selbstwertgefühl befördern, so die Spitzenpolitikerin.
Anlass ist der tödliche Unfall auf den Bahngleisen am vergangenen Dienstag rd. 250 Meter vor dem S-Bahnhof Allermöhle. Dabei verunglückten zwei 18-jährige Zwillingsschwestern, eine von ihnen verstarb, die zweite liegt mit lebensbedrohlichen Verletzungen im Krankenhaus. Die Geschwister waren gegen 19.30 Uhr von einem heranfahrenden Regionalexpress erfasst worden. Hinweise deuten darauf hin, dass die beiden Mädchen auf den Gleisen ein Mutprobevideo für "Tiktok" produzieren wollten.
In einem Gespräch mit dem Hamburger Abendblatt sagte die Wissenschaftssenatorin: "Das, was den Mädchen passiert ist, ist sehr traurig und erschreckend. Es sollte uns aufrütteln - auch mit Blick auf die Nutzung von Social Media." Die Grüne Spitzenpolitikerin weiter: "Dass der Megatrend der Challenges Jugendlichen das Leben kostet, ist eine dramatische Entwicklung, die die EU erkannt hat."
Die beiden Opfer des Bahn-Unfalls waren nach Informationen der "Mopo" polizeibekannt. Danach wurden die Bergedorferinnen bereits mehrfach von der Bundespolizei auf Bahngleisen entdeckt und wegen "gefährlichem Eingriffs in den Bahnverkehr" angezeigt worden. Laut "Mopo" sollen Sie zudem bereits auf dem Puffer eines Triebwagens gefahren sein und Fotos sowie Videos zu ihren Mutproben im Social Web veröffentlicht haben.
Ein Bahnsprecher erklärte aus Anlass des tödlichen Unglücks in Neuallermöhle: "Der Aufenthalt im Gleisbereich ist verboten und lebensgefährlich." Die Bahn versucht seit längerem mit Aufklärungsvideos, auf die Gefahren hinzuweisen. Die Bundespolizei warnte ausdrücklich davor, Gleise als Fotomotiv zu benutzen. Ein Sprecher brachte auf den Punkt: "Gleise sind kein Fotostudio."
Katharina Fegebank machte zu den Hintergründen deutlich: "Die einen werden krank, die anderen verdienen damit Millionen. Wir müssen darüber reden, wie es den Kindern geht, die sich in Social Media verlieren, welche Fähigkeiten sie nicht erlernen, wenn sich ihr Leben in eine digitale Parallelwelt verlagert und wie es den Eltern geht, die diesen Kampf nicht gewinnen können."
Die Grüne Politikerin zusammenfassend: "Wenn Konzerne unsere Kinder und Jugendlichen nicht besser schützen wollen und Eltern es nur bedingt können, dann muss die Politik eingreifen." Dabei sieht die Politikerin sowohl die Vermittlung von Medienkompetenz z. B. in Schulen als auch die Durchsetzung von Sanktionen gegen die verantwortlichen Social-Media-Plattformen als sinnvolle Maßnahmen.
Die EU-Kommission hat nach mehreren z. T. tödlichen Vorfällen bei "Blackout-Challenges" in Italien (2021) und Schottland (2022) gegen "Tiktok" weitreichende Konsequenzen angekündigt. EU-Kommissar Thierry Breton sagte am vergangenen Donnerstag: "Es ist nicht hinnehmbar, dass Nutzer hinter scheinbar lustigen und harmlosen Funktionen in Sekundenschnelle auf schädliche und manchmal sogar lebensbedrohliche Inhalte zugreifen können."
-
CDU deckt massiven Personalmangel in der IT-Sicherheit der gehackten HAW Hamburg auf.
 |
Hinter den Kulissen fehlt der HAW Hamburg massiv Personal in der IT.
Foto: HAW Hamburg |
Hamburg, 23.01.2023: Die CDU-Fraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft kritisiert nach der massiven Hackerattacke auf die HAW Hamburg die grün geführte Wissenschaftsbehörde der Hansestadt für die erhebliche Unterversorgung der HAW-IT-Abteilung. Eine kleine Anfrage der Fraktion an die Behörde brachte zu Tage, dass der IT-Betrieb auch fast einen Monat nach der Attacke weitgehend gestört ist.
Aktuell arbeiten rd. 40 Mitarbeiter in der IT-Abteilung der Hamburger Hochschule. Acht Stellen und damit gut 20 % sind nicht besetzt - trotz mehrfacher Überlastungsanzeigen nach einem bereits 2018 festgestellten Personalmangel im IT-Service-Center. Zudem ist der Krankenstand in der IT von 560 Fehltagen in 2021 auf 866 Tage im vergangenen Jahr um fast 50 % angewachsen.
Die für die lebensnotwendige IT-Systemsadministration vorgesehene Personalstelle ist laut aktueller Aufstellung der Behörde nicht besetzt. Ebenso fehlt ein Mitarbeiter im Identity Management für die Zugangsberechtigungen. Für die Administration des Campusmanagementsystems fehlen gleich zwei Mitarbeiter. Für die Netzwerksicherheit steht lediglich eine einzelne Person zur Verfügung.
Anke Frieling, wissenschaftspolitische Sprecherin der CDU-Fraktion erklärte nach einer kleinen Anfrage an den rot-grünen Senat: „Die HAW Hamburg bekommt den Hackerangriff nicht unter Kontrolle. Wichtige Daten wurden geraubt und viele Dienste sind auch weiterhin nicht nutzbar. Das für die Krisenbewältigung zuständige IT-Department der HAW ist laut meiner Anfrage überlastet. So sind derzeit acht Stellen unbesetzt und der Krankenstand des IT-Service Center ist stark angestiegen."
Die CDU-Landespolitikerin weiter: "Studierende sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehen sich einer sehr schwierigen Lage ausgesetzt. An ein reibungsloses Studium und Arbeiten ist derzeit nicht zu denken. Die jahrelange Vernachlässigung des Themas Cybersecurity der grünen Wissenschaftsbehörde rächt sich nun in drastischer Weise.“
Die Hochschule für Angewandte Wissenschaften wurde kurz vor dem Jahreswechsel Opfer eines weitgehenden Hackerangriffs mit verschiedener Malware. Dabei wurden wichtige Daten verschlüsselt und versucht, Lösegeld zu erpressen. Laut aktuellen Angaben sind die Noten der vergangenen zwei Semester nicht mehr verfügbar.
Am 29. Dezember '22 wurde die IT-Infrastruktur bis in die Kernsysteme einschl. Administratorenrechte und Speichersysteme attackiert. Betroffen sind alle 18 Departments an den vier Standorten der Hochschule am Berliner Tor, in der Finkenau, in der Armgartstraße nahe der Mundsburg sowie in Bergedorf.
Die HAW Hamburg muss ihr zentrales Identitätsmanagement für alle IT-Nutzer, das Kommunikationssystem "MS Teams" und die zentrale Schließanlagen-Steuerung neu aufsetzen. In der Folge mussten Online-Vorlesungen abgesagt, Fristen für Abschlussarbeiten und Semesterbewerbungen verschoben und alle E-Mail-Konten neu aufǵesetzt werden.
Die HAW Hamburg ist mit fast 17.000 Studenten in 37 Bachelor- und 35 Master-Studiengängen eine der größten Hochschulen Norddeutschlands und liegt bundesweit auf Platz 8 der größten Fachhochschulen. Zwei Krisenstäbe der HAW und der Stadt arbeiten die Hintergründe des Hackerangriffs auf. Der IT-Dienstleister "Bechtle" kümmert sich um die forensische Analyse des Angriffs, ebenso wie "CERT Nord" und "Dataport".
Die Antwort der Fegebank-Behörde zum IT-Chaos an der HAW Hamburg kann hier nachgelesen werden. -
Hamburger Senat feiert sich für vermeintlich innovative Fintech-Förderung.
 |
Nimmt es mit Fördermitteln nicht immer ganz so genau: SPD-Finanzsenator Dressel.
Foto: Senatskanzlei Hamburg |
Hamburg, 29.12.2022: Der rot-grüne Senat der Hansestadt hat eine Erfolgsbilanz zu dem von ihm selbst aufgelegten Fintech-Förderprogramm "InnoFinTech" gezogen. Danach wurden mit den seit Mitte März d. J. zur Verfügung stehenden 2,5 Mio. € aus Corona-Hilfsgeldern insgesamt 16 Jungunternehmen mit jeweils bis zu 200.000,- € unterstützt. Dabei erstattet das gemeinsam mit der Förderbank IFB und dem Branchencluster "Finanzwirtschaft Hamburg" eingerichtete Förderprogramm bis zu 90 % laufender Kosten.
Das vermeintliche Innovationsprogramm ist so aufgesetzt, dass praktisch jedes Startup fast alle Kosten absetzen kann - und damit eine hohe Wahrscheinlichkeit zur Bewilligung der Steuermittel besteht. Darunter fallen Personalkosten, Mieten, Reisekosten, Marketing, IT-Aufwendungen, Materialkosten, Anschaffungen und sogar Leasingbeiträge. Offensichtlich konnte der Senat nur so das Ziel erreichen, die 2,5 Mio. € eingeplanter Mittel weitgehend auch loszuwerden.
Der Senat verschwieg in der Mitteilung, ob es sich bei den 16 geförderten Startups tatsächlich vollständig um Fintechs und Proptechs handelt, die dem Finanzstandort Hamburg zugutekommen, oder ob die IFB-Tochtergesellschaft "Innovationsstarter" auch andere Startups außerhalb der Fintech-Branche mit Kapital versorgt hat. Die Förderrichtlinie spricht in diesem Zusammenhang von "angrenzenden Segmenten", die ebenfalls Steuergelder beantragen können.
Zudem wurde nicht mitgeteilt, ob die unterstützten Firmen in der Start- oder Wachstumsphase nicht auch ohne "InnoFinTech" Mittel aus anderen Hamburger Förderprogrammen bekommen hätten. Die Finanzbehörde spricht zudem von drei jungen Unternehmen, die im Rahmen des Programms in Hamburg angesiedelt werden konnten. Offen bleibt, ob es sich dabei - wie ursprünglich angekündigt - vor allem um Ansiedlungen aus dem Ausland handelt, oder nur Startups aus dem Umland nach Hamburg gelockt wurden.
"InnoFinTech" wurde als Ersatzmaßnahme für den gescheiterten Versuch der Neun-Millionen-Euro-Schieberei von SPD-Finanzsenator Andreas Dressel zugunsten seines Parteifreundes Nico Lumma eingerichtet. Die Mittel stammen aus einem Haushaltstitel der Finanzbehörde zur Unterstützung von Unternehmen in der Corona-Krise. Sie müssen im Rahmen des Doppelhaushaltes 2021/2022 bis zum Jahresende ausgegeben sein.
Hintergrund: Im Oktober 2021 verabschiedeten die Finanzbehörde, die Handelskammer und der Branchenverband "Finanzplatz Hamburg" einen gemeinsamen "Masterplan" zur weiteren Entwicklung des Finanzstandortes Hamburg. Dazu sollte mit insgesamt 9 Mio. € ein "Fintech-Accelerator" zur Förderung und Ansiedlung junger Unternehmen in der Finanzindustrie organisiert werden.
Nachdem SPD-Finanzsenator Andreas Dressel versucht hatte, die Corona-Haushaltsmittel ohne öffentliche Ausschreibung dem Hamburger SPD-Funktionär Nico Lumma und seinem "Next Media Accelerator" zuzuschieben, erntete der Versuch massive öffentliche Kritik der Hamburger Oppositionsparteien CDU und Linke sowie unabhängiger Medien, wie der "Morgenpost" und HANSEVALLEY. Daraufhin zog Dressel im Januar d. J. die Reißleine und sagte die Millionen-Schieberei ab.
Die Finanzbehörde plant, das Programm zur finanziellen Förderung von Fintechs im kommenden Jahr mit weiteren 2,1 Mio. € Haushaltsmitteln fortzusetzen.
-
Bertelsmann-Flaggschiff RTL lässt Print-Tochter Gruner + Jahr weiter ausbluten.
 |
Das ehemals stolze Verlagdhaus ist nur noch ein Schatten seiner selbst.
Foto: Gruner + Jahr |
Hamburg, 28.12.2022: Der aktuelle Eigentümer des Verlagshauses "Gruner + Jahr" - der Kölner Fernsehsender "RTL" - plant offenbar einen weitgehenden Ausverkauf der traditionsreichen Zeitschriftentitel und ihrer Online-Ableger. Laut Medienbericht sind u. a. die Frauenzeitschrift "Brigitte", das Prominentenmagazin "Gala" und der naturwissenschaftliche Titel "Geo" betroffen. Der Verkauf der "G+J"-Zeitschriftentitel könnte bereits im ersten Quartal kommenden Jahres abgeschlossen werden.
Das ebenfalls am Hamburger Baumwall produzierte Nachrichtenmagazin "Stern" könnte dagegen im "Bertelsmann"-Konzern verbleiben und mit seiner Redaktion nach Köln umziehen. In der Domstadt produziert "RTL" seit April 1990 mit einer Auftrags-Redaktion das wöchentliche Reportagemagazin "Stern TV". So könnten die TV-, Online- und Printsparte des "Stern" im "RTL"-Sendezentrum in Deutz in einem zentralen Newsroom produziert und damit Kosteneinsparungen durch weniger Personal erreicht werden.
Hamburgs Mediensenator Carsten Brosda appellierte an die Konzernspitzen von "RTL" und der gemeinsamen Muttergesellschaft "Bertelsmann", nicht nur die finanziellen Aspekte in den Mittelpunkt zu stellen: „Wer Verantwortung für ein Medienhaus trägt, übernimmt damit nicht nur wirtschaftliche, sondern auch gesellschaftliche und öffentliche Verantwortung“, so der 48-jährige SPD-Medienpolitiker am Freitag gegenüber dem "NDR".
Im Gegensatz zur Erwartung eines schwachen Hamburger Verlagshauses weist "Gruner + Jahr" für das Geschäftsjahr 2021 einen Gewinn von mehr als 130 Mio. € aus. Allerdings verloren in den vergangenen Jahren durch massive Sparmaßnahmen rd. 50 % aller Mitarbeiter am Baumwall ihren Job. Es verdichtet sich die Annahme, dass sich "Bertelsmann" rechtzeitig vor einem weiteren Absatzschwund von seinen Print-Titeln verabschieden will.
Eine ähnliche Entwicklung gab es bereits bei "Axel Springer". Im Mai 2014 verkaufte der nach Berlin umgezogene Medienkonzern seine regionalen Tageszeitungen, wie das "Hamburger Abendblatt" und seine Zeitschriftentitel, wie die in Hamburg produzierte "Hörzu", an die Essener "Funke Mediengruppe". Bereits im März 2008 wechselte die "Bild"-Redaktion mit mehr als 400 Mitarbeitern und 120 Umzugs-Lastern aus Hamburg ins Berliner Zeitungsviertel.
Der Medienstandort Hamburg blutet seit mehr als 20 Jahren aus: Den Auftakt machte 2002 "Universal Music". Der Berliner Senat warb den in Hamburg beheimateten Musikverlag ab. "Universal" siedelte sich in der neuen Gewerbemeile "Media Spree" unweit von "MTV Deutschland" und "Sat.1 Frühstücksfernsehen" an. Im Mai 2006 eröffnete der "Spiegel" sein neues Hauptstadtbüro am Pariser Platz - nur wenige Gehminuten von Kanzleramt und Reichstag entfernt. Die Berliner Redaktion ist verantwortlich für die Politikberichterstattung im Nachrichtenmagazin.
2009 wurde die ehemalige SPD-Zeitung "Mopo" an die Kölner "Dumont"-Gruppe verkauft - eine langjährige Talfahrt mit wechselnden Eigentümern begann. Im September 2010 folgte der "Dpa"-Newsroom mit 180 Hamburger Mitarbeitern dem Ruf des Berliner Regierungsviertels, zog in die neue "Axel-Springer-Passage" unweit von "TAZ" und "Le Monde".
Hamburg hat so gut wie alle tagesaktuellen Redaktionen verloren. Geblieben sind "ARD-Aktuell" mit "Tagesschau" und "Tagesthemen", die Wochenzeitung "Zeit" sowie die Zeitschriftenverlage, wie "Bauer, Jahreszeiten-Verlag und Gruner + Jahr".
Die 2014 durch den SPD-Medienbeamten Jens Unrau neu aufgestellte Förderinitiative "Nextmedia Hamburg", seit 2018 unter dem Dach der städtischen Kreativgesellschaft", schaffte es in den vergangenen acht Jahren trotz Millionen schwerer Subventionen nicht, in größerem Umfang neue Geschäftsmodelle für den Medienstandort Hamburg zu etablieren. "Nextmedia Hamburg" beschränkt sich in seinen mit Steuergeldern finanzierten Aktivitäten auf Umfragen, Netzwerktreffen und einen Startup-Inkabator.
Die "Süddeutsche Zeitung" hatte über den Ausverkauf zuerst berichtet und beruft sich auf "Käuferkreise", die nicht näher genannt werden.
-
Hamburger Container-Verlader HHLA beerdigt belächeltes Hyperloop-Projekt.
 |
So sollte der "Hyperport" im Hamburger Hafen einmal aussehen.
Grafik: HHLA |
Hamburg, 27.12.2022: Der Hamburger Container-Terminal-Betreiber "HHLA" hat sein vermeintliches Zukunftsprojekt für eine "Hyperloop"-Magnetschwebebahn im Hamburger Hafen endgültig beerdigt. Das Röhren-Transportsystem sollte nach ursprünglicher Idee mit einem eigenen Container-Verladebahnhof namens "Hyperport" am Terminal in Altenwerder Übersee-Container durch den Hamburger Hafen transportieren.
Um möglichst wenig Aufmerksamkeit auf das Einstampfen des am 15. November 2018 mit großem PR-Brimborium durch die "HHLA" präsentierten Projekts zu erregen, steckte die Pressestelle des Container-Verladers die schlechte Nachricht einer Hamburger Zeitung pünktlich zum Ferienbeginn und den Weihnachtsfeiertagen zu. Laut des kalifornischen Projektentwicklers "HTT" soll das "Hyperport"-System mittlerweile sogar marktreif sein.
Laut theoretischer Hochrechnungen sollten bis zu 2.800 Übersee-Container an einem Tag über das "Hyperloop"-System und den eigenen Verladebahnhof abtransportiert werden können. Je Transportkapsel sollten ein 40-Zoll- oder zwei 20-Zoll-Container per "Rohrpost" auf die Reise gehen. Das Projekt wurde von vielen Kennern des Hamburger Hafens von Anfang an belächelt und als unrealistisch beurteilt.
Statt der zum internationalen Transport-Kongresses "ITS" im Oktober 2021 geplanten Eröffnung des "Hyperports" in Altenwerder stellte die "HHLA" lediglich ein Modell auf der Messe aus. Noch vor dem Fachkongress im "CCH" brachte ein kommerzielles Konzept in 2021 auf den Punkt: für die im Durchmesser fünf Meter großen "Hyperloop"-Röhren ist der Hamburger Hafen zu eng und damit nicht geeignet.
Der städtische Hafenkonzern hat das "Hyperloop"-Konzept mittlerweile komplett eingestellt. Die zuständige Projektleiterin ist in Rente gegangen. Von der Idee, den Gütertransport per Container mit bis zu 600 km/h durch Vakuumröhren zu organisieren, ist lediglich das "HHLA"-Logo mit blauem Tor und dem umstrittenen Werbespruch "Das Tor zur Zukunft" übrig geblieben.
Laut Medienbericht geht der städtische Terminal-Betreiber mit den Ergebnissen seiner technischen Analyse auf Werbetour, um mögliche Abnehmer zu finden, die ein Interesse haben könnten, ihrerseits in ein "Hyperloop"-System mit "Hyperport" investieren zu wollen. In Hamburg wird dies jedoch nicht stattfinden und Hamburg mit "Hyperloop" kein "Tor zur Zukunft" mehr werden.
Weitere Informationen zum "HHLA-Hyperport"-Projekt im Hamburger Hafen sind auf der Projektseite der "Hyperport"-Entwicklungsgesellschaft "HTT" nachzulesen. -
Hamburger Barclays Bank terrorisiert Kreditkarten-Kunden mit täglichen Zwangs-SMS.
 |
Außen "hui", innen kundenfeindlich unterwegs: Barclays in Hamburg.
Foto: Barclays |
Hamburg, 23.12.2022: Der deutsche Ableger der britischen "Barclay Bank" terrorisiert Kreditkartenkunden ohne nachweisbaren Grund mit regelmäßigen SMS, sich umgehend mit dem Kundendienst in Verbindung zu setzen. Dabei behauptet die Kurznachricht unwahr, dass die Bank versucht hätte, den Kunden telefonisch zu erreichen. Bei einem Rückruf im Service der Hamburger Niederlassung stellt sich wiederholt heraus, dass es keinen konkreten Anlass für die SMS gab. Der HANSEVALLEY vorliegende Fall beweist "Terror-SMS" von "Barclays" u. a. am 22.04.21, 26.04.21, 03.05.21, 04.05.21, 12.05.21, 02.06.21, 16.06.21, 25.06.21 und 16.07.21.
"Barclays" begründet die z. T. im Tages- und Wochentakt verschickten Aufforderungen zur Kontaktaufnahme mit dem berechtigten Interesse seines Mahnwesens, da der Kunde im Zahlungsverzug sei. Die Tatsachen zeigen, dass "Barclays" die SMS verschickt hat, obwohl der Kunde mit seinen Konten nicht im Hintertreffen war und regelmäßig pünktlich die monatlichen Raten abbuchen ließ. Die Falschaussage der 2021 noch unter dem Namen "Barclaycard" firmierende Bank wurde sogar schriftlich gegenüber der Bundesanstalt für Finanzaufsicht (BaFin) abgegeben.
Kreditkartenkunden, die sich an das Beschwerdemanagement der Bank wenden, bekommen auf Ihre Einschreiben entweder gar keine Antwort, oder die Rückmeldung dauert bis zu drei Monaten. Ein Entzug der Erlaubnis, über die angegebene Handy-Nr. SMS zu senden, führt zwangsweise zu einem Ende des Geschäftsverhältnisses. Grund: Die Kreditkarten- und Dispokonten werden online geführt. Für einen Zugriff ist die Bestätigung der Nutzeridentität via Smartphone erforderlich. Damit erzwingt "Barclays", die Handy-Nr. genannt zu bekommen.
Gestatten "Barclays"-Kunden die Nutzung der eigenen Handy-Nr. ausschließlich für das Konto-Login, missbraucht "Barclays" die Telefon-Nr. dennoch rechtswidrig für den erneuten, regelmäßigen Versand ihrer "Terror-SMS".
Die zuständigen Beamten der Abteilung Verbraucherschutz in der wegen Untätigkeit bereits massiv in die Schlagzeilen geratenen Bundesanstalt für Finanzaufsicht (BaFin) wiegeln die berechtigte Beschwerde des Barclays-Kunden nach 1,5 Jahren Bearbeitungszeit mehrfach nacheinander ab:
- Sie verweisen auf die DSGVO, nach dem die wiederholte Nutzung der privaten Handy-Nr. durch "Barclays" im Mahnwesen Vorrang habe von dem persönlichen Datenschutz.
- Für einen möglichen Verstoß gegen die Datenschutz-Grundverordnung durch die irische Niederlassung von "Barclays" erklären Sie ausschließlich den zuständigen Hamburger Datenschutzbeauftragen für verantwortlich.
- Die Tatsache des jahrelangen "SMS-Terrors" gegenüber einem nicht im Zahlungsverzug stehenden Kreditkartenkunden lassen sie nicht gelten und schlagen sich auf die Seite des "Barclays"-Beschwerdemanagements. Hier stehe Aussage gegen Aussage.
- Um nicht tätig werden zu müssen, deklassieren die vermeintlichen Verbraucherschützer das Verhalten von "Barclays" zu einem Einzelfall und verweisen juristisch auf ihren ausschließlichen "Schutz von kollektiven Verbraucherinteressen".
- Den Umstand, dass Barclays Kreditkartenkunden über Jahre systematisch über zwangsweise nutzbare Handynummern mit SMS terrorisiert, ignorieren die Beamten der Bonner Aufsichtsbehörde.
- Gemeldete Einzelfälle werden laut des aktuellen Schreibens der BaFin grundsätzlich nicht berücksichtigt. Nur wenn Banken und Versicherungen kollektiv regelmäßig Kunden schädigen, wird die BaFin überhaupt tätig.
Eine Beschwerde gegenüber dem Hamburgischen Datenschutzbeauftragten bereits im Sommer 2021 blieb ebenfalls erfolglos. Obwohl der Datenschutzmissbrauch gegen den Kreditkartenkunden im Juli '21 mit konkreten Daten unterlegt wurde, hielt es die Hamburger Behörde nicht für nötig, tätig zu werden. Stattdessen behauptete sie, die erste Beschwerde des Kunden ggü. "Barclays" vom 01.03.2021, keine "Terror-SMS" mehr zu versenden, hielt die Datenschutz-Behörde nicht für eine verbindliche Aufforderung zur Einstellung des angreifbaren Verhaltens.Der "Barclays"-Kunde prüft nun die juristische Klärung einschl. dienstrechtlicher Schritte gegen den untätigen Hamburger Datenschutzbeauftragten und die Verbraucherschutz-Abteilung der BaFin in Bonn.
-
Check24 riskiert mit Paypal's automatischem Einzugsverfahren die Zahlungsunfähigkeit von Kunden.
 |
Lassen sich die Check 24-Werbefamilien auch automatisch "abzocken"?
Foto: Check24 |
Berlin/München, 21.12.2022: Das Vergleichsportal "Check 24" bedient sich bei Buchungen von Pauschalreisen, Flügen, Hotelzimmern, Ferienwohnungen, Autoanmietungen und anderen Einkäufen eines automatischen Einzugsverfahrens des Zahlungsdienstleisters "Paypal", sollten Kunden bereits zuvor einmal bei "Check 24" via "Paypal" bezahlt haben. Das Problem: "Check 24" holt sich mit der ersten Zahlung über "Paypal" automatisch eine Genehmigung ein, in Zukunft ohne weitere Nachfrage oder unmittelbare Änderungsmöglichkeit auf "Paypal" und die ursprüngliche Zahlungsquelle - z. B. ein Girokonto oder eine Kreditkarte - zurückzugreifen.
Damit riskiert "Check 24" mit dem automatischen Einzugsverfahren, das für wiederkehrende Zahlungen von geringen Beiträgen wie Carsharing, Mietwagen, ÖPNV-Tickets oder Streaming-Abos nützlich ist, im Falle eines Falles die Ablehnung der Zahlung und im Worst Case sogar die Zahlungsunfähigkeit des Kunden. Grund: "Check 24" löst durch die vorherige, automatisch eingeholte Genehmigung den Einzug des fälligen Betrags ein, unabhängig, ob das automatisch genutzte Girokonto oder die Kreditkarte für hunderte oder tausende von Euro gedeckt ist. Dies ist bei Urlaubs- und anderen Reisebuchungen gefährlich.
Einem HANSEVALLEY-Redakteur ist das kritische Buchungsverhalten von "Check 24" und "Paypal" bei einer Zimmerbuchung in Hamburg passiert. Besonders brisant: Trotz sofortiger Stornierung der automatischen, unkontrollierten Buchung zog "Paypal" den fälligen Betrag mehrere Tage später vom Konto ein. Die Rückzahlung dauert insgesamt bis zu 12 Tage. Dabei hatte der Zahlungsdienst mit Sitz in Kleinmachnow bei Berlin zuvor im Kundenkonto mitgeteilt, dank rechtzeitiger Buchung die Zahlung nicht einzuziehen. Hier trat der Worst Case auf Grund des unkontrollierbaren Zusammenspiels von "Check 24" und "Paypal" ein.
Das Problem: "Paypal"-Nutzern ist mit Ihrer ersten Buchung von Zahlungen häufig nicht bekannt, dass Sie eine automatische Einzugsermächtigung erteilen. "Paypal" weist weder deutlich erkennbar darauf hin, noch ist dies mit der ersten Zahlung zu verhindern. Im Falle von Abo-Buchungen für Pay-TV oder Carsharing bietet sich eine automatische Abbuchung an, für teure Reisen missbraucht "Check 24" aus Sicht der Redaktion das Verfahren, um schneller ohne jeglichen Einspruch an seine Zahlung zu kommen. Ein "Check 24"-Geschäftsführer bestätigte gegenüber HANSEVALLEY, die Bequemlichkeit für Kunden in den Mittelpunkt zu stellen.
Die Redaktion wird den Fall gegenüber der Bundesanstalt für Finanzen eskalieren und prüfen lassen. Auf Grund des mehrfach kundenfeindlichen Verhaltens warnt HANSEVALLEY explizit vor einer Genehmigung von automatisierten Zahlungen via "Paypal" - insbesondere bei hohen Beträgen, wie "Check 24"-Buchungen. Auf Grund des erheblichen finanziellen Risikos rät die Redaktion von einer Nutzung von "Check 24", insbesondere mit "Paypal" explizit ab.
-
Bremer Doc Morris-Ableger verschleppt Auslieferung von Arzneimitteln.
 |
Deutsche Apotheken-Kunden müssen unter der Gier des Schweizer Riesen "Zur Rose" leiden.
Foto: Zur Rose |
Bremen, 20.12.2022: Die Online-Apotheke "Eurapon" verweigert Internet-Kunden über mehr als eine Woche die Lieferung bestellter Arzneimittel. Das fand ein HANSEVALLEY-Redakteur bei einem HANSETECHTEST heraus. Zunächst schwieg der Online-Ableger der "Euro-Apotheke" aus dem Bremer Dobbenweg über eine Woche. Eine schriftliche Nachfrage, wann die bestellten Arzneimittel geliefert werden, brachte keine verbindliche Lösung. Im Gegensatz zu anderen Online-Apotheken gibt es bei "Eurapon" weder während der Bestellung noch mit Bestellbestätigung einen Hinweis auf Verzögerungen, z. B. auf Grund von Personal-Engpässen. Ein Anruf im Kundendienst förderte sogar eine kundenfeindliche Grundeinstellung von "Eurapon" zu Tage: Die Support-Mitarbeiterin legte einfach auf.
Auf Nachfrage bei der Pressestelle des Mutterunternehmens "Doc Morris" schien Bewegung in die Bestellung zu kommen. Eine Support-Mitarbeiterin im Second Level versuchte in einem Telefonat, die Situation zu beschwichtigen. Dabei kam mehr als eine Woche nach Bestellung heraus, dass einzelne Arzneimittel gar nicht lieferbar seien. "Eurapon" hatte weder im Bestellprozess noch mit Bestätigung der Bestellung darauf hingewiesen. Stattdessen bot "Eurapon" die Stornierung des verschleppten Auftrags an. Zudem versuchte die Agentin, die berechtigte Kritik mit vorformulierten Textbausteinen abzuwiegeln.
Anscheinend hält es der verantwortliche Bremer Apotheker Kulibay Talu nicht für nötig, seinen beruflichen Verpflichtungen nachzukommen. Die von der Support-Mitarbeiterin angekündigte Sendungs-Nr. für die restlichen Arzneimittel ist erst 10 Tage nach der Bestellung übermittelt worden, ohne konkreten Versand. Dies gilt ebenso für die Rückerstattung nicht lieferbarer Arzneimittel. Offenbar herrscht bei "Eurapon" Untergangsstimmung. Der Grund: Die Online-Apotheke wurde mit ihrer Marke und dem Bremer Arzneimittel-Versand bereits Ende 2017 vom Schweizer Apotheken-Konzern "Zur Rose" und dessen Ableger "Doc Morris" übernommen.
In der vergangenen Woche wurde der Online-Shop "eurapon.de" endgültig geschlossen, rd. 90 Mitarbeiter der Bremer Apotheke verlieren ihren Job. Dafür wurde der bisherige Eigenümer Kulibay Talu mit einem Verkaufserlös vom 46,6 Mio. € zum Multimillionär. Eine zuverlässige Belieferung der "Eurapon"-Online-Kunden scheint für Apotheker Talu, dem niederländischen Logistik-Betreiber "Doc Morris" und den Mutterkonzern "Zur Rose" hingegen weitgehend gleichgültig zu sein. Unser betroffener Redakteur hat Käuferschutz bei "Paypal" und "Trusted Shops" eröffnet und wird Beschwerde bei der bremischen Apothekerkammer einlegen.
Die Mutter des niederländischen Apotheken-Riesen "Doc Morris" - der börsennotierte Schweizer Konzern "Zur Rose" - hat in den vergangenen Jahren eine Reihe deutscher Online-Versender aufgekauft. Dazu gehören die Hamburger Online-Apotheke "Apo-Rot", die Online-Apotheke "Apotal" aus dem Osnabrücker Land, der Bremer Online-Shop "Eurapon" (alle drei im Gebiet von HANSEVALLEY), der Ludwigshafener Versender "Medplex" sowie die frühere "Schlecker"-Tochter "Vitalsana". Seit 2018 wurde die Versandlogistik für die Marken schrittweise ins niederländische Heerlen, dem Stammsitz von "Doc Morris", verlegt und die Shops größtenteils geschlossen oder die Vermarktung zentralisiert.
Am Ende will die Aktiengesellschaft "Zur Rose" in Deutschland nur noch mit ihrer Kernmarke "Doc Morris" auftreten. Die Belieferung der deutschen Kunden wird vom niederländischen Heerlen nahe der deutschen Grenze bei Aachen aus gesteuert. Die Arbeitsplätze der deutschen Online-Apotheken gehen durch die Praxis, Versandlogistik und Marken aufzukaufen, weitgehend verloren. Die börsennotierte "Zur Rose"-Gruppe hatte zuletzt deutliche Gewinnprobleme. Der Börsenkurs ist im laufenden Jahr von rd. 240 CHF auf nur noch rd. 26 CHF abgestürzt.
Mit der Konzentration auf wenige Kernmarken und Zentrallager will der Schweizer Arzneimittel-Grossist mit seinem Apotheken-Geschäft in Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie seinem Online-Plattform-Business in Frankreich, Italien und Spanien wieder profitabel werden. Leidtragende sind dabei u. a. die Kunden deutscher Tochter-Apotheken.
Auf Grund des kundenfeindlichen Verhaltens der "Eurapon"-Support-Mitarbeiter und der bis zur Veröffentlichung unsicheren Belieferung durch "Eurapon" und die Versand-Logistik von "Doc Morris" rät HANSEVALLEY im Rahmen seines HANSETECHTESTS von einer Online-Bestellung bei "Doc Morris" und anderen Online-Apotheken des Schweizer Konzerns "Zur Rose" ausdrücklich ab.
-
EDEKA lässt Kunden mit kaputten Filial-WLANs im Stich.
 |
Die EDEKA-App: Mit den eigenen Filial-Hotspots oft nicht nutzbar.
Foto: EDEKA |
Hamburg, 19.12.2022: Der "EDEKA"-Zentrale und der norddeutschen "EDEKA"-Genossenschaft in Minden ist die Nutzung ihrer konzerneigenen Kunden-App über Kunden-WLANs in ihren Filialen offensichtlich gleichgültig. Grund: Seit Monaten ist das Einbuchen in die durch den Berliner Dienstleister "Hotsplots" betriebenen Kunden-WLANs der "EDEKA Minden" für Nutzer von iPhones wie Android-Phones praktisch nicht möglich.
In Filialen mit Betonwänden können Kunden aus diesem Grund weder die "EDEKA"-App öffnen, noch Gutscheine in Anspruch nehmen, mit ihr bezahlen oder Bonuspunkte sammeln. Die Erfahrungen basieren auf Erlebnissen von HANSEVALLEY-Redakteuren in mehreren durch "EDEKA Minden" betriebenen Märkten. Sie wurden von Mitarbeitern vor Ort bestätigt.
So kann sich das Personal der betroffenen Filialen mit ihren mobilen Endgeräten zur Warenbestellung und mit dienstlichen Handys ebenfalls nicht einbuchen. Zu den technischen Problemen in Verantwortung von "Hotsplots" gehören schwache Leitungen, zu wenige Hotspots selbst in kleineren Filialen und ein seit Monaten bekannter Programmierfehler in der Landingpage, der ein Einloggen nicht zulässt.
Auch nach mehrfacher Beschwerde gegenüber Filialmitarbeitern und einem Regionalleiter wurden die Probleme in den vergangenen Monaten nicht abgestellt. Mitarbeiter bestätigten gegenüber HANSEVALLEY, dass vereinzelt zwar Techniker vor Ort waren, die Probleme aber nicht behoben wurden.
Der größte deutsche Lebensmittel-Filialist scheint seine Kunden zudem nicht ernst zu nehmen. App-Nutzer, die regelmäßig die App einsetzen, um Bonuspunkte des hauseigenen Programms "Genuss+" zu sammeln, erleben nach einem Jahr Nutzung ihr blaues Wunder. Dann werden alle gesammelten Punkte ohne Vorwarnung komplett gelöscht - unabhängig, wann die Punkte gesammelt wurden.
Ein Versuch, das Problem unverhofft gelöschter Bonuspunkte mit dem telefonischen Kundendienst der "EDEKA" zu klären, scheiterte. Nach wenigen Minuten Wartezeit in der zentralen Hotline werden Anrufer einfach aus der Leitung geworfen. Offenbar stellt die "EDEKA-Zentrale" ihrem externen Support-Dienstleister nicht genügend Mittel für Mitarbeiter zur Verfügung.
Im Rahmen des HANSETECHTESTS rät HANSEVALLEY von der Nutzung sowohl der Kunden-WLANs als auch der Kunden-App mit dem Bonuspunkte-Programm "Genuss+" ausdrücklich ab.
-




























































































































.jpg)























































.jpg)










.jpg)























.jpg)


























































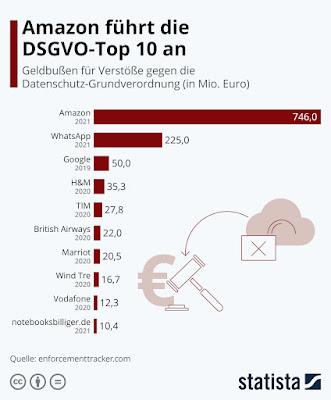
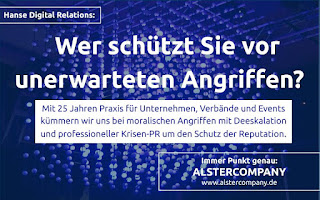


Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen